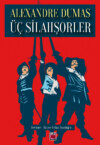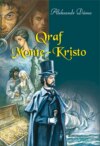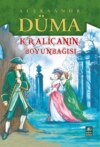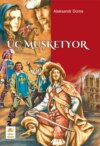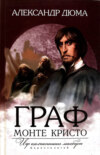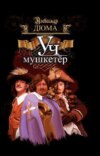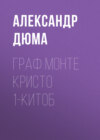Kitabı oku: «Memoiren einer Favorite», sayfa 18
Drittes Capitel
Man begreift, daß ich bei meiner Vorliebe für das Theater sofort nach meiner Ankunft in Rom Sir William bat, mich ins Schauspiel zu führen. Meine Neugier war um so unwiderstehlicher, als ich hatte erzählen hören, daß hier die Gewohnheit herrsche, die Frauenrollen durch Knaben spielen zu lassen.
Übrigens weiß ich nicht, ob man die amphibischen Wesen, welche hier die Stelle der Frauen vertreten, Knaben nennen kann. Bei den Griechen, diesen leidenschaftlichen Verehrern der Schönheit, hatte die plastische Träumerei den Hermaphroditen, die Verschmelzung aller Schönheiten beider Geschlechter und welcher gleichzeitig Hebe und Ganymed war, erfunden.
Die Römer dagegen haben ein ganz besonderes Wesen erfunden, welches weder dem einen noch dem anderen Geschlecht angehört und welches weder Hebe noch Ganymed ist. Für diese seltsamen Wesen begehen die römischen Prälaten jedes Alters dieselben Torheiten, welche unsere jungen Herren in London und Paris für die Damen der Oper begehen.
Sir William führte mich in das Theater Velle. Man gab hier »Armida« von Gluck, und die Rolle der Armida ward von einem jungen Sänger gegeben, welcher sich damals der Gunst der römischen Prälatur im höchsten Grade erfreute.
In dem Augenblicke, wo er auf der Bühne erschien – und ich gestehe, wenn man mir es nicht vorher gesagt, so hätte ich darauf gewettet, daß es eine Frau und zwar eine hübsche Frau sei – in dem Augenblicke, wo er auf der Bühne erschien, sage ich, und ehe er noch einen einzigen Ton gesungen, brach das ganze Haus in einen wütenden Beifallssturm aus.
Ernste Prälaten, alte Kardinale, deren schroffer Anblick mich betroffen gemacht, schienen mir nahe daran zu sein, vor Wohlbehagen ohnmächtig zu werden, als dieser – als dieses – ich weiß wirklich nicht, wie ich sagen soll als dieses Objekt aus den Kulissen heraustrat.
Sein Erfolg war ein unermeßlicher.
Wir hatten in unserer Loge den Kardinal Braschi Onesti, jüngsten Bruder des Prinzen-Herzogs, welcher, kaum von einer schweren Krankheit erstanden, gemeint hatte, eine Leidenschaft für diesen zweiten Sporus habe für einen Rekonvaleszenten nichts Gefährliches. Er erzählte uns mit Stolz, daß die Krankheit, welche er überstanden, durch eine vollständige Erschöpfung der Kräfte herbeigeführt worden und zwar infolge einer Orgie, bei welcher er gewettet, es mit den fünf größten Trinkern und den fünf schönsten Kurtisanen Venedigs aufzunehmen.
Er hatte beinahe den Tod davon gehabt, aber doch seine Wette gewonnen.
Der Kardinal Braschi Onesti war einer der eifrigsten Anbeter des Wunders des Tages. Er erbot sich, Sir William Hamilton in die Loge der seltsamen Armida zu führen, und ihn der Toilette der Zauberin beiwohnen zu lassen, welche zwischen dem ersten und zweiten Akt das Kostüm wechselte.
Ich fragte, ob auch Damen mit dabei sein könnten.
Er antwortete mir, dies sei allerdings nicht gebräuchlich, ganz gewiß aber würde ich in meiner Eigenschaft als Fremde von dem Signor Veluti so hieß er freundlichst empfangen werden, besonders wenn ich mich dazu verstünde, ihm einige Komplimente zu machen. Übrigens sei Signor Veluti ein großer Verehrer schöner Frauen.
Der Kardinal ließ uns die Verbindungstür zwischen dem Zuschauerraum und der Bühne öffnen. Wir gingen quer über diese hinweg und kamen in den Korridor, welcher nach der Loge der Armida führte. An der Tür war großes Gedränge und der Korridor gedrängt voll.
Beim Anblick des Neffen des Kardinals aber öffneten sich die Reihen, die untergeordneten Anbeter drückten sich an die Wände, und man ließ uns vorbei.
Wir traten in eine ganz mit himmelblauem Atlas ausgeschlagene Loge, welche in bezug auf Eleganz mit dem Boudoir einer Modedame wetteifern konnte.
Das Idol saß vor seinem Altar, das heißt bei seiner Toilette. Es empfing den Kardinal-Neffen mit dem reizendsten Lächeln und fragte ihn, wie er es wagen könne vor ihm zu erscheinen, ohne ihm einen Blumenstrauß oder eine Schachtel Bonbons mitzubringen. Der Kardinal Braschi Onesti zog von seinem Finger einen Brillantring im Werte von vielleicht tausend römischen Talern, steckte ihn an den Zeigefinger des Signor Veluti und bat ihn, diesen Ring anstatt eines Buketts anzunehmen. Da er, sagte er, die Ehre gehabt, den Gesandten und die Gesandtin von England in das Theater zu begleiten, so habe er nicht gewußt, ob es ihm diesen Abend möglich sein würde, ihm sein Kompliment zu machen. Sir William und Lady Hamilton hätten jedoch gewünscht, den großen Sänger, dem sie Beifall gezollt, in der Nähe zu sehen und er, Braschi, habe diese Gelegenheit benutzt, um seinem Lieblingskünstler das Vergnügen zu bezeigen, welches dieser ihm in dem ersten Akte der »Armida« bereitet.
Nachdem der Kardinal dies gesagt, stellte er uns den Signor Veluti vor, welcher Sir William Hamilton die Ehre erzeigte, ihm die Hand zum Kusse zu reichen, während er mich einlud, Platz zu nehmen.
Sei es nun, daß unsere Eigenschaft als Fremde in seinen Augen uns zur Empfehlung gereichte, sei es, daß er sich geschmeichelt fühlte, den Besuch des Gesandten einer Macht ersten Ranges zu empfangen, kurz der Signor Veluti war gegen uns äußerst liebenswürdig. Er warf mir die zärtlichsten Blicke zu und sagte, wenn wir es erlaubten, so würde er sich glücklich schätzen, unsern Besuch zu erwidern.
Man kann sich denken, daß wir uns wohl hüteten, eine solche Gunst abzulehnen.
Dann bat er, indem er sich besonders mit mir beschäftigte, mich, ihm den Namen des Opiats zu nennen, womit ich mir die Lippen riebe und die Flüssigkeit, womit ich mir die Zähne spülte. Ich antwortete ihm, daß ich mich für die Zähne nie eines anderen Mittels bedient hätte, als eben des reinen Wassers, und was meine Lippen beträfe, so hätten dieselben von Natur die Farbe, die er daran sähe.
Der Signor Veluti rief, ein solches Wunder sei unmöglich, ergriff die Kerze und bat mich um Erlaubnis, meine Lippen und meine Zähne in der Nähe zu betrachten eine Musterung, die ich mir bereitwillig gefallen ließ, und nach welcher Signor Veluti erklärte, ich sei sicherlich eine der schönsten Personen, die er jemals gesehen.
Dann kehrte er, wahrscheinlich in der Meinung, mir durch diese Schmeichelei seinen Tribut der Gastfreundschaft entrichtet zu haben, zu seiner Toilette zurück, kokettierte mit seinen Bewunderern und ließ von Zeit zu Zeit eine anmutige Roulade hören, welcher von den Zuhörern enthusiastischer Beifall gespendet ward.
Es war seltsam, zu sehen, welche Mühe diese Zuhörer, die beinahe sämtlich der hohen Prälatur angehörten, sich gaben, um von der falschen Armida ein Lächeln, einen Blick, ein Wort zu erobern. Der eine hielt ihm seinen Kranz von Rosen, der andere seinen Zauberstab, dieser das Gewebe, welches seine Reize nicht bedecken, sondern durchschimmern lassen sollte, jener den kleinen Mantel, welcher diese himmlische Stimme vor den Luftströmungen schützen sollte, welche nachteilig darauf einwirken konnten.
Ich saß da, ich sah, ich hörte, ich glaubte zu träumen. Ich lächelte unwillkürlich über diese Beweise von Ehrerbietung, die von Männern, welche das Volk als ehrwürdige Persönlichkeiten betrachtete, diesem Idol gegeben wurden, welches jener unzähligen Menge falscher Götter in dem Pantheon menschlicher Ketzereien eine unglaubliche Einheit mehr hinzufügte.
Der Augenblick, wo Armida wieder auf der Bühne erscheinen mußte, war da, die Klingel des Inspizienten ließ sich für die gemeinsamen Märtyrer hören; für den Signor oder die Signora Veluti, wie man will, erfolgte die Aufforderung mündlich durch den Regisseur und mit allen Kennzeichen von Ehrerbietung, die er einer wirklichen Königin bewiesen haben würde.
Die schöne Armida nahm sich nur mir allein gegenüber die Mühe, sich wegen ihrer gezwungenen Abwesenheit zu entschuldigen, dann berührte sie mich mit ihrem Zauberstabe und sagte:
»Schöner als Sie sind kann ich Sie nicht machen, wohl aber kann ich für Sie tun, was die Sibylle von Cumä, welche zu besuchen Sie im Begriffe stehen, von Apollo vergessen hatte zu verlangen. Ich kann nämlich durch meine Zauberkunst machen, daß Sie ewig schön bleiben.«
Dann machte die Zauberin, indem sie einige Worte sprach welche eine cabbalistische Formel sein sollten, mir eine weibliche Reverenz und entfernte sich, indem sie sich hin und her wiegte und eine Cadenz hören ließ, an deren Reinheit und Wohlklang sich allerdings nichts aussetzen ließ.
Ich verließ das Zimmer Armidas stumm vor Erstaunen und kehrte in meine Loge zurück, die sich so nahe an der Bühne befand, daß ich von dem Signor oder der Signora Veluti wieder erkannt ward, und diese die Güte hatte, während des noch ganzen übrigen Abends mir Beweise ihrer Aufmerksamkeit zu geben, sei es, indem sie ihre schwierigsten Passagen an mich richtete, sei es, indem sie ihre mörderischsten Blicke nach mir schleuderte.
Am nächstfolgenden Tag empfing ich den Besuch des Grafen von Bristol, welchem ich die fabelhaften Ereignisse des vorigen Abends erzählte. Er fing an zu lachen und erzählte mir, daß es in Rom unter der hohen Prälatur eine achte Todsünde gäbe, welche man die noble nenne.
Wie groß auch meine Neugier war, den Signor oder die Signora Veluti in der Nähe und bei Tag zu sehen, so ließ ich ihn doch, als er fünf Uhr nachmittags in einem eleganten Abbékostüme erschien, mit der Entschuldigung abweisen, daß die Vorbereitungen zu meiner Abreise es mir unmöglich machten, irgendwelchen Besuch zu empfangen.
In der Nacht, welche dieser Abreise voranging, ereignete sich ein merkwürdiger Vorfall, welcher von der Art und Weise, auf welche damals in Rom die Polizei gehandhabt ward, einen Begriff geben kann.
Kaum fünfzig Schritte von unserm Hotel, auf dem sogenannten Spanischen Platze war bei Rovaglio, dem Uhrmacher des Vatikans, gegen zwei Uhr morgens ein Einbruchdiebstahl versucht worden. Der Uhrmacher, sein Sohn und zwei Diener hatten sich zur Wehr gesetzt. Einer der Räuber war auf dem Platze geblieben und einen zweiten hatte man sterbend an der Ecke der Straße del Babuino liegend gefunden.
Am nächstfolgenden Tage erfuhr man, auf welche Weise Rovaglio sich selbst Gerechtigkeit verschafft hatte.
Es war nicht das erstemal, daß man bei diesem Manne einzubrechen versucht, dessen Kaufladen, wie man wußte, einen reichen Vorrat von Uhren und Schmucksachen enthielt. Schon zweimal hatte er durch das Geräusch, welches er im Innern des Ladens gemacht, dergleichen Versuche vereitelt.
Jedesmal hatte er dann die Polizei davon benachrichtigt. Der mit dem Departement der öffentlichen Sicherheit betraute Prälat Busca hatte aber nur mit schönen Redensarten geantwortet, ohne irgendwelche Maßregel gegen die Diebe anzuordnen.
Als Rovaglio sich auf diese Weise von der Behörde, die ihn hätte beschützen sollen, verlassen sah, richtete er, als er eines Tages in den Vatikan ging, um die Uhren zu stellen, es so ein, daß er dem Papste begegnete, dem er alles erzählte, worauf er ihn um direkten Beistand gegen die Industriellen bat, welche sich mit gewaffneter Hand in sein Geschäft zu mischen suchten.
»Mein lieber Rovaglio,« antwortete ihm der Papst, »ich nehme an der kritischen Lage, worin Sie sich befinden, aufrichtig Teil, aber ich kann nichts tun. Da Monsignore Busca Sie nicht beschützen will, so kann ich ihn auch nicht zwingen, es zu tun; schützen Sie sich lieber selbst.«
»Aber wie soll ich das tun?« fragte Rovaglio.
»Legen Sie sich mit Ihren Söhnen und Dienstleuten gut bewaffnet, sei es im Laden selbst oder hinter der Tür, in den Hinterhalt, und wenn die Bösewichter wiederkommen, um Sie zu berauben, so schießen Sie dieselben nieder. Mögen Sie deren töten, so viel Sie wollen – ich erteile Ihnen im voraus Absolution.«
Rovaglio war dem Rate des Papstes gefolgt; er hatte sich selbst geschützt und zwei Banditen getötet.
Der Papst hielt Wort und erteilte ihm für diese beiden Mordtaten öffentliche Absolution.
Viertes Capitel
Ich kann Rom nicht verlassen, ohne hier noch einige Bemerkungen über die Menschen und die Ereignisse einzuschalten. Der Vergleich, den ich zwischen unseren nordischen Sitten und denen des Südens anstellte, prägte sich meiner Erinnerung so tief ein, daß jetzt, nach dreißig Jahren, das Gemälde der Personen und der Ereignisse unter meiner Feder ebenso genau wieder zum Vorschein kommt, als wenn ich die Zeilen, die man sogleich lesen wird, auf der Durchreise in Rom im Jahre 1788 geschrieben hätte.
Was mir bei meiner Ankunft in Rom zunächst auffiel, war der große Unterschied, den ich hier zwischen den Preisen aller Dinge bemerkte. Eine Mietequipage kostet in London eine Guinee den Tag, in Paris achtzehn Francs, in Rom bloß sieben oder acht Francs.
Dasselbe Verhältnis findet in Bezug auf die Hotels statt. In London kostet eine einigermaßen hübsche Wohnung eine Guinee täglich, in Paris fünfzehn Francs, in Rom kaum zehn Francs.
Teuer ist in Rom weder der Wagen, noch die Wohnung, noch auch die Beköstigung – man speist allerdings auch ganz abscheulich – sondern nur die buona mano oder mit andern Worten das Trinkgeld. Man kann bei einem vornehmen Mann weltlichen Standes, bei einem Kardinal oder bei einem Priester keinen Besuch machen, ohne daß den nächstfolgenden Tag die Diener in corpore einem ins Haus kommen, um sich ein Geschenk zu erbitten.
Der Erzbischof von Wien hatte Sir William ein Paket an den Kardinal Buoncampagno mitgegeben. Sir William, welcher keinen Grund hatte, diesen Prälaten zu sprechen, obschon derselbe der Bruder des regierenden Fürsten von Piombino war, ließ, als er durch die betreffende Straße fuhr, das Paket durch seinen Kammerdiener abgeben. Am nächstfolgenden Tage kam ein großer Bengel in der Livrée des Kardinals, um Sir William im Namen seines Herrn guten Tag zu wünschen und um ihn in seinem eigenen um eine buona mano zu bitten.
Sir William antwortete, er habe dem Kardinal Buoncampagno keineswegs einen Besuch gemacht, sondern sich darauf beschränkt, ihm ein Paket zuzustellen, dessen Besorgung er aus reiner Gefälligkeit übernommen. Es käme daher eher dem Kardinal zu, Sir Williams Kammerdiener ein Trinkgeld zu geben, als Sir William dem Kammerdiener des Kardinals ein solches zu verabreichen.
Der Wicht beharrte nichtsdestoweniger immer noch auf seinem Verlangen. Sir William aber ließ ihm die Tür vor der Nase zuschlagen.
Sir Williams Bankier in Rom war ein zu seltsamer Mensch, als daß ich nicht im Vorübergehen einige Worte über ihn sagen sollte. Er hieß Thomas Jenkens, war geborener Engländer und hatte anfangs die Malerei studiert. Da er jedoch bemerkt, daß er stets ein nur mittelmäßiger Künstler bleiben würde, so begnügte er sich, während er das Bankierhandwerk ausübte, ein geschickter Kenner zu bleiben, der in der Theorie alles dessen, was auf Malerei und Zeichenkunst Bezug hat, gründlich bewandert war.
Dabei war er zugleich ein Archäolog, dessen Urteil in bezug auf Kameen und geschnittene Steine als beinahe unfehlbar betrachtet ward. Niemand verstand besser als er über ein Basrelief, über eine Statue oder eine Büste zu sprechen, wie beschädigt der Gegenstand auch durch sein Verweilen in der Erde oder durch das Werkzeug des Arbeiters, der es ausgegraben, sein mochte.
Um sein Lob vollständig zu machen, will ich noch bemerken, daß er oft von dem Kardinal Alexander Albani den man nicht mit dem Kardinal Francesco verwechseln darf von dem berühmten Winkelmann, dem Verfasser der »Geschichte der Kunst bei den Alten«, und von dem berühmten Raphael Mengs, einem der besten Maler der neueren Schule, der nun seit zehn Jahren tot war, zu Rate gezogen ward.
Diese Verbindung des Handels mit Statuen, Kameen und Medaillen mit den Geschäften eines Bankiers hatte Jenkens zu einem der reichsten Kapitalisten Roms gemacht.
Sir William entnahm von ihm nicht bloß das Geld, dessen er zur Fortsetzung seiner Reise bedurfte, sondern kaufte ihm auch zwei oder drei seiner schönsten Ringe und Kameen ab, die er mir zum Geschenk machte.
Bei dieser Gelegenheit war ich Zeuge der Art und Weise, auf welche Jenkens verkauft, und die Erinnerung daran ist unauslöschlich in mir zurückgeblieben. Wenn der Gegenstand, den man Jenkens abkaufen wollte, eine Medaille war, so begann er damit, daß er die Geschichte des Ereignisses oder der Person erzählte, worauf sie Bezug hatte, worauf er in einer mit großem Pathos gehaltenen pomphaften Lobrede die Seltenheit und Eigentümlichkeit des betreffenden Exemplares rühmte, worauf er natürlich bemüht war; einen bedeutenden Preis zu fordern. Bezahlte man ihm dann gegen sein Erwarten den verlangten Preis, so begann er zu seufzen, Tränen zu vergießen und zu schluchzen. Ein Vater, der sich seine einzige Tochter durch einen Mann entführen sähe, welcher mit ihr zu den Antipoden ginge, könnte keinen lebhafteren Schmerz an den Tag legen.
Ich war mit zugegen, als Sir William ihm die für mich bestimmten Schmucksachen abkaufte, und ich gestehe, daß ich selbst bis zu Tränen gerührt ward.
»Mylord,« sagte er zu Sir William, »wenn Sie den Handel, den Sie soeben mit mir abgeschlossen, jemals bereuen, so bringen Sie mir diese Ringe, diese Kameen, diese Medaillen wieder. Sie werden mich stets bereit finden, Ihnen den dafür gezahlten Preis zurückzuerstatten und mir dadurch obendrein einen hohen Trost bereiten.«
Das Außerordentliche hierbei ist, daß Jenkens, den man zuweilen beim Wort gehalten, niemals verfehlt hatte, das, was er versprochen, auch zu tun und das für den Gegenstand empfangene Geld ungeschmälert zurückzuerstatten, wobei er zugleich die lebhafteste Freude an den Tag gelegt, daß er sich wieder im Besitz des schmerzlich vermißten Gegenstandes sah.
Mochte dies nun Berechnung oder das wahre Gefühl eines Archäologen sein, welcher, wie Cardillac, sich nicht entschließen konnte, sich von seinem Schatz zu trennen, so äußerte die Treue, womit Jenkens sein Wort hielt, auf den Käufer allemal eine beruhigende Wirkung, denn dieser glaubte nie eine Sache über ihren Wert zu bezahlen, da er ja wußte, daß er, wenn er sie dem Verkäufer wiederbrächte, dieser ihm sofort das Geld wieder herauszahlen würde.
Ich bilde mir ein, daß ich die Kunst verstehe, durch meine Physiognomie die verschiedenen Empfindungen der Seele auszudrücken, aber ich gestehe, daß, wenn Jenkens, anstatt bei der Trennung von seinen Kameen und Medaillen einen aufrichtigen Schmerz zu empfinden, bloß eine eingelernte Rolle spielte, er in der Kunst des Lachens und des Weinens mich weit hinter sich zurückließ.
Wir sahen auf dieser Durchreise durch Rom – ohne jedoch nähere Bekanntschaft mit dem Manne zu machen – einen Prälaten, der früher an dem Hofe von Neapel eine so bedeutende Rolle spielte, daß ich ihn schon jetzt dem Leser vorstellen zu müssen glaube.
Ich spreche nämlich von dem päpstlichen Oberschatzmeister, Monsignore Fabrizzio Ruffo.
Derselbe war der Neffe des Kardinals Ruffo, Dekan des heiligen Kollegs, welcher, wie ich schon bemerkt, den schönen Angelo Braschi veranlaßte, sich dem geistlichen Stande zu widmen.
Wir müssen Pius dem Sechsten die Gerechtigkeit widerfahren lassen, zu sagen, daß er, auf den Thron des heiligen Petrus gelangt, dem Manne, der ihm den Weg dazu gebahnt, sich so dankbar verpflichtet fühlte, daß seine erste Sorge war, dem Neffen des verstorbenen Kardinals denselben Posten zu geben, welchen er, Braschi, früher von Rezzonico durch die Protektion der schönen Julia Falconieri erhalten. Er machte den jungen Fabrizzio Ruffo zum Großschatzmeister, ein Amt, welches, wie ich schon bemerkt zu haben glaube, dem, der es niederlegt, von Rechts wegen den Kardinalshut einträgt.
Monsignore Ruffo galt in Rom für einen Mann von scharfem Verstand, welchem die Kunst der Folard und der Montecuculi nicht unbekannt war. Er pflegte sogar selbst zu sagen, daß, wenn er zur Zeit der Lavalette und der Richelieu gelebt hätte, er öfter den Panzer und Helm als das Barett und den Purpurmantel getragen haben würde.
Großer Liebhaber des schönen Geschlechts und aus dieser seiner Neigung durchaus kein Hehl machend, gab er gegen die männlichen Sängerinnen oder die weiblichen Sänger die größte Verachtung zu erkennen.
Zur Zeit unserer Durchreise machte er eifrig einer Signora Lepri den Hof, einer Verwandten jener Anna Maria, deren ungerechte Bedrückung wir erzählt. Da er sich keineswegs versteckte, so waren seine Liebschaften aller Welt bekannt, und dies verschaffte ihm die Ehre, in satirischen Versen besungen zu werden, deren Verfasser, ein Zeitungsschreiber in Florenz, mit langer Gefängnisstrafe belegt ward. Seit dem berüchtigten Pasquillanten, welcher von Sixtus dem Fünften zu den Galeeren verurteilt ward, hatte man kein Beispiel von solcher Strenge gesehen.
Da ich hier auf einen in Rom sehr bekannten Vorfall, den man anderwärts nur wenig kennt, anspiele, so ist es vielleicht nicht unangemessen, wenn ich hier, um mein Sittengemälde zu vervollständigen, eine Parenthese öffne und die Sache erzähle.
Unter dem Pontifikat Sixtus des Fünften hatte ein Dichter Namens Marere einige satirische Verse geschrieben, in welchen er die Gattin eines hohen Beamten beleidigt, der sich deswegen bei dem Papst beschwerte. Dieser, ein strenger, aber gerechter Richter, ließ den Dichter rufen und befragte ihn über die Beweggründe, die er gehabt, sich so etwas zu erlauben. Nach mehreren Erklärungen, welche den Papst nicht zufriedenstellten, obschon sie diesen zuweilen bewogen, zu lächeln, fragte er, wie er eine Frau, deren Name beinahe ein Symbol der Tugend sei, öffentlich mit ihrem Namen als eine Kurtisane habe bezeichnen können.
»Hattet Ihr vielleicht Grund, Euch über sie zu beklagen?« fragte Sixtus der Fünfte.
»Nein,« antwortete der Poet, »durchaus nicht.«
»Aber warum habt Ihr sie dann verleumdet und beleidigt?«
»Ich brauchte einen Reim und ihr Name lieferte mir denselben.«
Sixtus der Fünfte biß sich auf die Lippe.
»Und Ihr, Herr Poet, wie heißt Ihr?« fragte er dann.
»Marere, Euer Heiligkeit zu dienen,« antwortete der Poet.
»Wohlan, die Reihe des Versmachens ist nun an mir, und da Euer Name mir ebenfalls einen Reim liefert, so werde ich auch versuchen zu reimen:
»Ihr verdienet, Signor Marere,
Zu rudern auf einer Galeere!«
Das auf diese Weise von dem Papst gesprochene Urteil ward auch wirklich in Vollzug gesetzt und auf alle Bitten, welche man zugunsten des Schuldigen bei Sixtus anbrachte, antwortete er:
»Einen guten passenden Reim findet man selten; ist dies aber der Fall, so muß ein solches Ereignis auch konstatiert werden und Epoche machen.«
Und Signor Marere mußte demgemäß auf den Galeeren von Civita Vecchia rudern, wo er starb und zwei Bände unveröffentlichte Gedichte hinterließ, die für die Nachwelt verloren gingen, da kein Verleger den Mut hatte, sie herauszugeben.
Am Abend unserer Abreise hatten wir, als wir das Theater verließen, da es noch ziemlich zeitig war, unsern Abschiedsbesuch bei jenem liebenswürdigen Kardinal von Bernis gemacht, welchem Voltaire den Namen »Babette das Blumenmädchen« gegeben.
Wir trafen bei ihm den Grafen von Bristol, Bischof von Derry, welcher sich in derselben Absicht hier befand.
»Sie verlassen also Rom auch, Mylord?« fragte ich diesen seltsamen Prälaten, dessen Originalität mich für ihn interessierte.
»Jawohl meine schöne Landsmännin, die Gnade hat mich erleuchtet.«
»Wann werden Sie abreisen?«
»Morgen.«
»Und wohin, wenn man fragen darf?«
»Das sollen Sie morgen erfahren,«
Am nächstfolgenden Tage erschien er bei uns, nachdem wir gefrühstückt, und verlangte eine Unterredung mit Sir William.
Sir William ging mit ihm in ein Kabinett.
Fünf Minuten später kam er wieder heraus und führte den Bischof an der Hand.
»Liebe Emma,« sagte er, »Mylord behauptet, er habe sich plötzlich so sehr in dich verliebt, daß er sich von deiner teuren Person nicht trennen könne, ohne vor Sehnsucht zu sterben. Demzufolge bittet er uns um Erlaubnis, uns nach Neapel zu begleiten. Da du wahrscheinlich nicht gesonnen bist, den Tod eines unserer vornehmsten Pairs und eines der höchsten Würdenträger unserer Kirche zu verschulden, so habe ich für meine Person seine Bitte bewilligt, und er erwartet nur noch deine Zustimmung, um der stolzeste aller Menschen und der glücklichste aller Bischöfe zu sein.«
Da die zweiundsiebzig Jahre des Lord-Bischofs mir keine große Furcht einflößten, so glaubte ich nicht, mich wegen einer so unschuldigen Bitte mit Sir William Hamilton in Widerspruch setzen zu müssen.
Ich reichte dem Lord die Hand, welche er mit dem Ausdrucke der lebhaftesten Freude küßte, und wir kamen überein, daß er von diesem Augenblicke als mein Cavaliere servente oder dienender Ritter der englischen Gesandtschaft attachiert sein sollte.