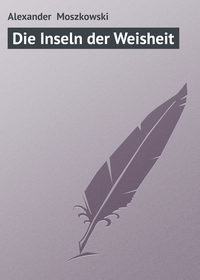Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Die Inseln der Weisheit», sayfa 3
* * *
Als wir in dessen Nähe gelangten, stellte der Ausguck fest, daß dort allerdings etwas vorhanden war. Ein verlorenes, flaches Inselchen, nach Bodenfläche wohl nicht größer als Helgoland, das hinter langgestreckten Korallenriffen schlummerte. Die mit Seegewächsen durchflochtenen Riffe zeigten nur geringe Lücken, unser Schiff hielt sonach weit draußen, und wir versuchten, auf einem herabgelassenen kleinen Hilfsboot den Durchgang zu erzielen. Das Ergebnis der ersten Orientierung war trostlos. Nach dem im Sonnenbrande glühenden Schiefergestein des Südufers zu urteilen hatten wir eine Ödfläche betreten, die wie Salas y Gomez in Unwirtlichkeit starrte. Weiter hinein wurde es etwas erträglicher. Wir erblickten spärlichen Pflanzenwuchs und etliches Kleinvieh, das traurig dahinweidete. Menschliche Spuren schienen nicht vorhanden, und im Pegel unserer Hoffnung, hier Bedeutungsvolles zu erfahren, senkte sich die Erwartung unter Null. Kreyher hielt den Zeitpunkt für gegeben, seinem Mißtrauen einen kräftigen Auspuff zu gewähren: wenn die übrigen »Inseln der Verheißung« diesem Anfang ähnelten, dann könnten sie sich alle zusammen begraben lassen.
Wir waren nahe daran, wieder umzukehren, als Eva auf ein winziges Hügelchen aufmerksam machte, der einzigen Erhebung in der sonst mit einem Blick umspannbaren Ebene. Als wir es umgingen, gelangten wir auf der Nordseite an ein menschliches Bauwerk. Ein Mittelding zwischen Häuschen und Hütte, äußerlich sauber gehalten, dabei eine Gemüsepflanzung, vor ihr eine Holzbank. Aus der Tür trat ein Mann in mittleren Jahren, mit gewissen Zeichen der Intelligenz im bebrillten, bärtigen Gesicht, in einem Anzug von klimawidriger, unfroher Dunkelheit. Er stützte sich mühsam auf einen kurzen Stock und sandte uns mit der freien Hand einen kurzen, stummen Gruß entgegen, ohne indes das mindeste Erstaunen über unsern Besuch zu verraten.
Donath nahm als erster das Wort und versuchte es in mehreren Unterarten des Polynesischen. Der Hüttenbewohner hörte aufmerksam zu und schien zu verstehen. Allein er traf nicht die leisesten Anstalten, um uns mit einer Antwort zu bedienen. In unseren wechselseitig ausgetauschten Blicken lag die Frage, sollte er stumm sein? Aber dann hätte er doch wenigstens mit Zeichen reagiert. Nichts von alledem: er wollte nicht antworten.
Aber er legte auch unsrer Besichtigung seines Anwesens nichts in den Weg. Er duldete es wortlos, das wir das Häuschen betraten, dessen primitive Einrichtung der Behaglichkeit nicht ganz entbehrte. Es waren sogar einige Bücher vorhanden über Botanik und Zoologie, in englischer und spanischer Sprache, mit Zwischenblättern, die Übersetzungen ins Polynesische enthielten, dies Wort im weitesten Sinne genommen.
Wir verabschiedeten uns nach einiger Zeit und stellten baldiges Wiedersehen in Aussicht. Er wehrte nicht ab. An Bord ergingen wir uns in Mutmaßungen. Nach unseren Eindrücken gehörten die Insel sowie der Mann nicht mehr zum Begriff Hawai, wohin sie auch in geographischem Betracht nicht unterzubringen waren. Eher war anzunehmen, daß dieses Eiland den äußersten Vorposten der unentdeckten Gebiete vorstellte. Den Mann klassifizierten wir einstweilen als Einsiedler, den irgend ein Verhängnis von seinen Volksgenossen fortgetrieben haben mochte. Wir wollten versuchen, ihm die Zunge zu lösen und zwar zunächst dadurch, daß wir ihm aus unseren reichen Vorräten einige Gaben mitbrachten: Gebrauchsgegenstände für Haus und Körperpflege, kleines Handwerksgerät und ein paar Flaschen Burgunder.
Als wir am nächsten Tage unsere Spenden auspackten, und ihm zuwiesen, glitt ein freundlicher Anflug über seine Züge. Er nahm an, ohne merklich zu danken. Als er die Gegenstände ergriff, bemerkten wir an seinen Händen Handschuhe aus festem, gummiartigem Stoff, und ein leiser Karbolgeruch kam uns entgegen. Doktor Melchior Wehner, der beim ersten Besuch nicht mitgekommen war – da ihn die Verletzung eines Matrosen auf der »Atalanta« zurückgehalten hatte – und der sonach den Einsiedler zum erstenmal jetzt erblickte, trat auf ihn zu, maß ihn mit eindringenden, diagnostizierenden Blicken, drehte sich dann zu uns und sagte mit sicherem Tonfall: »Der Mann hat die Lepra.«
Der Einsiedler wiederholte mit schmerzlichem Ausdruck: »Lepra!« Das war das erste Wort, das wir von ihm vernahmen. Die Sprache war ihm also nicht versagt, aber es war ein fürchterlicher Anfang für eine Konversation.
Der Arzt, der vordem an unseren Sprachstudien nur unzureichenden Anteil genommen hatte, verfiel auf einen Ausweg, um sich mit dem Mann zu verständigen: Wenn einer Bücher besitzt, so ist ihm vielleicht mit dem klassischen Esperanto des Lateinischen beizukommen. Und er sprach zu ihm, wenn auch nicht klassisch, so doch in brauchbarem Fast-Latein:
»Sine dubio Lepra! Sed non omnino casus desperatus, non incurabilis. Est Lepra in primo stadio. Ego sum medicus, velim audere sanationem tuam. Intelligisne verba mea?«
»Intelligo!« sagte der Kranke; und in der Sprache seines Landes, die Donath und Eva, in bescheidenerem Grade auch mir leidlich verständlich klang, fuhr er fort:
»Ich wußte es schon. Und ich selbst habe mich als Aussätziger aus meiner Heimat verbannt, um hier in Einsamkeit mein Ende zu erwarten. Die Ärzte meines Landes sagen: es gibt bei Lepra nur periculum contagionis, aber es gibt keine Heilung.«
Der Arzt bemächtigte sich der Leitung, soweit sie das nächstliegende betraf. Vor allem mußte ein Pestkordon um den Kranken gezogen werden, Wehner drang auf unsere rasche Entfernung und bewirkte sie trotz Evas Einspruch, die als Krankenschwester in Funktion treten wollte. Auf der Bootfahrt entwickelte er uns, daß die Therapie neuerdings ein Mittel besäße, um die primäre, rechtzeitig erkannte Lepra wirksam zu bekämpfen: die Einspritzung von Tuberkulin; er selbst habe bei zwei Fällen in Masuren damit raschen Erfolg erzielt. Als er auf dem Schiff das Erforderliche vorbereitet hatte – hierzu gehörte ein Desinfektionsapparat, der mit Sublimat- und Formalinwolken das ganze Häuschen durchräuchern sollte – kehrte er zur Öd-Insel zurück, nur von einigen Matrosen begleitet, die im Boot verbleiben mußten. Der Kranke setzte zuerst den Injektionen Widerstand entgegen, er fügte sich aber bald und bot schon nach wenigen Tagen das klinische Musterbild rapider Besserung. Die grindigen Flecke verschorften sich zusehends, blätterten ab, die Haut regenerierte sich, und nach einer Woche konnte die Sperre aufgehoben werden. Wir hatten einen Rekonvaleszenten vor uns, dem ersichtlich daran gelegen war, Wohltat mit Dank zu vergelten. Und in Folge dieser Wandlung gab er uns Auskunft über die Hauptfragen, die im Sinne unserer Expedition zu erörtern waren. Hier erschloß sich, in theoretischen Anfängen, das geahnte Neuland.
* * *
Der Einsiedler, mit Namen Toraspasch, entstammte der Insel Karawuddi, wo er vordem als Naturwissenschaftler und Schulvorsteher gelebt hatte. Was wir durch ihn erfuhren, sei hier in kurzen Zügen zusammengestellt:
Daß die ganze Inselgruppe der Welt bislang verborgen blieb, das verdankt sie ihrer sporadischen Anlage im Nord und Nordost der Tuscaroratiefe und ihrer relativen Kleinheit. Alles in allem sind es etwa ein Viertelhundert Eilande, deren Gesamtfläche tausend Quadratmeilen nicht übersteigt, und die somit im Verhältnis zu der unabsehbaren ozeanischen Umspülung fast völlig verschwinden. Sie bilden einen Kosmos für sich mit dem Hauptkennzeichen: die Außenwelt weiß nichts von ihnen – aber sie kennen die Außenwelt!
Sehr verschieden in ihren Eigenkulturen und eifersüchtig auf die Pflege ihrer Besonderheiten bedacht, fühlen sie sich doch zusammengehörig durch Sprache und den gemeinsamen Willen, ihre Selbständigkeit aufrecht zu erhalten. Aber sie haben seit Urzeiten ihre Sendboten in die Welt hinausgeschickt, deren Aufgabe darin bestand: Nichts zu verraten und Alles zu erfahren; Nichts hinauszutragen und Alles hereinzubringen, was mit Wissenschaft und Bildung, mit Geistigkeit und Technik zusammenhängt. List, Verkleidung und Verhandlungsschlauheit halfen mit, um dies Programm seit Jahrhunderten durchzusetzen. Das einzige, dessen sich die Emissäre draußen entäußern durften, waren Edelmetalle, die in den heimatlichen Erdgründen und Wasserläufen gefunden werden. Diese Tauschmittel reichten aus, um als Gegenwert hauptsächlich Bücherschätze aus Europa zu erlangen. Diese bilden den Grundstock der insularen Sonderkulturen. »Wir« – so sagte der Einsiedler – »sind in keinem Betracht der Technik hinter der europäischen zurück; dagegen haben wir sie in wesentlichen Zügen durch unsere anschließenden Erfindungen erweitert und vervollkommnet. Nicht wenige unserer Insulaner können es in Sach-, Begriffs- und Sprachkunde mit den berühmten Professoren Ihrer Hochschulen aufnehmen. In der Hauptstadt der Insel Saragalla befindet sich eine Bibliothek von neunzigtausend Bänden, die zum größten Teil von unseren Gelehrten verfaßt, in unseren eigenen Druckereien hergestellt worden sind. Aber Sie können auch den Almagest des Ptolemäus, den Aristoteles, die Werke der Scholastik und die Enzyklopädisten darin finden, bis zu den letzten Ausläufern der neuzeitlichen Wissenschaft.
Aber strenge Abschließung blieb das Hauptprinzip. Wir hatten genug von den Segnungen erfahren, die sich für Euresgleichen unter den Deckworten der Mission, der Kolonisierung, der Erschließung ferner Länder verbirgt, und wir trugen kein Verlangen, an diesen Segnungen teilzunehmen. Neuerdings haben sich unsere Ansichten hierüber ein wenig verändert. Es wurde uns bekannt, daß Ihr ein neues Schlagwort aufgebracht habt, die »Selbstbestimmung der Völker«, und wir dachten deshalb daran, unser Incognito zu lüften. Darüber wogte bis vor wenigen Jahren der Meinungsstreit. Es wäre nunmehr gefahrlos, sich zu offenbaren, da unsere nationalen Rechte gewiß respektiert werden würden, – so sagten die einen. Andere erhoben ihre warnende Stimme: Selbstbestimmung – das bedeute nichts anderes, als daß den Inseln das Recht zugestanden würde, selbst zu bestimmen, ob sie mit oder ohne Salutgeknall, mit oder ohne Tedeum annektiert werden wollten. Entscheidend wirkte schließlich eine in allerletzter Zeit auf unserer Insel Kuakua gemachte Erfindung. Wir fürchten uns nicht mehr, weil wir stark genug sind, um uns zu wehren. Wir besitzen ein Giftgas, das die festen Körper durchdringt und auf weiteste Entfernung übers Meer hinausgeblasen werden kann. Keine Angriffsflotte der Welt dürfte sich an uns heranwagen. Als wir daher von der Ausreise eurer Yacht Kenntnis erhielten, meinten unsere Führer und Behörden: Die Leute mögen kommen, Umschau halten und berichten, eine Gefahr ist heut nicht mehr vorhanden.
Ihr steht nunmehr im Begriff, mit Gestaltungen Bekanntschaft zu machen, die von den euch vertrauten vielfach stark abweichen, obschon sie aus Denkweisen der euch vertrauten Kulturen entwickelt sind. Unsere Inseln sind sozusagen menschliche Versuchsstationen für Prinzipe. In Staatsform und Gepflogenheiten werdet ihr bei uns gewisse Prinzipien ausgebaut finden, die aus der Philosophie, der Sittenkunde, der Biologie, der Kunst und aus anderen Gebieten herstammen. So ist zum Beispiel meine Heimatsinsel Karawuddi durchaus optimistisch gerichtet, während auf andern der Pessimismus, die Skeptik und besondere Prinzipe der Ethik vorwalten. Daneben werdet ihr auch allerlei Seltsamkeiten erfahren, die sich darauf gründen, daß die Bedingungen zu ihrer Verwirklichung nur bei uns angetroffen werden, sich nirgends wiederholen und deshalb von uns als Eigenheiten unserer Gruppe gepflegt werden. An Abwechslung wird es so wenig fehlen, daß ihr Mühe haben werdet, euch aus den Eindrücken der einen auf die der folgenden schnell genug umzustellen.«
Beim Abschied übergab uns der Mann Toraspasch eine Lagekarte des ozeanischen Feldes, auf der die Hauptinseln, nur mit deren Namen bezeichnet, eingetragen waren. Die Einzelheiten vorwegzunehmen hielt er für unangebracht, diese sollten vielmehr unseren persönlichen Wahrnehmungen überlassen bleiben. Er empfahl uns indes, mit der Insel Balëuto den Anfang zu machen; was wir auch ohnehin getan hätten, denn Balëuto lag uns zunächst, und die neue Karte befähigte uns, sie in kürzester Linie zu erreichen.
Balëuto
Die Platonische Insel
Ich übergehe die Einzelheiten unserer Landung und vertraue hierin der Phantasie des Lesers, auf die Gefahr hin, daß in den von ihr entworfenen Bildern manches inkorrekt ausfallen sollte. Denn es kommt ja nicht darauf an, zu schildern, welchen Eindruck wir auf die fremden Menschen machten, als vielmehr darauf, welche Eindrücke wir davontrugen. Ich erwähne nur, daß wir selbst zwar eine gewisse Neugier, aber keineswegs ein stürmisches Aufsehen erregten. Die Seleno-Fernphotographie hatte längst vorgearbeitet, und nahe am Kai erblickten wir im Aushang eines Ladens die Bilder der Atalanta nebst den Hauptpersonen unserer Expedition mit Unterschriften in Landtypen und Antiqualettern. Ein Beamter der in sanften Terrassen ansteigenden Hafenstadt erwartete uns am Peer und stellte sich uns zur Verfügung. Er eröffnete uns in einer Art von Pidgin-Englisch, in der das Malayische überwog, daß die Gasthöfe der Stadt infolge einer großen Landesfestlichkeit überfüllt wären. Uns sei indes im Privathause eines Bürgers ausreichendes Quartier bereitgestellt. Es wurde, wie übrigens fast durchweg auf dieser Reise, vorausgesetzt, daß die Schiffsmannschaft an Bord verbliebe. Natürlich sorgten wir für ausreichenden Tagesurlaub, damit die Leute ihren Anteil an den Sehenswürdigkeiten und sonstigen Genüssen der neuen Länder schichtweise genießen konnten.
Was sich uns hier schon am ersten Tage entschleierte, war die Tatsache, daß die Insel Balëuto und ihre gleichnamige Hauptstadt ein Staatswesen nach Platonischem Muster darstellte; genauer gesagt, die Verkörperung des Modells, das Plato vornehmlich in seinem Werk »Politeia« als das Ideal des Staates hingestellt hat. Seit undenklichen Zeiten hatte unter den Intellektuellen der Insel das gedankliche Leitmotiv durchgegriffen: Die Europäer feiern Plato als einen der sublimsten Denker aller Zeiten; sie huldigen seiner Ideenlehre und haben ihm selbst den Ehrentitel »der Göttliche« verliehen; dieser nämliche göttliche Plato hat ihnen in zehn Büchern das auf Gerechtigkeit gegründete Muster eines Staates aufgebaut; aber bis zum heutigen Tage ist es noch keinem Leiter und keiner Gemeinschaft eingefallen, dieses Muster zu erproben und zu verwirklichen. Nicht in Alt-Hellas, nicht in Neu-Griechenland, nicht in irgend einem der Länder, in denen sich der zum Christentum hinüberleitende Neuplatonismus durchgesetzt hat. Hier klafft ein ungeheurer welthistorischer Widerspruch, und auf diesen zu allermeist wird es zurückzuführen sein, daß sich so viel Not und Elend über die alten Länder ergossen hat. Sie hatten das Rezept zum Idealstaat und verleugneten es in der Praxis. In der Beseitigung dieses Widerspruchs liegt die Mission der Balëuto-Menschen. Sie sollen und wollen Platoniker sein, nicht nur in der Idee, nicht nur in philosophischen Abstraktionen nach dem Vorbild europäischer Dozenten und Studiosen, sondern in Wirklichkeit: als überzeugte und werktätige Mitglieder des Platonischen Staates. So lautet das reine Grundmotiv, das zwar im Zeitenlauf gewissen Wandlungen ausgesetzt war – denn wo gäbe es ein System, dessen Schema unverbrüchlich gälte? – das sich aber in großen Zügen auf der Insel richtunggebend erhalten hat.
* * *
Die uns angewiesenen Wohnräume lagen im zweiten Stockwerk eines villenartigen, von hübschen Gartenanlagen umgebenen Privathauses, das einem Großdrogenhändler Namens Yelluon gehörte. Er empfing uns am Eingang, leitete uns hinauf, ließ uns korrekter Weise eine kurze Weile allein und meldete sich dann zu einem formellen Besuche:
»Ich begrüße Sie, Herrschaften, nicht nur mit der leeren Höflichkeit, die man Gästen im Allgemeinen schuldet, sondern mit jenem Eudämonismus, der von der Schule Platons ausgehend vornehmlich durch dessen Zeitgenossen Aristipp aus Cyrene seine deutlichste Prägung erhalten hat. Dieser Eudämonismus, – man könnte ihn auch, wiewohl philologisch nicht ganz genau, als Hedonismus ansprechen, – also das Gefühl und die Lehre von der Glückseligkeit, ist in mir lebendig, wenn ich den Wunsch äußere, es möge Ihnen in diesem Staate und in meinem Hause wohlgefallen. Wir werden es an nichts fehlen lassen, um Sie zu befriedigen, und ich bin um so sicherer, daß uns dies gelingen wird, als Sie selbst nach dem ersten Eindruck zu schließen, durchaus befähigt erscheinen, die von uns gebotene Verwirklichung der platonischen Ideen voll zu würdigen. In diesem Sinne heiße ich Sie willkommen.«
Wir sahen uns einigermaßen verblüfft an, dann erlaubte ich mir, da die anderen schwiegen, das Wort zu nehmen.
»Empfangen Sie, Herr Yelluon, unseren Dank, zugleich mit dem Ausdruck der Bewunderung für die überraschend schöne Diktion, die Ihnen zu Gebote steht. Sie erweckt in uns die Empfindung, daß wir hier tatsächlich in ein Land erhöhter Bildung gekommen sind. Die Platonischen Begriffe, die hier nach Ihren Andeutungen eine so große Rolle spielen, sind uns nicht ganz fremd, und wir freuen uns im Voraus auf die Erscheinungsformen der »Kalokagathia«, denen wir hier begegnen werden, das Wort im weitesten Sinne genommen, nach seinen Grundbestandteilen »Kalos«, schön, »agathos«, gut, also eine Einheit von Schönheit, Wahrheit und sittlicher Trefflichkeit. Hiervon abgesehen liegt uns aber auch daran, mit Ihnen als unserem Hauswirt einige sachliche Dinge zu erörtern, die uns Fremdlinge nach einer so langen Reise notwendig beschäftigen müssen.«
»Diese Notwendigkeiten sollen sofort erledigt werden,« entgegnete der Wirt. »Ich habe deshalb gleich die sieben Meldezettel mitgebracht, und bitte Sie um vorschriftsmäßige Ausfüllung.«
Wir begannen zu schreiben, gerieten indes alsbald an eine Schwierigkeit. »Sagen Sie, bitte, wie ist das zu verstehen? Auf diesen Meldezetteln befindet sich neben Geburtsort, Stand und Staatsangehörigkeit auch eine fragende Rubrik: »Philosophie«?«
»Hier haben Sie einzutragen, Person für Person, welcher philosophischen Richtung Sie besonders huldigen, mit kurzer Angabe der erkenntnistheoretischen Gründe.«
Als wir zögerten, ergänzte Jener: »Diese Verordnung besteht hier schon lange und ist neuerdings durch unser Ministerium für philosophische Angelegenheiten in Erinnerung gebracht worden. Wir verfahren dabei durchaus nicht engherzig, da den privaten Neigungen des Einzelnen jeder Spielraum gewährt wird, denn wir setzen voraus, daß bei Jedem ein platonisches Grundbewußtsein vorhanden ist. Nichtsdestoweniger wünscht die Behörde möglichst informiert zu werden über die philosophische Partei, der jeder Staatsbürger und jeder Fremdling angehört.«
– Ich sollte meinen, das wäre Privatsache und ginge die Regierung eigentlich gar nichts an. »Sie sind im Irrtum, mein Herr, dies ist amtlich durchaus nicht belanglos. Meines Wissens werden auch bei Ihnen in Deutschland auf staatlichen Formularen ähnliche Fragen gestellt. Bei Ihnen verlangt man die Erklärung darüber, ob Katholik, Protestant, Jude oder Dissident, was uns wiederum im höchsten Grade gleichgültig erscheint, denn die Konfession ist allerdings Privatsache, nicht aber die Philosophie…«
– Mir ist der Zweck der Fragestellung immer noch dunkel.
»Lassen Sie sich das an Beispielen erklären. Gesetzt, wir fänden in unseren Statistiken, daß eine bestimmte Art von Vergehen oder Verbrechen mit besonderer Häufigkeit auf Personen entfällt, die sich etwa zu Spinoza bekennen, so würden wir auf theoretische Maßregeln zu sinnen haben, die dem Spinozismus entgegenwirken. Fänden wir wiederum, daß die pünktlichsten Steuerzahler unter den Anhängern des Cartesius angetroffen werden, so wäre uns das ein Wink in unseren Schulen und Akademien den Descartes zu bevorzugen. Sie dürfen nie aus den Augen verlieren, daß diese Insel durchaus nach dem Prinzip Platos eingerichtet ist, der ausdrücklich alle Staatsmacht den Philosophen zuweist und der kategorisch verlangt, daß das gesamte Getriebe des Gemeinwesens philosophisch reguliert wird.«
Wir füllten nunmehr die fragliche Rubrik aus. Herr Mac Lintock flüsterte mir zu, er wäre hier in Verlegenheit, da er sich zeitlebens noch nie um Philosophie gekümmert hätte. Ich gab ihm halblaut die Weisung, hinzuschreiben: »Pragmatismus nach William James«, denn diese neuamerikanische Denkform beruhe auf dem common sense, auf der praktischen Nützlichkeit, und stünde als philosophische Lehre sicherlich seiner eigenen kaufmännischen Praxis nahe. Seine Nichte bezeichnete sich auf dem Zettel kurzweg als Schopenhauerianerin; der Kapitän und Donath nannten sich Epikuräer; der Offizier und der Arzt bezeichneten irgendwelche andere berühmte Namen, und ich selbst schrieb kurzerhand, um uns auf alle Fälle gut Wetter zu machen »Plato«; obschon ich überzeugt war und bin, daß man sich überhaupt nicht einem einzelnen Philosophen verschreiben darf, da jeder nur eine Profillinie der Wahrheit darstellt, deren volles Gesicht erst in der Vereinigung aller Philosophien erkennbar wird.
Da es gerade Vesperzeit war, verfügten wir uns auf die Veranda zum Kaffeetisch, woselbst sich noch ein Schwager unseres Wirtes, Rektor einer Oberschule, angefunden hatte. Die Gattin des Herrn Yelluon ließ sich mit Unwohlsein entschuldigen. Sie lag zu Bett und fühlte sich so angegriffen, daß sie auf ihren sanften Kissen die gewohnten Dialoge des Plato nicht in der griechischen Urschrift, sondern nur in einer erleichternden Übersetzung zu lesen vermochte. Ich schalte ein, daß Balëuto einen Kaffee hervorbringt, gegen den die erlesensten Sorten unserer Kontinente nur als fade Substanzen zur Erzeugung von Spülichtwasser erschienen. Mir war dieser Umstand nicht ganz nebensächlich, denn zu gewissen Tagesstunden neige ich mehr zu einem exquisiten Jausegetränk in Begleitung einer duftigen Zigarette, als zu allen Offenbarungen der Eleaten und der Alexandrinischen Schule. Mit dem Rauchwerk freilich hatten wir nun wieder das Übergewicht. Denn die Insel war arm an Tabak, und auf der Atalanta steckten unerschöpfliche Vorräte Habaneser und Ägyptischer Herkunft. Ich erwähne dies, um einfließen zu lassen, daß wir schon auf Grund dieser Ladung ein vorzügliches Tausch- und Verkehrsmittel in der Hand hatten; obendrein wurde auch der Dollar späterhin als Zahlung angenommen, allerdings zu einem Valutakurs, bei dem sich selbst auf dem Haupte eines Dollarkönigs wie Mac Lintock die Haare sträuben konnten.
Eine lebhafte Unterhaltung kam in Gang, und der Rektor erzählte uns Wissenswertes aus seiner Schulpraxis. Es wäre zurzeit sehr schwierig, die Aufmerksamkeit der Schüler zusammenzuhalten, da diese mit ihren Erwartungen sich bereits in die bevorstehenden großen Festlichkeiten eingesponnen hätten.
»Ja, wir haben von dem Fest schon gehört, als wir landeten; was hat es damit für eine Bewandtnis?«
»Es ist das Hundertjahrjubiläum unserer Platonischen Akademie, aus der alle unsere Regenten und Minister hervorgegangen sind. Damals, bei der Stiftung, wurde auf unsere Stadt der Titel »Über-Athen« geprägt, und diese Bezeichnung ist ihr bis zur Stunde erhalten geblieben. Stünden Perikles und Phidias heut auf und wandelten sie unter uns, so müßten sie bekennen, daß ihr Alt-Athen, einst die Quelle aller Kultur, mit dem unsrigen verglichen das reine Banausendorf gewesen ist. Wie gut haben Sie es getroffen, daß Sie beim ersten Einblick in unseren Archipelagus ein solches Fest erleben! Sie werden natürlich an dem Aktus in der Aula teilnehmen und vom Balkon der Akademie aus den großen Festzug bewundern, bei dem auch die Fröhlichkeit zu ihrem Recht gelangen soll… Ja, wie gesagt, auch unsere Schüler sind bei den Proben beschäftigt und mit solcher Leidenschaft dabei, daß ich einen Teil der lateinischen und griechischen Unterrichtsstunden ausfallen lassen mußte.« »Eine Zwischenfrage, Herr Rektor,« warf Eva ein, »was betreiben Sie eigentlich sonst in diesen Lektionen? Lesen Sie mit ihren Schülern auch die Klassiker?«
»Selbstverständlich. Ich traktiere besonders den Horaz und den Homer.«
»Verzeihung, das ist mir nicht ganz verständlich. Ich empfinde hier einen Widerspruch: denn nach Plato dürfen Sie das gar nicht. Plato hat meines Wissens für seinen Idealstaat die Verbannung aller Dichter ausdrücklich verordnet!«
»Wie Sie Bescheid wissen, mein Fräulein! Ja, so steht es allerdings in Platons Staatsbuch. Und ich kann nicht verhehlen, daß uns dieser Befehl viele Jahrzehnte lang die peinlichste Beklemmung auferlegt hat. Es möge dahingestellt bleiben, ob der göttliche Plato seine Bestimmung ganz wörtlich verstanden wissen wollte …«
»O nein, Herr Rektor,« sagte ich, »darüber ist gar kein Zweifel erlaubt. Ich habe erst gestern auf unserem Schiff, das eine stattliche Bibliothek mitführt, in Platos grundlegendem Werk geblättert und entsinne mich der Stellen ganz genau. Plato, vertreten durch seinen Sprecher Sokrates, polemisiert auf das heftigste gegen alle bloß der Eitelkeit und der Wollust dienenden Personen, Künste und Lebensarten, die eine verdammenswerte Üppigkeit befördern und deshalb in seinem Idealstaat nicht geduldet werden dürfen. Scharf eifert er gegen die Maler und Bildner, gegen die Tonkünstler und ganz besonders gegen die Poeten, mit ihren Dienern, den Schauspielern, Rhapsoden und Tänzern, welche in einem gesunden Gemeinwesen nichts zu schaffen hätten. Diese Schädlinge stellt er auf eine Stufe mit den verderblichen Gilden der Putzmacherinnen, Haarkräuslerinnen, Bartscherer, Garköche und Schweinehirten…«
»Daraus ersehen Sie schon,« unterbrach der Rektor, »daß Plato nicht unerbittlich auf seinem Schein steht, denn er selbst, der Mann der Symposien, ließ sich ja wohlschmecken, was aus dem Gehege der Schweinehirten entstammte und durch athenische Garköche lecker zubereitet wurde.«
– Mit Verlaub, Herr Rektor: Sie kopieren auf Ihrer vortrefflichen Insel nicht Alt-Athen in concreto, sondern Sie wollen das Wunder leisten, ein Ideal-Athen aus der Abstraktion in die Wirklichkeit zu heben. Und da können Sie doch an den klaren Anweisungen Platos gar nicht vorbei: Kein Erbarmen mit den Dichtern! so lehrt er. Homer und Hesiod müssen vertilgt werden! Ihre Gesänge sind nicht, wie man vordem glaubte, als heilige, von den Musen erflossene Eingebungen anzusehen, sondern als mit rohen, pöbelhaften Begriffen und Gesinnungen durchsetzte, abgeschmackte Märchen, in denen die höchst unsittlichen Reden und Taten der Götter eine entsetzliche Moralfäulnis ausstrahlen. Und daraus folgt, streng nach Plato: Fort mit Homer und Hesiod, fort überhaupt mit aller Poesie und sämtlichen verdammten Künsten!
Der Schulmann entgegnete: »Wir beugen uns selbstverständlich der Autorität unseres erhabenen Meisters – soweit es eben möglich ist. Allein wir gelangen an den Punkt, wo die Unmöglichkeit beginnt. Denn um Plato und die übrigen großen Philosophen zu verstehen, bedürfen wir des Griechisch-Lateinischen, und dieses Studium würde blöde und stümperhaft ausfallen, ohne die klassischen Dichter. Wir lesen sie deshalb aus sprachlichen, das heißt grammatischen Gründen. Wir erziehen unsere Jünglinge und Mädchen zur Verachtung dieser Klassizitäten, aber wir lesen sie mit ihnen aus gymnasialen Gründen. Ich will Ihnen eine Probe dieser Methode mitteilen. Vor einigen Tagen begann ich mit den Zöglingen die Ode des Horaz
Exegi monumentum aere perennius…
(Dauerhafter als Erz schuf ich mein Ehrenmal);
ich nahm die Gelegenheit wahr, um generell meinen Abscheu vor Horaz und seiner skandierenden Gilde auszusprechen, und wandte mich dem ersten Worte zu: »Exegi«; ich erläuterte ausführlich die Herkunft des Ausdrucks aus ex und einer griechischen Wurzel ago, betrachtete dann die Präsensform exigo mit dem kurzen i, das sich im Praeteritum exegi mit elastischer Phonetik zu einem langvokalisierten e verzaubert, und erörterte dann ausführlich alle Autoren, die außer Horaz das nämliche Verbum in zahlreichen Abstufungen der Bedeutung angewandt haben; so Cicero, Livius und Varro, welche mit exigo den Begriff des Hinausjagens verbinden, während es bei Ovid als Inschwungsetzen, und bei Terenz als Durchfallen im Bühnensinne auftritt. Das exigo bei Quintilian und Tacitus bedarf noch einer besonderen Analogie, allein ich hoffe, daß ich in einer der nächsten Lektionen bis zum zweiten Wort der Horazischen Ode vordringen werde, also bis zu »Monumentum«, dessen grammatische Verwandtschaft mit moneo, als dem Factitivum von memini, auf den Stamm mens, mentis und damit auf die Grundwurzel aller Geistigkeit überhaupt hinleitet, insofern – — —« »Genug!« rief Donath; »es soll uns als erwiesen gelten, daß Sie Ihr Programm, die Jungen mit Haß und Abscheu gegen klassische Verse zu sättigen, vollkommen erfüllen, zweifellos gründlicher und gediegener als irgend ein Magister meiner deutschen Heimat. Aber wir dürfen unseren Hauptzweck nicht aus den Augen verlieren, ich schlage deshalb einen Spaziergang vor zu einer ersten Orientierung in Ihrer platonischen Stadt, die uns neben ihrem antipoetischen Grundzug hoffentlich recht viel Schönes und Erbauliches bieten wird.«
Wir erhoben uns, von Erwartung geschwellt, und begaben uns auf die Wanderung. Vor uns lag das vorausgeahnte polynesische Neuland, in erster Probe als ein Staat, der ausschließlich von Philosophen regiert wird. Also sicher ein starker Kontrast zu allem Erlebten. Ich entsann mich, daß in unseren heimischen Ländern der körperliche Schwerarbeiter höher rangiert als der Denker, und daß bei uns nur derjenige die Anwartschaft auf staatliche Macht gewinnt, der von Philosophie keine Ahnung hat.
Das erste, was uns auffiel, war die Menge schlechtgepflegter Kinder, die sich in den Straßen tummelten, und ich gab der Verwunderung Ausdruck, daß sich deren Eltern anscheinend so wenig um sie kümmerten. Yelluon erläuterte, der Begriff »Eltern« passe eigentlich nicht recht hierher, denn es herrsche ja in den meisten Schichten des philosophischen Staates Weiber- und Kindergemeinschaft, und infolgedessen eine Komplexität der sexuellen Verhältnisse, bei der von einer Elternschaft im gewöhnlichen Sinne gar nicht mehr die Rede sein könne. Ganz recht! hier lag ja ein Hauptpunkt der platonischen Verordnungen vor, und wenn irgendwo, so hatte sich hier die Philosophie des Musterstaates zu betätigen. Es kommt wesentlich auf die Menge der erzeugten Kinder an, nicht aber darauf, daß das einzelne Kind seine Herkunft von einem bestimmten Papa und einer bestimmten Mama herleitet. Denn auch der Mutterbegriff verflüchtigt sich in einer Gemeinschaft, in der die Mutterpflicht und die Mutterliebe vom philosophischen Standpunkt als unwesentlich, ja als störend erkannt worden sind.