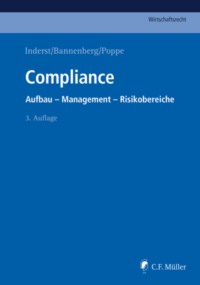Kitabı oku: «Compliance», sayfa 4
Literaturverzeichnis
Achenbach/Ransiek Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2015
Assmann/Pötzsch/Schneider Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, 2. Aufl. 2013
Assmann/Schneider Wertpapierhandelsgesetz, 6. Aufl. 2012
Bähr Handbuch des Versicherungsaufsichtsrechts, 2011
Baumbach/Hopt Handelsgesetzbuch, 37. Aufl. 2016
Baumbach/Hueck GmbH-Gesetz, 21. Aufl. 2017
Bechtold Kartellgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 8. Aufl. 2015
Beck/Samm/Kokemoor Kreditwesengesetz mit CRR, Loseblatt
Beckmann/Scholtz/Vollmer Investment, Ergänzbares Handbuch für das gesamte Investmentwesen, Loseblatt
Beisel Beck’sches Mandatshandbuch Due Diligence, 2. Aufl. 2010
Blümich EStG, KStG, GewStG, Loseblatt
Bohne/Steffen Die Rückgewinnungshilfe im Strafverfahren, 2009
Bohnert Kommentar zum Ordnungswidrigkeitenrecht, 4. Aufl. 2016
Boos/Fischer/Schulte-Mattler Kreditwesengesetz, 5. Aufl. 2016
Brinkmann/Schäfer Compliance-Konsequenzen aus der MiFID, 2008
Büchner/Kokert/Schmalzl Erfolgreiche Auslagerung von Geschäftsprozessen, 2008
Buff Compliance: Führungskontrolle durch den Verwaltungsrat, 2000
Bürgers/Körber Aktiengesetz, 4. Aufl. 2016
Bürkle Compliance in Versicherungsunternehmen, 2. Aufl. 2015
Bussmann Nationales Recht und Anti-Fraud Management – US-amerikanische und deutsche Unternehmen im Vergleich, 2008
Czychowski/Reinhardt Wasserhaushaltsgesetz unter Berücksichtigung der Landeswassergesetze, 11. Aufl. 2014
Dölling Handbuch der Korruptionsprävention für Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Verwaltung, 2007
Dölling/Duttge/Rössner Gesamtes Strafrecht: StGB, StPO, Nebengesetze, 3. Aufl. 2013
Dörner/Horváth/Kagermann Praxis des Risikomanagements, 2000
Erbs/Kohlhaas Strafrechtliche Nebengesetze, Loseblatt
Fahr/Kaulbach/Bähr Versicherungsaufsichtsgesetz, 5. Aufl. 2012
Feldhaus Bundesimmissionsschutzrecht, Loseblatt
Fezer Kommentar zum Markenrecht, 4. Aufl. 2009
Fischer F. Der Betriebsbeauftragte im Umweltschutzrecht, 1996
Fischer T. Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 63. Aufl. 2016
Fleischer Handbuch des Vorstandsrechts, 2006
Fleischer/Goette Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), 2. Aufl. 2016
Frenz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, 3. Aufl. 2002
Fromm/Nordemann Urheberrecht, 11. Aufl. 2014
Fuchs Kommentar zum Wertpapierhandelsgesetz, 2009
Geiß/Doll Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, 2005
Gleißner/Romeike Risikomanagement – Umsetzung, Werkzeuge, Risikobewertung, 2005
Göhler/König Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 17. Aufl. 2017
Gola/Schomerus BDSG Bundesdatenschutzgesetz, 12. Aufl. 2015
Göppinger/Bock Kriminologie, 6. Aufl. 2008
Goette/Habersack Münchner Kommentar zum Aktiengesetz, 4. Aufl. 2014 ff.
Gründer/Schrey Managementhandbuch IT-Sicherheit, 2007
Habersack/Mülbert/Schlitt Handbuch der Kapitalmarktrechtinformation, 2. Aufl. 2013
Hachenburg/Mertens GmbH-Gesetz, 8. Aufl. 1992
Halm/Engelbrecht/Krahe Handbuch des Fachanwalts Versicherungsrecht, 4. Aufl. 2011
Hannemann/Schneider/Hanenberg Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), 5. Aufl. 2017
Hauschka/Moosmayer/Lösler Corporate Compliance, 3. Aufl. 2016
Heckschen/Simon Umwandlungsrecht, 2003
Hempel/Wiemken Managerhaftung im Wandel, 2006
Hirte/Bülow Kölner Kommentar zum WpÜG, 2. Aufl. 2010
Hoffmann-Becking Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 4, Aktiengesellschaft, 4. Aufl. 2015
Hölters Handbuch des Unternehmens- und Beteiligungskaufs, 6. Aufl. 2005
Holzborn WpPG – Wertpapierprospektgesetz, 2. Aufl. 2014
Holznagel Recht der IT-Sicherheit, 2003
Hopt/Wiedemann Großkommentar Aktiengesetz, 5. Aufl. 2015
Horak Outsourcing bei Versicherungsunternehmen, 2011
Hoeren/Sieber Handbuch Multimedia-Recht, Loseblatt
Hüffer/Koch Aktiengesetz, 12. Aufl. 2016
Immenga/Mestmäcker Wettbewerbsrecht, 5. Aufl. 2012
Jarass Bundesimmissionsschutzgesetz, 11. Aufl. 2015
Jarass/Petersen/Weidemann Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Loseblatt
Joecks/Miebach/Hefendehl/Hohmann Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 4, §§ 185-262, 3. Aufl. 2017
Kallmeyer Umwandlungsgesetz, 5. Aufl. 2013
Kaplan/Norton Alignment, 2006
Kaplan/Norton/Horvath Balanced Scorecard, 1997
Kempf/Schilling Vermögensabschöpfung, 2007
Kindhäuser/Neumann/Paeffgen Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 2017
Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis Internal Investigations, Ermittlungen im Unternehmen, 2. Aufl. 2016
Koepsel Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), 2006
Kremer/Bachmann/Lutter/von Werder Deutscher Corporate Governance Kodex, 6. Aufl. 2016
Küstner/Thume Handbuch des gesamten Vertriebsrecht,Band 2, 9. Aufl. 2014, Band 3, 4. Aufl. 2014
Landmann/Rohmer Umweltrecht, Loseblatt
Langen/Bunte Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, Band 1, Deutsches Kartellrecht, 12. Aufl. 2014
Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann Großkommentar, Band 13, 12. Aufl. 2009
Ledergerber Whistleblowing unter dem Aspekt der Korruptionsbekämpfung, 2005
Leisinger/Probst Human Security and Business, 2012
Lippross Umsatzsteuer, 24. Aufl. 2017
Lutter Umwandlungsgesetz, 5. Aufl. 2014
Marx Deutsches und europäisches Markenrecht, 2. Aufl. 2007
Mengel Compliance und Arbeitsrecht, 2009
Mes Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz: PatG/GebrMG, 4. Aufl. 2015
Meyer-Goßner Strafprozessordnung, 60. Aufl. 2017
Michalski/Heidinger/Leible/Schmidt Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 3. Aufl. 2017
Mitsch Recht der Ordnungswidrigkeiten, 2. Aufl. 2005
Moosmayer Compliance, Praxisleitfaden für Unternehmen, 3. Aufl. 2015
Moritz Das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, 2004
Müller 100 Jahre materielle Versicherungsaufsicht in Deutschland, Band 1, 2001
Müller-Gugenberger/Bieneck Handbuch des Wirtschaftsstraf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, 6. Aufl. 2015
Niemann/Sradj/Wohlgemuth Jahres- und Konzernabschluss nach Handels- und Steuerrecht, 2008
Pieth Anti-Korruptions-Compliance, 2011
Prölss Versicherungsaufsichtsgesetz, 12. Aufl. 2005
Raiser/Veil Recht der Kapitalgesellschaften, 6. Aufl. 2015
Rebel Gewerbliche Schutzrechte, 7. Aufl. 2017
Rohde-Liebenau Whistleblowing – Beitrag der Mitarbeiter zur Risikokommunikation, 2005
Romeike Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements, 2008
ders. Die Bankenkrise – Ursachen und Folgen im Risikomanagement, 2010
Rosenthal/Jöhri Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017
Roth Compliance: Begriff, Bedeutung, Beispiele, 2000
Roth/Altmeppen Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 8. Aufl. 2015
Ruhmannseder/Lehner/Beukelmann Compliance aktuell, Loseblatt
Säcker/Rebmann Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 7. Aufl.
Schemmel/Ruhmannseder/Witzigmann Hinweisgebersysteme, Implementierung in Unternehmen, 2012
Schimansky/Bunte/Lwowski Bankrechts-Handbuch, 5. Aufl. 2017
Schmitt/Hörtnagl/Stratz Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 7. Aufl. 2016
Scholz GmbH-Gesetz, 11. Aufl. 2015
Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, 29. Aufl. 2014
Semler/Peltzer/Kubis Arbeitshandbuch für Vorstandsmitglieder, 2. Aufl. 2015
Semler/Stengel Umwandlungsgesetz mit Spruchverfahrensgesetz, 4. Aufl. 2017
Senge Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 4. Aufl. 2014
Sölch/Ringleb Umsatzsteuergesetz: UStG, Loseblatt
Stelkens/Bonk/Sachs Verwaltungsverfahrensgesetz, 8. Aufl. 2014
Theisen Information und Berichterstattung des Aufsichtsrats, 4. Aufl. 2007
Tiedemann Wirtschaftsstrafrecht, Einführung und Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2014
Tipke/Kruse Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Loseblatt
Tipke/Lang Steuerrecht, 22. Aufl. 2015
Umnuß Corporate Compliance Checklisten, 3. Aufl. 2017
Wabnitz/Janovsky Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 4. Aufl. 2014
Wecker/van Laak Compliance in der Unternehmenspraxis, 2. Aufl. 2009
Widmann/Mayer Umwandlungsrecht – Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, Loseblatt
Wiedemann Handbuch des Kartellrechts, 3. Aufl. 2016
Wieland/Steinmeyer/Grüninger Handbuch Compliance-Management, 2. Aufl. 2014
Wilrich Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, 2004
Winter Versicherungsaufsichtsrecht, 2007
Wissmann Telekommunikationsrecht, 2. Aufl. 2006
Wissmann/Dreyer/Witting Kartell- und regulierungsbehördliche Ermittlungen im Unternehmen und Risikomanagement, 2008
Wöhe Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 26. Aufl. 2016
Zöllner Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Aufl. 2009 ff.
1. Kapitel Begriffsbestimmungen Compliance:
Bedeutung und Notwendigkeit
Inhaltsverzeichnis
I. Einführung
II. Ausgangslage und Historie
III. Haftungsrisiken von Unternehmen und Management
IV. Gesetzliche Grundlagen und unternehmerische Pflichten
V. Bedeutung einer Compliance-Organisation
VI. Compliance-Funktionen
1. Kapitel Begriffsbestimmungen Compliance: Bedeutung und Notwendigkeit › I. Einführung
I. Einführung
1
Der Begriff „Compliance“ stammt aus der angloamerikanischen Rechtssprache und wird seit einigen Jahren selbstverständlich in der hiesigen Terminologie benutzt. Die Übersetzung „Handeln in Übereinstimmung mit bestimmten bestehenden Regeln“ vermittelte möglicherweise zunächst den Eindruck, es handele sich um nicht mehr als die neudeutsche Bezeichnung altbekannter Selbstverständlichkeiten. Dass dies nicht zutrifft und unter Compliance etwas anderes und weit mehr zu verstehen ist, hat sich inzwischen herumgesprochen. Die Komplexität zeigt sich schon an den vielen verschiedenen Definitionen, die sich herausgebildet haben, seit der Begriff erstmals in der deutschen Rechtssprache aufgetaucht ist.
2
Sehr allgemein definiert bedeutet Compliance etwa die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischen Standards und die Erfüllung weiterer wesentlicher Anforderungen.[1] Außerdem wird Compliance auch als Haftungsvermeidung durch das Befolgen der für das Unternehmen maßgeblichen Rechtsregeln aller Art definiert.[2] Zum Teil wird Compliance auch als Organisationsmodell mit Prozessen und Systemen verstanden, das die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, internen Standards und wesentlicher Ansprüche von Stakeholdern sicherstellt.[3]
3
Die Komplexität zeigt sich daneben auch an der Frage, welchem Fachgebiet die Compliance zuzuordnen ist. Die Einhaltung von Regeln und Gesetzen sowie die Vermeidung der Haftung von Unternehmensverantwortlichen als wesentlicher Bestandteil der Compliance lässt eine Zuordnung zur Rechtswissenschaft logisch erscheinen. Die Implementierung von Prüfungs-, Kontroll- und Freigabemechanismen, die ebenfalls zur Compliance gehört, passt dagegen wiederum in die Betriebswirtschaft. Möglicherweise gehört Compliance sogar in den Bereich der Wirtschaftsethik, wenn es letztlich um die Frage gehen soll, wie und ob ein auf Gewinn ausgelegtes Unternehmen verantwortungsvoll und nachhaltig arbeiten kann.[4]
4
Bemerkenswert ist letztlich auch die kontroverse Diskussion, die Compliance ausgelöst hat. Wie kaum ein anderes Thema scheint Compliance zu polarisieren. Während sie einerseits als unverzichtbar gesehen wird, halten andere sie für das größte Hindernis unternehmerischen Handelns.
5
Davon leitet sich auch die interessante, zugleich aber nach wie vor nicht zu beantwortende Frage ab: Wie wird Compliance in der Praxis und im Unternehmensalltag tatsächlich verstanden?
6
Besucht man die Internetseiten großer Unternehmen, stellt man fest, dass kaum eine Homepage mehr ohne eine „Compliance-Rubrik“ auskommt. Dabei besteht Einigkeit im Hinblick auf das Begriffsverständnis und den erklärten Stellenwert.
7
Die Deutsche Telekom beschreibt beispielsweise auf ihrer Homepage Compliance als Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, unternehmensinterner Richtlinien und ethischer Grundsätze.[5]
8
Auf der Homepage von Siemens wird Compliance als die Einhaltung der jeweils gültigen Gesetze und der unternehmensinternen Grundsätze und Regeln beschrieben. Siemens begreift Compliance erklärtermaßen als elementaren Bestandteil seiner Integrität und damit als Grundlage von nachhaltigem, profitablem Wachstum.[6]
9
Der DB-Konzern versteht unter Compliance das Gewährleisten der Einhaltung von einschlägigen Gesetzen und internen Richtlinien, die für eine Geschäftsführung und – durchführung notwendig sind. Dazu gehören z.B. Antikorruptions-Gesetze mit internationaler Reichweite wie das Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung (IntBestG), relevante EU-Richtlinien oder der US-amerikanische Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Interne Regelwerke und organisatorische Maßnahmen sollen sicherstellen, dass sich alle Mitarbeiter des DB Konzerns an rechtliche Anforderungen halten, Korruption wird engagiert bekämpft.[7]
10
Nahezu alle Unternehmen – die oben Benannten sollen nur repräsentative Beispiele bilden – erklären Compliance zum integralen Bestandteil der Unternehmensführung.
11
Betrachtet man all die Homepages und Stellungnahmen zum Thema „Compliance“, so fragt man sich, woher die kritischen Stimmen aus der Wirtschaft, die Compliance als Hindernis verstehen, kommen. Handelt es sich hier nur um vereinzelte Kritiker, die in ihren Unternehmen eine Ausnahme bilden und überhört werden? Oder sind die Kritiker doch die wenigen, die aussprechen, was alle die denken, die entgegen ihrer Überzeugung Compliance-Systeme implementieren? Diese Frage kann und soll hier nicht geklärt werden. Vielmehr soll – den Kritikern zum Trotz – aufgezeigt werden, dass und warum ein Unternehmen ohne Compliance nicht mehr auskommt.
Anmerkungen
[1]
Menzies Sarbanes-Oxley und Corporate Compliance, 2006, S. 2; Hauschka § 1 Rn. 2.
[2]
Theisen S. 87.
[3]
Vgl. PriceWaterhouseCoopers pwc 2005, S. 8.
[4]
Moosmayer NJW 2012, 3013.
[5]
Abrufbar unter www.telekom.com/compliance.
[6]
Abrufbar unter www.siemens.com/global/de/home/unternehmen/nachhaltigkeit/compliance.html.
[7]
Abrufbar unter www.deutschebahn.com/de/konzern/compliance/ueberblick.html.
1. Kapitel Begriffsbestimmungen Compliance: Bedeutung und Notwendigkeit › II. Ausgangslage und Historie
II. Ausgangslage und Historie
12
Selbstverständlich besteht kein Zweifel daran, dass sich jedes Unternehmen grundsätzlich rechtskonform zu verhalten hat. Es ist weder neu noch besonders, wenn es das Ziel eines Unternehmens sein muss, nicht gegen bestehende Gesetze und Regularien zu verstoßen. Daneben ist selbstverständlich, dass jeder Unternehmer in rechtlicher Hinsicht Risiken ausgesetzt ist, die er mittels seiner Organisation minimieren muss.
13
Gleichwohl muss jedes Unternehmen im Lichte der Diskussion um Compliance seine bisherige Organisation unter Gesichtspunkten der Risikoüberwachung neu überdenken. Das heißt gerade nicht, dass alle Unternehmen in der Vergangenheit überhaupt keine Maßnahmen zur Kontrolle von Risiken getroffen haben. Ebenso wenig haben Unternehmen in der Vergangenheit unentwegt und ungestraft gegen Gesetze verstoßen.
14
Dennoch kam es mittlerweile zu der Erkenntnis, dass die bestehenden Prozesse in Unternehmen weder ausreichend noch geeignet waren, um Risiken effektiv zu kontrollieren.
15
Diese Erkenntnis wurde durch ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren bzw. Entwicklungen ausgelöst.
16
Eine entscheidende Rolle spielten zunächst die großen Wirtschaftsstrafverfahren, Sicherheitspannen und Zusammenbrüche von Unternehmen der jüngsten Vergangenheit. Nachdem sich derartige Fälle zunächst in den USA ereigneten,[1] zeigte sich bald auch in Deutschland anhand von prominenten Insolvenzfällen oder großen Haftungsfällen, wie dramatisch sich strafbares Verhalten Einzelner in Führungspositionen auf den Bestand und die Entwicklung eines Unternehmens auswirken kann.
17
Im Zusammenhang mit den Vorfällen ist klar geworden, dass sich mangelhafte Kontrolle naturgemäß erst dann zeigt, wenn es zu spät ist. Diese unangenehme Erfahrung mussten auch in Deutschland einige Unternehmen machen.
18
Die „Wirtschaftsskandale“ stellten die bestehenden Reglementierungen auf den Prüfstand und lösten die Frage aus, ob die bestehenden gesetzlichen Anforderungen an die Kontrolle in Unternehmen unzulänglich sind bzw. ob die Verfehlungen hätten vermieden werden können.
19
Dabei zeigte sich die Notwendigkeit, die Normen zu verschärfen und die Toleranz gegenüber fehlender Kontrolle und Verantwortung der Unternehmensführung erheblich zu verringern. Ergebnis ist die sukzessive Entwicklung von verschärften Reglementierungen und Kodifizierungen, die zunächst in den USA begann und nunmehr nach und nach auch Einzug in das deutsche und europäische Rechtssystem gehalten hat.
20
Nicht nur auf Seiten der Gesetzgebung und Rechtsprechung kam es zu Veränderungen. Die prominenten Negativereignisse in der Wirtschaftswelt haben auch bei Gläubigern bzw. Geschädigten zu einer neuen Sensibilität und einem veränderten Bewusstsein geführt. Bildeten früher große Haftungsprozesse eher die Ausnahme, so hat heute nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Möglichkeit der Anspruchsverfolgung gegenüber dem Management großer Unternehmen zugenommen. Dies zeigen die prominenten Fälle einiger der bekanntesten deutschen Manager, die sich in Haftungsprozessen in Millionenhöhe in Anspruch nehmen lassen mussten. Die Ursachen dafür sind vielseitig. Hauschka führt die verschärfte Situation bspw. auf eine verbesserte Informationsgewinnung vor allem durch das Internet, spezialisierte Anwaltskanzleien, anwaltliche Sammelklagevertreter, erfolgsbeteiligte Prozesskostenversicherer oder zunehmendes Shareholder-Value-Bewusstsein zurück.[2]
Anmerkungen
[1]
Bspw. ENRON (Energie), WorldCom (Telekommunikation), Tyco (Mischkonzern) haben durch ihre Skandale nicht nur in den USA eine Vertrauenskrise ausgelöst.
[2]
Hauschka NJW 2004, 257, 258.
1. Kapitel Begriffsbestimmungen Compliance: Bedeutung und Notwendigkeit › III. Haftungsrisiken von Unternehmen und Management
III. Haftungsrisiken von Unternehmen und Management
1. Kapitel Begriffsbestimmungen Compliance: Bedeutung und Notwendigkeit › III. Haftungsrisiken von Unternehmen und Management › 1. BGH-Rechtsprechung zur Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern
1. BGH-Rechtsprechung zur Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern
21
Eine wegweisende Veränderung der Rechtsprechungspraxis in Fällen von Managementhaftung brachte die ARAG/Garmenbeck-Entscheidung des Bundesgerichtshofes,[1] der sich grundsätzlich für die Pflicht des Aufsichtsrates dazu ausspricht, Ansprüche der Gesellschaft gegen Vorstandsmitglieder ordnungsgemäß zu prüfen, geltend zu machen und durchzusetzen. Die Pflicht zur Prüfung solcher Ansprüche soll schon bei geringsten Anhaltspunkten, wie etwa dem Hinweis eines Aktionärs, bestehen. Verletzt der Aufsichtsrat diese Pflichten, so ist er selbst der Gesellschaft zum Schadensersatz verpflichtet. Diese Entscheidung führte dazu, dass das vielfach übliche Untätig bleiben des Aufsichtsrates aus Gefälligkeit oder Wohlwollen gegenüber den Vorstandsmitgliedern nicht länger folgenlos bleibt.