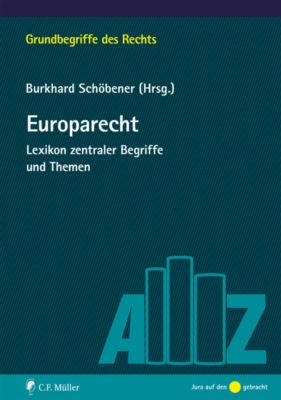Sayfa sayısı 1230 sayfa
0+

Kitap hakkında
Das Völkerrecht unterscheidet sich vom (inner-) staatlichen Recht nicht nur durch seine anders gearteten Akteure und Strukturen, auch die dieses Rechtsgebiet prägenden Begriffe weisen eine Vielzahl von Besonderheiten auf. Der vorliegende Band verfolgt vor allem den Zweck, das nötige Verständnis für dieses ebenso komplexe wie spannende Rechtsgebiet zu vermitteln.
Die Grundbegriffe des Völkerrechts ermöglichen dem Leser die planmäßige Erschließung des internationalen öffentlichen Rechts anhand der insgesamt 121 in alphabetischer Reihenfolge erläuterten zentralen Begriffe und Themen, die zudem durch Verweise miteinander verknüpft sind. Vorangestellt sind jeder Begriffserklärung eine Gliederung und eine bewusst knapp gehaltene Literaturübersicht, die sowohl das schnelle Auffinden bestimmter Informationen in den Erläuterungen als auch die gezielte Hinzuziehung ausgewählter Spezialliteratur erleichtern. Auf diese Weise werden die wesentlichen Inhalte des Völkerrechts für den Leser systematisch aufbereitet und an den wichtigsten Stellen vertiefend dargestellt.