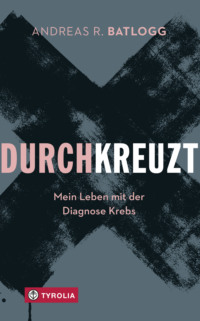Kitabı oku: «Durchkreuzt», sayfa 2
4.
Rom – das letzte Mal?
Den Flug nach Rom trat ich an. Auf das Treffen mit Kardinal Walter Kasper, den ich einige Wochen vorher in seinem Elternhaus im Allgäu getroffen hatte, wollte ich wegen des Papstbuches nicht verzichten. Auch mit Annette Schavan, der Botschafterin Deutschlands beim Heiligen Stuhl, hatte ich mich verabredet und war am 3. Oktober zum Empfang aus Anlass des Tags der deutschen Einheit eingeladen. Abgesehen von österreichischen und deutschen Mitbrüdern in Rom und den Kollegen von der »Civiltà Cattolica«, bei denen ich seit über zehn Jahren ein bis zwei Mal pro Jahr nächtigte – ein idealer Standort nahe der Spanischen Treppe, zehn Minuten Fußweg zur Gregoriana, der Päpstlichen Jesuitenuniversität.
Antonio Spadaro SJ, Direttore der renommierten Jesuitenzeitschrift, wird von Journalisten als enger Papst-Vertrauter angesehen. Er musste einen Tag nach meiner Ankunft zu einer Konferenz nach Washington fliegen. Aber wir haben uns noch kurz getroffen und ausgetauscht. Über meine Erkrankung hatte ich ihn vorab informiert. Seit unserem Gemeinschaftsprojekt, dem im August 2013 von Antonio mit den Fragen von dreizehn Kolleginnen und Kollegen geführten ersten ausführlichen Interview mit Papst Franziskus, das wir am 19. September zeitgleich in dreizehn Sprachen auf den Websites der europäischen Kulturzeitschriften des Ordens veröffentlicht hatten, standen wir in engem Kontakt2. Antonio ist ein absoluter Franziskus-Fan, Journalisten zählen ihn zu den »spin-doctors« des Papstes, wenn nicht zu seinen Ghostwritern. Aber darüber redet er nicht. Ich verstehe das. Erst seit kurzem gehört er bei Papstreisen zur offiziellen Entourage, mehrere Jahre war er fast auf jeder dabei, ohne offiziell als Journalist akkreditiert zu sein oder zum päpstlichen Gefolge zu gehören. In Italien ist er mittlerweile das Gesicht der Jesuiten – und sogar über den italienischen Stiefel hinaus.
Freundlich wurde ich empfangen, wie immer. Die ersten drei Tage verließ ich die Kommunität nur kurz, um mir die Füße zu vertreten. Im 16. Jahrhundert als kleines Landhaus der Familie Orsini auf dem Gebiet der antiken Horti Lucullani erbaut, immer wieder erweitert, 1827 vom bayerischen König Ludwig I. erworben, fünfzig Jahre später im Stil des romantischen Historismus umgebaut, haben die Jesuiten die Villa Malta nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft und zum Redaktionssitz gemacht.
Ich hatte im August die Einladung Antonios angenommen, einen Artikel über die Bundestagswahlen und die Regierungsbildung zu schreiben. In München war ich damit nicht fertig geworden. Ich schrieb eifrig an dem Beitrag über die damals zu erwartende Koalitionsregierung aus CDU/CSU, Grünen und FDP, die nach einigen Wochen Sondierungen leider überraschend platzte3.
Kurze Streifzüge über die Piazza di Spagna mussten vorerst genügen. Ich genoss die Herbstsonne. Aber immer begleitet von der Hintergrundfrage: Wie lange noch? Bin ich zum letzten Mal in Rom? Solche Fragen kommen hoch, automatisch. Man wird sie nicht los.
Seit Donnerstag war ich hier. Am Samstag kam Astrid aus Venedig angereist, um sich von mir fünf Tage durch die Stadt führen zu lassen. Die Studienleiterin an der Katholischen Akademie in Bayern war Mitarbeiterin der »Stimmen der Zeit« auf Honorarbasis. Als ich auf die Stazione Termini zusteuerte, überlegte ich, wann und wie ich ihr von meiner Untersuchung und dem Ergebnis berichten sollte: Warten bis zum Ende? Oder gleich damit herausrücken? Ich wusste, dass sie voller Erwartung auf die Ewige Stadt war und die verschiedenen Begegnungen, die wir anvisiert hatten. Weil ich noch etwas grübelte, bemerkte ich nicht, dass ihr Zug bereits eingetroffen war. Plötzlich stand sie vor mir. Ich bot an, zuerst an der Piazza della Repubblica einen Espresso zu trinken.
Nachdem ich mir ihre Eindrücke von der Biennale hatte schildern lassen, für die bei uns seit vielen Jahren regelmäßig Friedhelm Mennekes SJ berichtete4, sagte ich ihr, ich müsse ihr etwas Unerfreuliches mitteilen. »Leider hat die Darmspiegelung ergeben, dass ich einen bösartigen Tumor habe, ich muss, sobald ich aus Rom zurück bin, eine CT machen, um abzuklären, ob er bereits gestreut hat und ich Metastasen habe. Eine Operation steht mir bevor, vielleicht Chemotherapie. Nächste Woche muss ich aus der Redaktion vorzeitig ausscheiden.« Das saß! »Ich will dir nicht die Laune verderben, aber fünf Tage herummogeln, das kann ich nicht. Sorry.« Stille. Schon kleinste Pausen wirken in solchen Momenten wie eine Ewigkeit. Es kommt vor, dass auch Astrid zunächst sprachlos ist. Dann schob ich vorsichtig nach: »Machen wir das Beste draus und genießen jetzt Rom.«
Und das taten wir dann auch: schöne Spaziergänge und ein Streifzug durch den Park der Villa Borghese, Besuche bei Jesuiten. Die Dachterrassen der verschiedenen Jesuitenhäuser faszinierten sie sehr. Von der Gregoriana wie auch von der Villa Malta aus hat man den Komplex des Quirinalpalastes zum Greifen nahe. Auch das monströse Nationaldenkmal für Vittorio Emmanuele II., im Volksmund auch abschätzig macchina da scrivere (Schreibmaschine) oder wegen seines weißen Marmors torta nuziale (Hochzeitstorte) genannt, liegt einem zu Füßen.
Beim Empfang in der Botschaft, wo auch Andrea Riccardi, der Gründer der Laiengemeinschaft Sant’Egidio kurz vorbeischaute5, traf ich den Journalisten und Politologen Jürgen Erbacher vom ZDF. Sein Blog »Papstgeflüster« bietet oft ebenso wichtige wie originelle Hintergrundinformationen und Einschätzungen. Wir sprachen im Blick auf den fünften Jahrestag der Wahl im März 2018 kurz über unsere beiden entstehenden Papstbücher. Annette Schavan war, wie immer, eine charmante Gastgeberin – die Bildungspolitikerin und ehemalige Bundesministerin hat der Botschaft in Rom ein ganz neues inhaltliches Profil gegeben. Die Villa an der Via dei Tre Orologi ist zu einem Treffpunkt der intellektuellen Auseinandersetzung geworden, und oftmals hat Schavan hier Kardinäle oder Bischöfe zusammengeführt, die sich sonst wenig zu sagen haben.
Mein 55. Geburtstag tags darauf fing ganz speziell an: Um 8 Uhr morgens, als ich mir einen zweiten Espresso holen wollte, stand Astrid vor meiner Zimmertür. »Wie bist du denn ins Haus reingekommen?« »Weiblicher Charme! An der Rezeption saß eine Dame – die sah gleich: Es ist wichtig!« Eine Torte mit brennenden Kerzen hielt sie in der Hand, dazu ein kleines Geschenk. Welche Überraschung! Mittags durfte ich sie zum Pranzo mitbringen. Dabei wurde ich am Ende des Essens wieder mit drei Torten mit der Aufschrift »Auguri«, Schnaps und Cognac überrascht, was mich freute und gleichzeitig irritierte, weil ich ja nur Gast war und nicht zur Kommunität gehörte. Antonio hatte das von Washington aus organisiert. Abends gingen wir mit Paul, einem österreichischen Jesuiten, der gerade als Dozent an der Gregoriana begann, in einem Restaurant unweit der Piazza della Venezia essen – ein entspannter, heiterer Abend, der letzte in Rom.
Natürlich stand der ganze Tag – unausgesprochen – unter einem besonderen Stern: Würde das vielleicht mein letzter Geburtstag sein? Was, wenn CT oder MRT in der kommenden Woche Metastasen zutage fördern würden? Wie viel Zeit bliebe mir dann noch?
Vielleicht ist ja Ironie manchmal ein adäquates Mittel, um Unvermeidliches irgendwie zu benennen, zu verarbeiten oder überhaupt ins Wort zu bringen. Auf dem Weg zur Botschaft war mir unweit der Villa Borghese am Eingang der Porta Pinciana eine Statue von Lord Byron (1788–1824) aufgefallen. Die Inschrift des Denkmals für den britischen Dichter der englischen Romantik aus »Childe Harold’s Pilgrimage« hatte es mir schlagartig angetan: »But I have lived, and have not lived in vain: My mind may lose its force, my blood is fire, And my frame perish even in conquering pain; But there is that within me which shall tire Torture and Time, and breathe when I expire.« Der Satz findet sich laut Inschrift im vierten Canto (Kap. CXXXVII) seines autobiografischen Werks, das Hector Berlioz zu der Tondichtung »Harold en Italie« inspirierte.
Ich höre mich noch zu Astrid sagen: »Das wäre doch ein Grabspruch für mich! ›Aber ich habe nicht umsonst gelebt: Mein Geist mag seine Kraft verlier’n … wenn ich sterbe.‹« Ironie oder Galgenhumor? Es war meine Weise, in dieser Woche vor den Untersuchungen Szenarien auszumalen, in die eine oder andere Richtung. Ich wusste ja nicht, welche Nachrichten noch auf mich zukommen würden.
Als wir von Paul auf die Dachterrasse der Gregoriana geführt wurden, wo Felix für einen Espresso dazustieß, mit dem ich im Frühjahr 1984 in einer Bibelschule in Israel war (ein Jahr später traten wir beiden in den Orden ein, er in Nürnberg, ich in Innsbruck), oder als uns Jörg durchs Collegio Bellarmino führte, weihte ich diese drei Jesuiten, mit denen ich befreundet bin, in meinen aktuellen Zustand ein. Es wäre mir komisch vorgekommen, wenn sie zwei Wochen später von meiner Erkrankung erfahren hätten. Aber ich bat alle drei, die Information vorerst für sich zu behalten. Es ist nicht leicht, unter dem Eindruck des ersten Schocks stehend, zu entscheiden, wen man daran teilhaben lässt und wen nicht. Oft löst eine solche Nachricht betretenes Schweigen aus. Oder aber einen Wortschwall, um die Situation zu überspielen, was die Sache noch peinlicher macht. Und außerdem: Ich wollte nicht bemitleidet werden. Aber es tat mir gut, wiederholt zu hören: »Ich denke an dich!« Oder auch: »Ich bete für dich!«
Am 5. Oktober flogen wir nach München zurück, ich mit gemischten Gefühlen, weil ich dem nächsten Arzttermin entgegensah. Weil ich das Schlernmassiv und den Brenner ausmachen konnte, gelang es mir, vom Flugzeug aus für wenige Sekunden auf Innsbruck zu schauen: Würde ich in der Krypta der Jesuitenkirche, wo ich 1991 zum Diakon geweiht worden bin, beigesetzt werden? Warum kam der Gedanke gerade jetzt? – Und schon begann der Sinkflug.
2Zur Entstehungsgeschichte vgl. »Eine neue Lektüre des Evangeliums«. Einführung von Andreas R. Batlogg SJ, in: Antonio Spadaro, Das Interview mit Papst Franziskus. Hrsg. v. Andreas R. Batlogg. Freiburg 2013. – Die englische Übersetzung aus dem Online-Journal »Thinking faith« wurde von der amerikanischen Jesuitenzeitschrift »America« übernommen, die spanische aus »Razón y fe« (Madrid) von »Mensaje« (Chile) und »Sic« (Venezuela).
3Vgl. Andreas R. Batlogg, Le elezione parlamentari in Germania, in: La Civiltà Cattolica 168 (2018), no. 4016, 153–165. Mit meiner Prognose, was die Koalitionsvariante »Jamaika« betraf (»Nero-giallo-verde per la bandiera nero-rosso-oro: questo è il risultato delle elezioni parlamentari in Germania. La cancelliera precedente sarà certamente anche la prossima: Angela Merkel.«), irrte ich leider. Nur die Kanzlerin hieß wieder Angela Merkel.
4Vgl. zuletzt: Friedhelm Mennekes, Neue Körperimaginationen. Die 57. Biennale von Venedig 2017, in: Stimmen der Zeit 235 (2017), 768–780.
5Vgl. Andreas R. Batlogg, Die Optimisten von Sant’Egidio. Zum Profil einer christlichen Gemeinschaft mit weltweitem Einfluss, in: Stimmen der Zeit 229 (2011), 613–628; italienische Teilübersetzung (»Sant’Egidio: Profilo di una communità cristiana«) in: La Civiltà Cattolica 161 (2011), no. 3874, 369–379.
5.
CT und MRT
Am 6. Oktober hatte ich den Termin in Neuperlach. Ich war drei oder vier Stunden dort. Sie kamen mir vor wie eine kleine Ewigkeit: MRT des Unterbauches, zuvor ein Kontrastmittel. Die Fülle von Informationsbögen, die durchzulesen waren, Zustimmungserklärungen und andere Papiere, die ich unterschreiben musste, riefen Ahnungen wach, dass jetzt etwas ganz Neues, Tiefgreifendes, lange Andauerndes beginnen würde. Es gab eine weitere Untersuchung, an die ich mich aber im Detail nicht mehr erinnern kann. Der Eindruck, der zurückblieb: Die Sache zieht sich. Es wird dauern! Ich ahnte: Nichts wird mehr so sein wie vorher.
Eine sehr freundliche türkische Assistenzärztin informierte mich über die verschiedenen Schritte, die vor mir lagen. Sie wurde auch nicht ungeduldig, als ich mehrmals bat, sie möge einen Satz wiederholen. Die Ergebnisse würden in einigen Tagen in einer Tumorkonferenz besprochen, danach bekäme ich den Bericht zugeschickt. Ich deutete an, dass ich eine Zweitmeinung einholen und wohl ins Klinikum Innenstadt der LMU wechseln würde. Entgegen meiner Befürchtung hörte ich: »Das ist Ihr gutes Recht!« Fuat hatte mir bereits versichert, ein Wechsel in ein anderes Krankenhaus sei kein Problem, ich müsse mich nicht rechtfertigen. Ganz geglaubt hatte ich ihm das damals nicht.
Datiert mit 12. Oktober, erhielt ich unmittelbar vor dem nächsten Termin, den Fuat für den 13. Oktober organisiert hatte, den Bericht aus Neuperlach. Die Diagnose: »nicht stenosierendes, mäßig differenziertes Addenokarzinom, Rektum bei 9 cm p. a.« Als Procedere wurde vorgeschlagen: »primäre onkologische Resektion mit laparoskopisch tiefer anteriorer Rektumsektion und protektive Anlage eines künstlichen Darmausganges.« Therapie: Staging.
Als Stadienbestimmung (engl. staging) bezeichnet man jenen Teil in der Diagnostik, welcher der Feststellung des Ausbreitungsgrades eines bösartigen Tumors dient. Sie dient als Basis für die Entscheidung, welche Therapie angezeigt ist. Als »Empfehlung« las ich am Ende des Berichts: »Wir haben Herrn Dr. Batlogg am 12. 10. 2017 um 14 Uhr angerufen und über unsere Empfehlung mit der primären Operation mit tiefer anteriorer Rektumresektion informiert. Herr Dr. Batlogg hat sich eine Zweitmeinung geholt und wird im Klinikum Innenstadt der LMU eine Therapie mit neoadjuvanter Radiochemotherapie beginnen. Die Portimplantation sei bereits für morgen geplant. Wir wünschen Herrn Dr. Batlogg alles Gute und stehen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.« Ich verstand: Fuat hatte sich bereits im Klinikum gemeldet und angedeutet, dass er eine andere Therapie – mit späterer Operation – vorschlägt.
Den letzten Teil des zwei Seiten langen Berichts verstand ich. Das Medizinerkauderwelsch davor ließ ich mir von Monika erklären, einer Freundin, die in St. Michael ehrenamtlich als Lektorin und Ministrantin wirkte. Monika war Dermatologin und Gesundheitswissenschaftlerin. Sie unterrichtete an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München, außerdem lehrte sie auch an der TU München, wo sie eine Aids-Station aufgebaut hatte. Leider ist sie im März 2018 bei einer Schitour tödlich verunglückt. Zwei Wochen, nachdem ich ihren Vater beerdigt hatte, musste ich mit einem Mitbruder diesen letzten Dienst für sie tun – ein schwerer Schlag für ihre Familie, für die Gottesdienstgemeinde in St. Michael, auch für mich. Bei der Beerdigung benötigte ich noch einen Rollator.
Ohne Monika wäre ich in den ersten sechs Monaten öfters verzweifelt. Sie ist mir ärztlich wie menschlich zur Seite gestanden. Ein großes Privileg, das nicht jeder hat. In der Klinik verständigte sie sich mit den behandelnden Ärzten, sie besorgte in der Apotheke Medikamente. Als sich Nebenwirkungen der Chemo zeigten, kam sie fast jeden zweiten Tag abends, um mich einzucremen und die schmerzenden Beine zu massieren. Dabei musste ich immer – seltsamerweise oder nicht – an Maria, die Schwester von Martha und Lazarus, und die Salbung Jesu in Betanien (Joh 12,1–11) denken. Das ganze Haus duftet nach dem kostbaren Öl – und Maria wird von einem der Jünger Verschwendung vorgeworfen6. Das Massieren bekam dadurch eine ganz eigene Stimmung. Etwas an sich geschehen lassen, dafür braucht es anfangs Überwindung. Einmal musste ich lachen. Ich genierte mich etwas, aber eine heftige und schmerzhafte Gegenreaktion im »sensiblen Bereich« machte es einfach erforderlich. »Andreas, ich muss mir das anschauen, du musst jetzt einfach die Hose ausziehen. Ich habe das schon tausend Mal gesehen.« Auch dass Jesus, als er vom Tod des Lazarus erfuhr, den er aus dem Grab holen würde, ganz heftig weinte (vgl. Joh 11,35), bewegte mich damals sehr – und ich hoffte, Monika diesen Schmerz ersparen zu können.
Am 13. Oktober fuhr ich morgens ins Klinikum Großhadern: Eine weitere CT und die Implantation des Super-Ports unter dem rechten Schlüsselbein standen an. Im Fachjargon: operative Einpflanzung eines zentralvenösen Katheders. Da ich am Morgen zu wenig getrunken hatte, musste ich eine Stunde warten, währenddessen ich auf und ab gehend eineinhalb Liter Flüssigkeit trank. Dann erst die Röhre, die anfangs etwas unheimlich wirkt. »Tak, tak, tak«, so hörte sich das erste Geräusch an, ein anderes hatte einen dumpfen Laut. Falls man in Panik gerät oder Platzangst bekommt, kann man mittels eines Knopfes Alarm schlagen. »Alles in Ordnung?«, hörte ich einmal über einen Lautsprecher. Man ist allein mit sich, das Ganze dauert 30 bis 45 Minuten. Dieses Durchleuchten macht einen zum gläsernen Menschen.
Nervös war ich, ob ich den kleinen Eingriff rechtzeitig absolvieren könnte, da die beiden Abteilungen weit auseinander lagen. Großhadern ist riesig. Ich hatte Angst, mich zu verlaufen und fand die angezeigte Station auch nicht sofort. Aber weil sich dort einiges verschoben hatte, musste ich auch hier warten, beinahe drei Stunden. Kurz vor zwölf Uhr mittags kam ich in den kleinen Operationssaal. Selbst auf den Tisch zu steigen, mitzukriegen, wie ich mit grünen Tüchern abgedeckt wurde, war ein Neuheitserlebnis. Ich war ziemlich nervös. Gleich würde mir mit einem Skalpell in die Haut geritzt werden. Ich wurde lokal betäubt. »Haben Sie schon aufgeschnitten, ist das Ding schon eingesetzt?« »Alles schon passiert, keine Angst.« »Und wenn ich jetzt kollabiere?« »Es kann gar nichts passieren, Sie merken das gar nicht. Alles in Ordnung!«
Es war die Aufregung – das erste Mal eine kleine OP im Leben, mit 55! Der Schiunfall auf dem Hochjoch in Schruns (Montafon), als ich mir das Bein brach und drei Wochen einen Liegegips bekam, lag Jahrzehnte zurück: Im Januar 1970 – meine kleine Schwester wurde in dem Monat geboren – war ich in der ersten Klasse der Volksschule Riedenburg in Bregenz.
Schmerzfrei kletterte ich vom OP-Tisch herunter. Jetzt hatte ich also einen kleinen Kumpanen unter dem Schlüsselbein – eine tolle Einrichtung, wie ich später feststellte, denn Infusionen können so viel leichter verabreicht werden.
Auf dem Weg zurück in die Innenstadt wusste ich: Jetzt beginnt der Weg der Therapie. Ein Marsch in unbekanntes Land! Gott sei Dank wusste ich damals nicht, was alles in den kommenden Monaten auf mich zukommen würde! Durch Abtasten versicherte ich mich gelegentlich, dass der Port noch da war, ein Fremdkörper zunächst, aber ein gern gesehener »Gast«, der eben die Behandlung enorm erleichtert und mich davor bewahrte, ständig »angestochen« werden zu müssen.
6Bei Matthäus und Markus spielt sich die Szene in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen ab: Eine namenlose Frau, die ein Alabastergefäß mit wohlriechendem (Narden-)Öl verwendet, ruft den Protest der Jünger hervor, die darin eine Verschwendung sehen (vgl. Mt 26,6–13; Mk 14,3–9). Bei Lukas spielt die Handlung im Haus eines Pharisäers, der später mit dem Namen Simon genannt wird. Die anonyme Frau wird als »Sünderin« eingeführt, sie salbt und küsst die Füße Jesu – der Pharisäer stößt sich an diesem Umgang und fragt, ob ein richtiger Prophet nicht merken müsste, von wem er sich da – das eigentliche Tabu – berühren lässt (vgl. Lk 7,36–50).
6.
Kämpfen oder aufgeben?
Die Scans von MRT und CT hatten die Diagnose des Gastroenterologen bestätigt und präzisere Details über den Tumor und sein Umfeld ergeben. Das Positive daran war: Metastasen wurden keine nachgewiesen. Das war beruhigend. Und mehr oder weniger die erste erfreuliche Nachricht seit dem 25. September.
Darüber hatte ich lange nachgedacht und mich auch mit einigen Mitbrüdern besprochen: Sollte ich Metastasen haben, sollte der Tumor gestreut haben und andere Organe befallen sein, würde ich mich intensiv beraten lassen, ob eine Operation und eine monatelange Behandlung überhaupt sinnvoll sind. Deutlich wurde dabei, dass eine hundertprozentige Prognose über den Krankheitsverlauf nahezu unmöglich ist. Welcher Arzt kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass eine Therapie aussichtslos ist? Dass ein Patient noch sieben Monate zu leben hat oder nur mehr drei Wochen? Es ist alles relativ, so meine Erkenntnis.
Die Alternative lautete nie: Kämpfen oder aufgeben? Klar war aber, dass ich eine Behandlung mit geringen Aussichten auf Erfolg ablehnen würde. In dem Fall würde ich mich nach einem Hospiz umschauen und mich, wenn es soweit ist, nur mehr palliativ behandeln lassen. Meinen Eltern wollte ich davon vorerst nichts sagen. Ich hörte schon einen Standardsatz meines Vaters, der mich noch nie überzeugt hatte: »Ein Batlogg gibt nicht auf!«
Zum ersten Mal in meinem Leben wurde das eine reale Überlegung: Wofür würde ich dann die mir noch verbleibende Lebenszeit nutzen? Mit wem noch einmal sprechen? Wen vielleicht zum letzten Mal besuchen? Mit wem Versöhnung angehen? Die Begrenztheit meiner Lebenszeit wurde plötzlich sehr real: Alles Planen, alles Fantasieren, sämtliche Vorsätze entpuppen sich schlagartig als sehr bedingt. Der Gedanke, dass ich möglicherweise nur mehr wenige Monate zu leben hatte, beschäftigte mich einige Tage, bevor das Ergebnis von MRT und CT auf dem Tisch lag. Ich schob ihn nicht weg. Merkte aber, dass ich diese Zeit nutzen will – für mich, um einiges zu ordnen, um manches vielleicht ins Lot zu bringen.
Ich erinnerte mich an meinen Mitbruder Albert Keller SJ (1932–2010), Philosophieprofessor und bereits in jungen Jahren akademischer Rektor unserer ordenseigenen Hochschule in München. Für einige Jahre war ich sein Zimmernachbar im Berchmanskolleg in der Kaulbachstraße gewesen. Auf dem Gang sind wir uns mehr oder weniger täglich begegnet, ein Wort ergab dabei das andere. Für den einen oder anderen Handgriff war er stets dankbar.
Von seiner schweren Krankheit unübersehbar gezeichnet, fragte ich ihn immer wieder, wie es ihm gehe. Manchmal entstand dabei ein längeres Gespräch. Ob ihn seine Krankheit verändere und ob er darüber schreiben wolle, fragte ich ihn einmal bei Gelegenheit. (Ein Redakteur ist immer auf Autorenfang!) Zwei Tage später von einem Vortrag in Köln zurückgekehrt, fand ich in meinem Postfach einen Text vor: »Wir Behinderten«. Daraus entstand das letzte Editorial des jahrzehntelangen Autors in den »Stimmen der Zeit«, erschienen im April 2010, etwas mehr als drei Monate vor seinem Tod. Es beginnt so direkt, wie es typisch war für den beliebten Professor ohne jeden Standesdünkel (der übrigens auch Kurat der Gebirgsschützenkompagnie Tegernsee war): »Wer (…) als fast Achtzigjähriger mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hat, sich wegen inoperabler Metastasen einer Chemotherapie unterziehen, dazu Tag für Tag Medikamenten-Cocktails schlucken muss und nur intravenös ernährt werden kann, kennt einen Zustand als Insider, den die Mehrheit der Deutschen nur als die für sie wichtigste Bedrohung fürchtet.«7 Unverkennbar geht es in dem Text um die Angst des deutschen Bundesbürgers, im Alter zum Pflegefall zu werden.
Eine dabei beschriebene Angst kam mir jetzt, in meiner neuen Situation, unwillkürlich in den Sinn, auch wenn ich genau dreißig Jahre jünger war als Albert: »Man ängstigt sich, seine Würde zu verlieren, wenn man sich dem Status eines Kleinkindes nähert, in dem man hilflos der Fürsorge anderer ausgeliefert ist und jeden Eingriff in die eigene Intimsphäre über sich ergehen lassen muss, wogegen sich – im Unterschied zum Kleinkind – unser Schamgefühl als Erwachsene sträubt (etwa wenn die Kontrolle über die Körperausscheidungen verlorengeht).«8
Dass ich keine Demenz zu befürchten hatte, half in diesem Augenblick wenig. Aber dass ich völlig auf fremde Hilfe angewiesen, dass ich in der Klinik den Blicken und den Handgriffen anderer ausgesetzt sein würde – das schwante mir. Es graute mir davor! Und die Klammerbemerkung über verlorengehende Kontrolle war ja in meinem Fall fast so etwas wie eine »self-fulfilling prophecy«. Man macht wahrlich keine Luftsprünge, wenn man den verschiedenen Behinderungen und Einschränkungen entgegenblickt, die unweigerlich auf einen warten und so sicher kommen wie das Amen in der Kirche.
Vom Rektor erhielt Albert Keller während einer Kommunitätsmesse die Krankensalbung, bevor er – seit Herbst 1971, also fast vierzig Jahre lang im Berchmanskolleg lebend – in die Palliativstation St. Johannes von Gott am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München-Nymphenburg gebracht wurde. Wer es wissen wollte wusste, dass es keine Rückkehr geben würde. Ich habe mich damals gewundert – und geärgert –, dass manche Mitbrüder sich auf eine Art und Weise verabschiedeten, als komme er in einer Woche wieder zurück.
Vier Tage vor seinem Tod am 5. Juli 2010 besuchte ich Albert in der Palliativstation. Einige Wochen zuvor hatte er mir ein ihm wichtiges Manuskript überlassen und mich gebeten, dafür einen Verlag zu finden. Kaum hatte ich sein Zimmer betreten, erkundigte er sich, ob daraus etwas werde. Ich bejahte, er lächelte, und dann fügte ich hinzu: »Du wirst es wohl nicht mehr erleben, aber ich kümmere mich um die Veröffentlichung.« Das ist auch gelungen, und das Buch erhielt sogar eine zweite Auflage9. Seine letzte Tat, um Mitbrüder (je nach Lesart) zu irritieren oder zu ärgern, war eine von ihm selbst vorab aufgesetzte Todesanzeige, die eine Freundin von ihm in der »Süddeutschen Zeitung« aufgab. »Typisch Keller«, meinten manche Mitbrüder. Seine große Gottesdienstgemeinde in St. Michael, wo er jahrzehntelang als wortgewaltiger Prediger (auf der Kanzel) geschätzt war, wunderte sich weniger über diesen »Abgang«. Wer sich damals ärgerte, dem entging, dass es sich dabei nicht nur um hintergründigen Humor handelte, sondern auch um eine Art »Crash-« oder Schnellkurs in Sachen Eschatologie. Albert Keller beherrschte die Kunst, komplizierte theologische Sachverhalte auf den Punkt zu bringen: »Bis dann. Auf geht’s.« Knapper konnte man es kaum auf den Begriff bringen: das Bekenntnis eines Christenmenschen10!

So viel Humor – und felsenfesten Glauben – konnte ich in den ersten Wochen meiner Erkrankung nicht aufbringen. Aber mit der Zeit wuchs die Zuversicht auf ein gutes Ende – so oder so.
7Albert Keller, Wir Behinderten, in: Stimmen der Zeit 228 (2010), 217–218, 217.
8Ebd.
9Vgl. Albert Keller, Grundkurs des christlichen Glaubens. Alte Lehren neu betrachtet. Hrsg. v. Andreas R. Batlogg u. Nikolaus Klein. Freiburg 2011 (22012).
10Abdruck des Faksimile bei: Andreas R. Batlogg – Nikolaus Klein, Einführung: Alte Lehren neu betrachtet. Albert Kellers »Grundkurs des Glaubens«, in: Albert Keller, Grundkurs des christlichen Glaubens, 17–29, 29, Anm. 19.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.