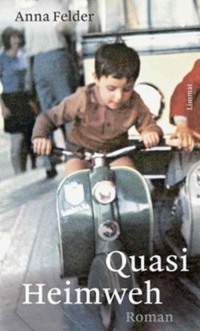Kitabı oku: «Quasi Heimweh»
Über dieses Buch
Ende der Sechzigerjahre, die Icherzählerin, eine junge Lehrerin aus dem Tessin, hat die Aufgabe, die Kinder italienischer Arbeitsmigranten zu betreuen. Naturgemäß bewegt sie sich zwischen zwei Sprachen und Welten, zwischen Deutsch und Italienisch, zwischen dem Tessin, der Lombardei und Aarau.
Sie ist selbst etwas fremd und befremdet in der deutschen Schweiz, und so schreibt sie auch von sich, wenn sie von der Situation der Fremden in der Schweiz erzählt, von der Schwierigkeit, die neuen Sitten und Gebräuche, das ganze Gehabe im kalten Norden zu verstehen.
Das Buch, das sich noch heute frisch und aktuell liest, erschien 1970 zuerst in der deutschen Übersetzung. Erst zwei Jahre später wurde es im italienischen Original veröffentlicht mit dem Titel «Tra dove piove e non piove»: zwischen da, wo es regnet, und dort, wo es nicht regnet.
Obwohl Anna Felder mit ihren einfühlsamen Annäherungen an die Lebenswelt der Migranten durchaus in die damalige politische Debatte eingriff, war das Werk nicht als Pamphlet angelegt, vielmehr beobachtet die Erzählerin die Kinder und ihre Eltern als eine Art Komplizin und mit warmer Empathie.

Foto Ladina Bischof
Anna Felder, geboren 1937 in Lugano, Literaturstudium in Zürich und Paris, Promotion über Eugenio Montale, danach Tätigkeit als Italienischlehrerin und Schriftstellerin. Lebt in Aarau und Lugano. 1998 Schillerpreis für das Gesamtwerk, 2004 Aargauer Literaturpreis und 2018 Schweizer Grand Prix Literatur. Im Limmat Verlag sind lieferbar «No grazie» und «Die Adelaiden / Le Adelaidi».
Der Übersetzer Federico Hindermann (1921–2012), geboren in Biella (Piemont), verbrachte seine Kindheit in Turin, seine Jugend in Basel, unterrichtete Deutsch in Oxford und Romanische Philologie in Erlangen. Er arbeitete als Übersetzer und Herausgeber und von 1971–1987 als Leiter des Manesse Verlags. Im Limmat Verlag ist der zweisprachige Gedichtband «Fügsam dagegen / Docile contro» lieferbar.
Anna Felder
Quasi Heimweh
Roman
Aus dem Italienischen von Federico Hindermann
Nachwort von Alice Vollenweider
Limmat Verlag
Zürich
1
Nur selten kam es vor, dass meine Schüler mich nicht an den Zug begleiteten. In einzelnen Städtchen, in Brugg zum Beispiel, war es recht weit vom neuen Schulgebäude zum Bahnhof: Meine Kinder mussten den Weg nach Hause noch einmal, vielleicht im Dunkeln zurücklegen, denn die Italienerfamilien wohnten fast alle jenseits der Schule in den neuen Blöcken, voll wie Ameisenhaufen auf freiem Feld, oder in den Holzbaracken in den Außenquartieren.
Das war zur Gewohnheit geworden, dieser Abendspaziergang, und ich wusste, dass ich meine Verehrer enttäuschte, wenn ich ihnen sagte, sie sollten nicht mitkommen, es sei kalt, ich müsse noch etwas einkaufen, oder es warte jemand auf mich: Sie zogen den Revolver hervor und machten peng peng.
Als ich in Italien unterrichtete, war es anders: Dort gab es, in der Stadt, das Ritual der Mütter und der Dienstmädchen: alle hinter dem Gitter, wartend und schwatzend, mit einem Brötchen in der Hand, dem Mantel, der schriftlichen Entschuldigung, manchmal stand auch der Chauffeur dabei. Aber dann stieg ich in die Straßenbahn, oder Fabio war da, der auf mich wartete, und ich setzte ein anderes Gesicht auf. Fabio hatte nie unterrichtet, er wusste nicht, was es heißt, den ganzen Tag mit vierzig Kindern verbringen: Er hätte nichts begriffen, wenn ich ihm erzählt hätte, dass ich manchmal ungern das Klassenzimmer betrat, missmutig schon am frühen Morgen, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen, und dass ich dann nach wenigen Minuten merkte, dass ich beim Unterrichten so frisch und klar redete, wie ich nur konnte, weil sie mich alle mit vor Aufmerksamkeit glänzenden Augen anstarrten und mit zusammengekniffenen Lippen; er hätte gedacht, ich spräche eine andere Sprache, hätte ich ihm gestanden, dass es meine Kinder waren, die mich Tag für Tag in den Bann ihres Zaubers zogen: dass ich dann schön wurde für sie und redete, in Zorn geriet, in die Falle ging, die ihre Fragen, ihre aufgestreckten Hände stellten. Fabio musste wohl den Eindruck haben, ich unterrichte nur so zum Zeitvertreib, ohne mir dabei den Kopf und die Fingernägel zu zerbrechen. Ihm von den Aufgaben, von irgendwelchen Spielen unter Schülern erzählen, musste für ihn so sein, als lese man ihm aufs Geratewohl die Nachrichten aus dem «Corriere» vor: Er wendet das Fleisch im Mehl (denn er briet es immer selbst, mit den raffiniertesten Saucen), und ich blättere mit lauter Stimme in dem, was ich gerade auf dem Tisch finde. Für ihn war ich immer die Gleiche, mit diesem andern Gesicht: Wenn er mich von der Schule abholte, stellte er keine Fragen, er war nicht gespannt, was wir uns hätten sagen können; manchmal begleitete er mich morgens im Auto wieder zur Schule.
Ich erinnere mich gut an den Nebel, so in der Früh, der uns wie der Schlaf noch umhüllte, und an die gelben triefenden Augen der Autos; es war nicht weit bis zur Schule, aber zu dieser Zeit fuhr man wegen des Verkehrs und des Nebels fast stehend sehr lang in der Kolonne. Reden war dann nicht nötig: Ich brauchte nur sein Gesicht zu beobachten, wie es sich zu einem Knoten verschloss um die Lippen, die sich vorschoben, schwer, ein reglos starres Wort zu fassen; ich brauchte nur seine am Steuerrad ruhenden, eine Gebärde, einen Gedanken nachzeichnenden Hände wiederzuerkennen, die dann aufzuckten mit flinken Griffen bei den Verkehrszeichen; bevor wir uns trennten, grüßten wir uns kaum mit den Blicken, beide darauf bedacht, das Schweigen nicht zu brechen.
Auch ich hatte ein Zimmer mit Küche in der Stadt, alles viel kleiner als bei Fabio. Ich arbeitete gern auf meinem Zimmer, weil ein riesiger Tisch darin stand, ein Zeichentisch vor dem Fenster: Es war das großzügigste Möbelstück in dem Kämmerchen, und ich saß daran und korrigierte und bereitete meine Stunden vor. Seit damals, glaube ich, seit jener ersten Zeit, als ich nicht mehr bei meiner Mutter wohnte, hatte ich gemerkt, dass ich an zu Hause dachte, ich sah es eigentlich zum ersten Mal so von außen, das Haus mit den Zimmern, in denen es wegen der Bäume im Garten immer ein wenig dunkelte; und ich sah den Garten, kannte ihn auswendig, die entlegensten Dinge kamen mir in den Sinn, jene Haufen von dürrem Laub, die meine Mutter auf dem hinteren Beet schichtete, bevor man davon den letzten Streifen abschnitt, um die Straße zu verbreitern: Als Kind warf ich mich rücklings aufs Laub, im Mantel und in allem, weil es schon bald Winter wurde, und durch das wilde Geknister der toten Blätter spürte ich, wie die Feuchtigkeit des Bodens unter die Haut drang.
Meine Mutter rief oft an, und ich richtete es so ein, dass sie mich zu Hause fand, dass sie sich keine Sorgen machte. Von Fabio wusste sie nichts. Ich besuchte sie übers Wochenende: Sie hielt die Gläser mit meiner Lieblingskonfitüre bereit, zuckersüße Feigen, stellte mir von den kleinen Röschen aus dem Garten ins Zimmer, die den ganzen Winter blühten; sie kochte mir Kalbshaxen und Leberschnitten mit Marsala; sie ließ mich das Haus und den Garten so unversehrt wiederfinden wie damals, als mein Bruder Gianni und ich noch Kinder waren. Aber sie redete jetzt mit mir wie mit einer Erwachsenen, einem Mädchen, das sich sein Leben selber verdient: Sie war tapfer, war ein wenig stolz, dass sie uns hatte fortziehen lassen, unsere eigenen Wege, ohne uns ihre Einsamkeit zu spüren zu geben. Und jetzt, an den beiden Tagen, die wir zusammen verbrachten, lasen wir wieder Giannis Briefe aus der Schweiz: Meine Mutter war in großer Angst, Gianni könnte, launisch, wie er war, Dummheiten anstellen, sich in ein Schweizer Mädchen verlieben: «Wenn er mir nur nicht so eine verrückte Bohnenstange ins Haus bringt»; denn die Schweizerinnen waren für sie hochaufgeschossene, hagere Mädchen in Hosen, gar nichts Rechtes.
In seinen Briefen berichtete Gianni nicht von den Mädchen: Aber er schrieb mitunter irgendein deutsches Wort zum Spaß, «pfui pfui» zum Beispiel, als er zu seinem Entsetzen Grießbrei mit Johannisbeeren hatte essen müssen; oder er erzählte von seinem Chef, der jeden Tag einen kleinen Imbiss mit ins Büro brachte, zwei oder drei halb reife Äpfel, die er aufs Pult neben das weiße Telefon legte; gegen vier verdrückte er einen nach dem andern wie ein hungriges Kind, mitsamt der Schale und allem, ohne auch nur ein einziges Vitamin unter den Tisch fallen zu lassen.
Aber ich wusste genau, dass Gianni, liederlich wie er schien und ein seltsamer Kauz, uns gern ganz andere Briefe geschickt hätte, randvoll mit Dingen von zu Hause: Wenn er es nicht tat, dachte ich mir, dann nur aus dem Grund, weil er nicht mit uns so losheulen wollte wie damals, als wir ihn bis Chiasso begleitet hatten und er die netten lieben Worte, die er uns sagen konnte, bevor wir Abschied nahmen, zurückstieß und hinter der Aufregung um die Reise und das Gepäck versteckte: Der Zug bewegte sich schon, und er fragte die Mutter immer noch nach irgendwelchen blauen Badehosen: Als wäre er da in die Schweiz gefahren, um schwimmen zu gehen.
Ich reiste jeweils am Montag sehr früh wieder weg, mit dem Koffer voll von schönen, gestärkten Sachen: Und ich weiß noch, wie während der halben Stunde, die ich im Zug stehen musste, ich mir jedes Mal ausmalte, ich käme nun in eine neue Stadt, wo ich wieder von vorne anfinge, wo Fabio für mich auch dasselbe wäre wie mit meiner Mutter reden und meinem Bruder.
2
Die Lehrerin so zu begleiten war in der Schweiz eigentlich nicht einmal üblich: Ich erinnere mich an meine schweizerischen Kolleginnen, ich weiß noch von Fräulein Wullschleger mit ihren übergenauen Bewegungen einer Kurzsichtigen, wie sie jedem einzelnen Schüler ganz ernst die Hand gab und ihnen half, die Windjacke zu schließen, den Daumen in den wollenen Handschuh zu stecken (die Mütter holten ihre Kinder nie von der Schule ab, auch in der Stadt war es da nicht Brauch); aber dann ging sie allein weg, mit ihrer prall gefüllten Mappe, ohne Kinder hinterdrein, und rannte ein wenig schwerfällig die Treppe hinunter. Ich fragte mich, ob ihr Mann oder ihr Freund ihr die Mappe getragen hätte; Fabio, dachte ich, hatte das nie getan: Es war ihm gewiss nie eingefallen.
Manchmal sagte ich zu meinen Schülern: «Heute kommt ihr nicht mit; heute nicht»; und sie, neugierig wie immer: «Warum nicht? Warum nicht heute? Peng peng.» Wenn sie das Auto erblickten, das unten auf mich wartete, jubelte es vielstimmig durcheinander: «Nimm uns auch mit, sag es ihnen doch, dass wir ein bisschen mitfahren dürfen!» Mein Bruder blieb dann jeweils im Auto sitzen, am Steuerrad, glücklich wie die Kinder, dass er Ginos Wagen fahren konnte. Gino dagegen stieg aus, und er war so groß und so mächtig, dass es eine ganze Weile brauchte, bis er draußen stand; aber dann begann er jedes Kind geduldig auszufragen, Namen und Vornamen, und ob ich lieb sei mit ihnen:
«Sag mal, stimmt’s, dass sie nie mit euch schimpft? Stimmt’s, dass sie gar nicht schimpfen kann?»
«Und du, kannst du denn schimpfen?»
«Huh!»
Sie lachten, wenn auch nicht sehr überzeugt, und hielten sich vorsichtig außer Reichweite; denn Gino sah wirklich wie ein Riesenkerl aus, mit schwarzen buschigen Brauen, die ganz von selbst, wenn es sie ankam, ein drohendes Huh hätten sagen können. Aber darunter verbargen sich zwei gutmütige kleine Augen, zwei Haselnüsschen, die einen unverwandt anschauten, auch wenn man es nicht merkte; man musste sie suchen, seine Augen, wie in einem Schatten, der im Dunkeln flüchtig vorüberstreift auf demselben Gehsteig: Wenn man sie entdeckt hat, ist es schon zu spät, und man trägt noch immer diesen Blick auf sich, der einen schon vorher anstarrte.
«Heute fahren wir nach Auenstein», sagte Gino.
«Zum Essen?»
Ich saß nämlich gern in solchen Landgasthäusern, im «Bären», im «Sternen»: mit den Doppelfenstern und den Kissenrollen auf dem niedrigen Sims schon im Herbst; man braucht nur daran zu denken, und schon möchte man ausrufen: «Wie kalt es ist, gehen wir doch hinein.» Drinnen stehen die klobigen Tische und Bänke, aus ungebeiztem Holz wie die runden Bretter, auf denen das Brot geschnitten wird (und bei dem einen ist vielleicht ringsum die erste Bitte des Vaterunsers eingekerbt); mit Holz sind auch die Wände verkleidet, und daran die Schaukästen mit den Bechern und Bildern des Turnvereins, alle in weißen Leibchen und dünnen Hosen, bei der Kälte, auch der Sohn der Wirtsleute. Aber hier drin ist es warm, man möchte dösen wie die andern, einige wenige schweigende Männer mit der an beiden Enden gestutzten Zigarre, dem Schweizer Stumpen, mitten im Mund, und mit der Wollmütze auf dem Kopf, die gar nicht neugierig sind, uns zu sehen, sie sitzen da und drehen uns den Rücken zu, die Ellbogen auf dem Tisch, und trinken langsam ihren Zweier Weißwein. Auf der Bank neben der Tür sitzt auch die Großmutter mit ihrer schönen Leinenschürze und strickt, und sie versucht nun von Zeit zu Zeit ein paar Worte zu sagen; denn sie befiehlt hier, mit siebzig, sie hat dicke Beine unter der Schürze, wie zwei kleine Fässchen, die sich fast nicht mehr rühren, sitzt auf der Bank und hält ihre Gäste alle brav beisammen, die auch morgen und übermorgen kommen werden, ihren Zweier zu trinken: Im «Sternen» ändert sich nichts, die Stunden gehen nicht vorbei, ein Tag ist Donnerstag, ein Tag ist Samstag, draußen friert es oder es taut, aber die Wirtsfrau sitzt da auf der Bank und hält die Becher fest und das Bild des Turnvereins, sie ist wie eine Glocke, die in einem fort dieselbe Stunde schlägt.
In Auenstein gab es keinen «Sternen», aber es gab den Fluss, der die Landschaft weit machte, hindehnte in ruhige Fernen; die Geräusche drangen nicht von Ufer zu Ufer, waren weggeglättet von einer Wasserfläche, die langsam ohne Laut vorbeiglitt, ohne Stimme, und auch den Himmel und den Schatten der Bäume in der Strömung mitzog.
«Ist das nicht der Po», hatte Gino zu uns gesagt, «ein Stück Po-Ebene?»
Denn Gino, Gino Berger, der Schweizer war, hier in der Gegend geboren und aufgewachsen, die wir erst kennenzulernen begannen, fühlte sich mit Italien durch viele Erinnerungen aus seiner Kindheit verbunden: italienische Erinnerungen, wie sein Vorname, aus der Zeit, als er die Ferien bei den Eltern seiner Mutter verbrachte, die aus der Lombardei stammte; Italien lebte noch in ihm aus der Ferne nach wie jene glücklichen Jahre, in denen er jeden Sommer zum Hätschelkind der Großeltern wurde, ihrem Stolz, weil er zwei Sprachen konnte; und so hatte er sich einen Winkel seiner Kindheit, den Fluss von damals hier an dieser Stelle der Aare erfunden, und er liebte es, mit uns zusammen Worte und Wendungen wachzurufen, die er als Kind zu Hause gelernt hatte und nun in jedem Klang mit einer ganzen versunkenen Welt wiederentdeckte.
Ich aber bekam in Auenstein nicht seine Po-Ebene zu sehen, es gelang mir nie: Das Stauwehr war da, das Bänkchen und der volle Abfallkorb; da war, an dem Abend, ein Fischer in kniehohen Stiefeln; und nachher, als die Dunkelheit auch das flache Hinfließen des Wassers, all die atmende Stille der Landschaft in sich ausgelöscht hatte, nachher war niemand mehr da und nichts, es war alles weg: keine Aare mehr, noch die Po-Ebene, mein Haus nicht, nicht Gino und nicht mein Bruder, nicht meine Uhr, die fünf oder zehn zeigte: keine Luft mehr, nur Nachtblau; nicht Bäume am Ufer, nur flüssige Schatten; Wasser und Strom waren Leere, die Welt dahin, ertrunken; schwarz.
Eine solche Landschaft erscheint uns vielleicht im Traum, ein Maler mag sie malen, aber wir können nicht im Auto hinfahren, um sie uns anzuschauen, und dann die Mandarinenschalen in den Abfallkorb werfen. Eine Landschaft ist echt oder nicht, sie ist wirklich oder geträumt, lebt in der Zeit oder in der Sehnsucht. Ich weiß noch: Der Garten, an den man zurückdenkt, und das Haus und Fabio, wenn man fort ist, sind nicht die echten: Sie selbst sind verschieden, gehen gradaus ihres Weges (auch der Garten, der weiterwächst), wir aber sehn sie bald so und bald anders, einmal groß, einmal klein, erinnern uns an ein Kleid oder eine Wand, aber das Ganze sehen wir doch nie recht, weil es sich ständig verändert, und je mehr wir uns darauf besinnen, je stärker bewegt es sich, wie wenn man hinter jemandem herrennt, der immer rascher läuft, und das Halstuch flattert ihm nach: Er dreht nach rechts, dreht nach links, man holt ihn ein, aber er hat schon wieder einen Vorsprung, man braucht nur das Halstuch zu sehen bei der Wegbiegung und rennt wieder los, und so ist es mit dem Verlangen, das uns nach Hause zieht und hier «Heimweh» heißt, man braucht nur einen Namen auszusprechen, braucht nur Fabio zu sagen und rennt, aber er ist nicht da.
Darum vielleicht hatte Gino diesen Ort nach einer Erinnerung so genannt: Denn man sah es ja, dass es in Auenstein nicht seine Po-Ebene gab, und doch hatte man Lust, sie hier zu suchen.
Seit jenem Abend sagten wir, wenn wir merkten, dass einer mit den Gedanken woanders war: «Was ist los, hast du wieder die Po-Ebene bekommen?»
Der Unterricht hörte um vier auf: Aber meine Schüler, alles Kinder italienischer Gastarbeiter, hätten mich auch zehnmal hin und zurück von der Schule zum Bahnhof begleitet, so viel Zeit hatten sie noch, bis die Eltern vielleicht spät am Abend von der Arbeit nach Hause kamen. Es waren sogenannte Schlüsselkinder, Kinder also, die den Hausschlüssel in der Tasche oder an einer Schnur um den Hals tragen, weil Vater und Mutter tagsüber fort sind.
In vielen Dörfern und Städtchen gab es zwar Kinderhorte, von Schwestern oder auch Privatleuten geleitete Heime, die eigens für die Freizeit der Schlüsselkinder eingerichtet worden waren; aber es war schwierig, solche Quecksilber nach der Schule beieinanderzuhalten: Sie trieben sich, unter dem Vorwand, mich ein Stück weit begleiten zu dürfen, lieber mit einem Fußball auf der Straße herum. Die Fabriken, die Bauplätze und Werkstätten schlossen Punkt fünf: Für die Kinder war es ein Fest, sich in den dichtesten Stoßverkehr zu stürzen, mit den Arbeitern auf den Fahrrädern um die Wette zu laufen: Ich musste mich daran gewöhnen und es mit ansehen, wie sie mir mitten im Lärm davongewirbelt wurden, heil und unschuldsvoll von einem Gehsteig zum andern, und dabei noch Muße fanden, die VW und Fiat zu zählen (siebenundzwanzig Seicento, sagten sie mir dann); ich hielt die Allergetreuesten fest, die sich an den Griff meiner Mappe klammerten.
So viele Rad fahrende Italiener wie in diesen Gegenden der deutschen Schweiz hatte ich noch nie gesehen: fast alle abends mit einem Bündelchen auf dem Gepäckträger oder mit einem Korb vor der Lenkstange, einer Art Salatkorb: Schaute man genauer hin, so erkannte man die Zipfelmütze und die Wollschärpe ihres Kindes, das schon ganz weich und schwer vor Schlaf eben aus der Krippe kam wie aus einem warmen Backofen.
Die Straße, die in Aarau zum Kinderhort führte, schien eine Versammlung von Liebespaaren; es waren die Väter, die unter den Laternen warteten und ihren an die Gartenmauer angelehnten Bambino einmummelten: Sie kleideten ihn, hüllten ihn fest und zu fest ein, als hätte er jeden Abend Zahnschmerzen; beide stumm, Vater und Kind, weil das noch Arbeit war, Pflicht, das Warten abends bei der Krippe, der Weg, den man bis nach Hause zurücklegen musste, und die vielen Stunden, die sie den Tag durch voneinander trennten.
3
Seitdem ich meinem Bruder in die Schweiz nachgereist war, lebten wir zusammen in einer am Hügel gelegenen, ganz in die Länge gezogenen Wohnung zuoberst in einem Holzhaus, das mich jedenfalls sehr schön dünkte. Gianni hatte es mit seinem Spürsinn entdeckt und sich für wenig Geld im Dachgeschoss eingemietet, «halb geschenkt», denn das Haus sollte demnächst abgerissen werden: Wann, konnte man uns nicht sagen, aber wir mussten uns bereithalten, von einem Tag auf den andern zu packen.
Wir sind im Herbst dort eingezogen: Ich sehe noch die drei Apfelbäume vor dem Haus: Sie schienen zusammengeschrumpft, waren völlig entblättert, aber sie trugen herrlich rote Äpfel, wie wir sie in der Schule zeichneten. Ein ganzes Jahr sind wir dort geblieben: Die Ersten, die wegmussten, sind dann die drei kümmerlichen Bäume gewesen mit ihren roten Früchten. Ich kann mich an gar nichts Schöneres erinnern als an das lange, lange Zimmer, wo wir uns zum ersten Mal gesetzt haben, um zusammen zu essen und zu plaudern; vielleicht erinnere ich mich so gut daran, weil ich damals wirklich glaubte, noch einmal von vorn zu beginnen, in einer neuen Stadt, mit meinem Koffer voll von frisch gebügeltem und gestärktem Zeug. Und später, als vieles in unserem Leben mir wieder wehgetan hatte, war mir das Zimmer noch lieber geworden.
Die Decke war sehr niedrig, aber man merkte es nicht, weil wir da so hoch im obersten Stockwerk schwebten und mit all dem Himmel durch die lange Fensterfront das Licht der ganzen Stadt für uns hatten. Wegen dieser langgestreckten Form hatten wir unseren Aufenthaltsraum schon gleich das erste Mal «den Zug» genannt; wir sagten zu unseren Freunden: «Kommt doch herauf, in den Zug», wie wenn wir sie zu einer Reise einladen würden; man sah auch den Fluss unten, nur ein winziges Wassergeblinzel zwischen den Bäumen, aber es gab es doch, darauf kam es an, es war wie die Unterschrift unter einem Bild.
Unser Zug wirkte noch länger, weil er fast durchwegs von einem Ende zum andern mit Balken unterteilt war, klotzigen Tannenstämmen, senkrecht und schräg im Zickzackmuster vom Fußboden bis zur Decke, auf die sich Gianni, ein bisschen krumm wie er war, gern mit bergauf hochgelagerten Beinen verkroch, um seine Pfeife zu rauchen. Auf der einen Seite des Balkenwerks war der Boden eine Stufe höher, so dass wir erster und zweiter Klasse fuhren: Die erste war der tiefer gelegene Teil mit Fenstergalerie, wo wir alle Wollkissen ausgebreitet hatten, die uns von der Mutter geschenkt worden waren; in der zweiten drüben musste man auf dem Boden sitzen.
Wir hätten alle unsere Freunde über Nacht beherbergen können, Bethli und Fredi, die beiden kleinen Tessiner, Gino und die anderen Freunde in Italien, wenn wir genügend Matratzen gehabt hätten, um sie reihenweise wie in einem Massenlager unterzubringen.
Für uns zwei hatten wir vorn und hinten am Zug zwei angehängte Stübchen, beide nicht viel größer als ein Bett; an meiner Tür waren unten Löcher ausgeschnitten, vier runde Glotzaugen, durch die ich vom Bett aus sah, ob im Zug das Licht brannte. Die elektrischen Einrichtungen hatte Gianni besorgt: Mit seinem Autofimmel, wie früher als Kind, als wir noch zusammen in einem Zimmer schliefen, hatte er an allen Ecken und Enden Autolampen und Scheinwerfer aufgestellt, die den Raum nur zu grell beleuchteten. In der Küche war alles Nötige, sogar eine Dusche hinter dem Vorhang.
Wenn wir abends mit unseren Freunden auf den Kissen der ersten Klasse saßen und miteinander plauderten, kam es vor, dass Bethli sich in die Küche verzog und duschte. Dann mussten wir, um weiterzureden, mit unseren Stimmen das Wasserrauschen übertönen, das trotz verschlossener Türen Palmolive-Seifenbläschen über unsere Worte versprühte. Wir unterhielten uns auf Italienisch, weil Gianni und ich zu wenig Deutsch konnten. Gino, der Älteste unter uns, war für alle, auch weil er schon ein bisschen Bauch ansetzte, wie der große Bruder; es gab Dinge, die er eher als die andern sagen durfte: Und an einem der ersten Abende, als Bethli sich hinter dem Vorhang zu schaffen machte, hatte er ihr auf Deutsch zugerufen, ob sie Hilfe brauche. Bethli hatte so getan, als höre sie nicht, und hatte ins Plätschern und Gluckern hinein zu singen angefangen.
Damals wusste ich noch wenig von Bethli: Sie arbeitete in der gleichen Firma wie mein Bruder, zusammen mit Gino, der eine höhere Stellung hatte und besser als die andern verdiente, und mit den beiden Tessinern (sie war es dann, später, die auch Fredi zu uns brachte, einen Studenten aus Aarau). Ich wusste, dass ihre Familie nach St. Gallen verzogen war und dass sie zurzeit hier allein lebte, ohne Dusche. Sie machte viele Fehler, wenn sie mit uns redete; es war ein Schul-Italienisch, das aus lauter Adverbien, Ausnahmen, Pronomen bestand; sie sagte: «Gianni andrà lontanamente», «io voglio restare svegliata», «mio amico non viene», «nostri bambini andono a scuola con sette anni»; aber sie hatte viel Mut und eine große Lust, die fremde Sprache zu sprechen, was uns dagegen fürs Deutsche abging.
Mir gefielen ihre Fehler, sie wurde dadurch ein wenig unvertraut und noch abenteuerlicher; wie ihre Kleider, die immer ein bisschen zu knapp waren, gehäkelt, gestrickt, mit besonderen Glasknöpfen als Garnitur, die Gianni nicht ausstehen konnte; und auch ihre Schmucksachen mochte er nicht leiden, die ebenfalls, so behauptete er, alle hausgemacht waren, sonntags früh auf dem Jungfraujoch mit dem Pickel herausgeschlagene Steine und Steinchen, an einer Kette aufgehängt. Gianni konnte nicht begreifen, dass ein Mädchen in ihrem Alter stundenlang gebannt vor den Schaufenstern der Konditoreien stehen bleiben konnte, um die Häuschen aus Schokolade zu betrachten, mit dem Schornstein und der Tür aus kandiertem Zucker und Hänsel und Gretel aus rosarot-grünem Marzipan; und dass sie dann sogar imstande war und uns so was schenkte: Lebkuchenherzen mit einem Gebet darauf, einem Spruch oder was es immer sein mochte, «Zweifle nie an mir, mein Herz gehört nur dir», alles in gotischer Schrift, und rundherum ein Kranz von gotischen Blümchen.
«Alles Krimskrams, alles Kindereien, Bambinate, Bambinathli», fluchte Gianni, wenn sie wieder gegangen war, «was kümmert es mich schon, dass sie den Sommer lieber hat als den Frühling, dass die Astern ihr nicht gefallen? Was braucht man das den Leuten zu erzählen?»
Und ich merkte dabei, dass er immer hingehört hatte, während er so tat, als sei er in die «Automobil-Revue» vertieft, noch aufmerksamer als ich, obwohl Bethli, wie er sagte, ihm auf die Nerven ging. Ich trug den Krimskrams, die bunten Steinchen, in mein Stübchen hinüber, wo schon kein Platz mehr war, und wenn ich wusste, dass Bethli zu Besuch kam, trug ich mindestens zwei von den Herzen wieder zurück auf das Fensterbrett der ersten Klasse. Jedes Mal wunderte ich mich aufs Neue, dass Bethli kleiner war als ich; denn wenn sie nicht neben mir stand, sah ich sie immer nur voller, auffälliger als mich selbst, wobei aus ihr irgendwas weitersprach, auch wenn sie schwieg: Ein Gesicht, einen Ausdruck hatten auch ihr dichtes Haar, ihre Arme, der Bauch in dem ein wenig zu eng anliegenden Rock: alles andere als eine Bohnenstange in Hosen. Wenn sie mit einer schweren Gebärde der Hand bis hin in die Nackenbeuge die Haare zurückwarf, ging ihr plötzlich ein großes, breites, glattes Gesicht auf, das ganz aus waagrechten, erstaunlich ruhig fließenden Linien bestand: ein Gesicht, das auf einmal erwachsen war, vielleicht das Gesicht ihrer Mutter, heimlich herangereift unter dem Honighaar. Ein so weites Gesicht hatte ich nur in dem von Fabio entdeckt, wenn er mir den Kopf in den Schoß legte: Sitzend sah ich so von oben, unmittelbar vor mir, wie sich ihm in einem jähen Wunder die Stirn, die Augen, die Lippen abflachten, süß und besänftigt entglitten in ein gelöstes Gesicht ohne Umriss.
Das erste Mal, als sie uns mit Fredi bekanntmachte, hatte ich mich gefragt, ob sie ein Paar wären; ich weiß noch, wir waren damals zum Essen in die Stadt gegangen, Bethli mit uns beiden: Fredi sollte später zu uns stoßen. Wir warteten auf ihn in einem großen Lokal, wo es nach Zigarre roch, mit einer Drehtür und grünen Jassteppichen auf den Tischen, und viele massige Männer spielten wortlos Karten und brachen dann plötzlich in heftiges Geschrei und Husten aus. Die Kellnerinnen, alle mit dem vorgewölbten weißen Spitzenzünglein der Schürze über der Geldbörse, hatten nicht viel zu tun, aber sie sahen müde aus, lehnten sich mit der Hüfte und dem Ellbogen an die Theke, plauderten miteinander und behielten dabei die Kartenspieler im Auge, die immer wieder mit einer angedeuteten Bewegung, indem sie das leere Glas in die Höhe hoben, ein weiteres Bier, die dritte oder vierte Stange bestellen konnten. Eine nicht mehr ganz junge war darunter, die während der ganzen Zeit, als wir auf Fredi warteten, sich mit dem Finger in den Ärmelausschnitt des schwarzen Pullovers aus und ein fuhr, teilnahmslos im Takt wie ein Pendelchen, das die Minuten schlug. In der Mitte des Raumes saß an einem runden Tisch, dem Vater gegenüber, ein schwachsinniger aufgeschwommener Junge, mit Händchen und einer Fistelstimme wie ein Neugeborener; es war ihm vermutlich beigebracht worden, er solle keinen Zucker essen und seine Schachtel Assugrin bei sich haben: Denn er hatte dem Vater die Zuckerwürfel für den Tee hinübergereicht und dann mit unsäglicher Aufmerksamkeit die Tablettchen aus der Dose genommen und ins Glas fallen lassen (den Tee servierten sie für gewöhnlich in unzerbrechlichen Glasbechern, ähnlich wie die zum Zähneputzen).
Fredi, der damals für uns noch Herr Senn hieß, hatte mich, so lang er war, mit einer derart tiefen Verbeugung begrüßt, dass ich meinte, er küsse mir die Hand; und da ich nicht recht wusste, wie das bei einem Handkuss vor sich ging, fragte ich mich dann noch eine ganze Weile, ob er es vielleicht doch wirklich getan hatte. Wir waren zum Essen in einen Nebenraum hinübergewechselt, eine verwinkelte Puppenstube mit vielen kleinen Tischen, alle gedeckt und mit Blumen und brennenden Lämpchen in den Fensternischen; und hier nun bedienten uns Kellner, fast alles Italiener. Mein Bruder schwieg, er war vielleicht verärgert, dass er sich nicht wie Herr Senn zum Essen umgezogen hatte: Er sah älter aus, machte ein Gesicht à la Po-Ebene, eine trockene undurchdringliche Miene, und ließ die Schultern hängen wie unser Vater auf den Fotografien; ich mochte es sogar gern, wenn Gianni so finster war: Er kam mir dann viel erwachsener vor als ich, wie ein Schatten, der uns alle stumm bemitleidete: Er rieb sich die Stirn und die Augen, als ob er die Gedanken verscheuchen wollte, die in seinem Innern mahlten, und daraus hervor tauchte dann ein fahles fliehendes Gesicht wie ein Nieskrampf, ausgehöhlt in den Augen, die düsterer als ein Abgrund wurden. So war es jenen Abend an mir zu reden: Herr Senn nämlich richtete dauernd Fragen an mich, vielleicht auch nur aus Höflichkeit: Er redete zu laut, ganz erregt vor Wagemut, Sätze in einer fremden, im Grammatikbuch gelernten Sprache nun von sich zu geben: Was er sagen wollte, lief durch ein Übersetzungsmaschinchen und kam wie gedruckt heraus, so dass ich bei meinen Antworten das Gefühl hatte, nicht mit ihm zu reden, sondern ein Formular auszufüllen. (Aber dann flocht er gern bei jeder Gelegenheit «lo giuro, lo giuro» ein, ich schwöre es, wie ein geborener Italiener, und wiederholte es sehr unbefangen, vermutlich um sich vor Bethli aufzuspielen.) Er hatte eine blonde Haarsträhne, die ihm in die Stirn fiel, und schöne Musikerhände: Ich stellte ihn mir an dem Abend als kleinen Jungen vor, wie die Schüler, die Schweizer, denen ich jeden Morgen unterwegs begegnete: schmächtig, mit einem Haarbüschel in der Stirn und ernstem Blick hinter der Brille hervor, in der Hand den Geigen- oder Cellokasten. Zu Bethli sprach er immer schweizerdeutsch, rasend schnell und mit ganz anderer Stimme: Ich versuchte zu erraten, was zwischen ihnen war, ob Zärtlichkeit, heimliches Einverständnis oder sonst was. Was sie sich wohl schon gesagt, wie sie einander kennengelernt, ob sie eifersüchtig waren, welche Erinnerungen sie miteinander hatten. Mir wäre es komisch vorgekommen, so einen Freund zu haben, mit Haaren wie ein Junge und der dazu noch deutsch spricht: der mir vielleicht die Hand geküsst hätte, bevor er mir einen dicken glänzenden Ring an den Finger ansteckte. (Aber hatten sie dann den Ring, so wusste ich schon, wie sie sich die Finger drückten: Täglich traf ich sie in der Bahn, die Pärchen halbwüchsiger Verlobter, die sich an allen vier Händen gepackt hielten, wie mit Zangen so fest für immer, für immer.)