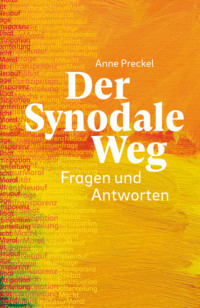Kitabı oku: «Der Synodale Weg - E-Book», sayfa 2
Weihe und Macht
Zur Sprache kommen soll im Macht-Forum auch die Frage, inwieweit Leitungsgewalt und Entscheidungsmacht notwendig an eine Weihe geknüpft sein müssen. Nach dem bisherigen Modell sind es vor allem Bischöfe, denen in vielerlei Hinsicht Macht zugesprochen wird. Hier könnte man Kompetenzen und Verantwortlichkeiten auf mehrere Köpfe, insbesondere Laien, verteilen. In einer Audienz für Mitarbeiter des vatikanischen Laien-Dikasteriums befürwortete der Papst im November 2019 zum Beispiel erstmals auch die Besetzung von Spitzenämtern der Kurie mit Frauen. (5) Diese Ämter sind im Vatikan bislang fast ausschließlich von Erzbischöfen oder Kardinälen besetzt.
Päpstliche Kritik des Klerikalismus
Dass die Machtfrage in der katholischen Kirche heute mit Nachdruck gestellt wird, kann sicher nicht getrennt von Papst Franziskus gesehen werden. Regelmäßig übt er Kritik am Klerikalismus, womit der Papst die Selbstüberhöhung und Überlegenheitsgefühle mancher Kleriker gegenüber Laien meint. Unvergessen ist seine Weihnachtsansprache an die Römische Kurie, in der er 15 kuriale Krankheiten benannte und den Kardinälen ins Gewissen redete. (6)
Auch den Zusammenhang zwischen Machtmissbrauch und sexuellem Missbrauch hat der Papst benannt. Sexueller Missbrauch sei „immer die Folge von Machtmissbrauch, der Ausbeutung der schwächeren Position der wehrlosen missbrauchten Person, welche die Manipulierung ihres Gewissens und ihrer psychischen und körperlichen Schwachheit ermöglicht“, sagte er im Februar 2019 bei einer internationalen Kinderschutzkonferenz im Vatikan. (7)
Worum geht es im Forum Sexualmoral?
Unter dem Titel „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualmoral und Partnerschaft“ sollen in diesem Forum Fragen der kirchlichen Sexualmoral behandelt werden. (1) Hintergrund ist der Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche in Fragen der Sexualmoral in Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen und zweitens die schon länger beklagte Kluft zwischen der kirchlichen Lehre und dem Leben der Gläubigen.
„Der Vorwurf lastet schwer, die Kirche genüge ihren eigenen hohen moralischen Ansprüchen nicht“, heißt es im Arbeitspapier der vorbereitenden Gruppe mit Blick auf die Fälle sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Immer weniger Menschen trauten der Kirche nach den Missbrauchsskandalen überhaupt noch ein Urteilsvermögen in Fragen der menschlichen Sexualität zu.
Empfängnisverhütung, außerehelicher Sex, wiederverheiratete Geschiedene und Homosexualität
Eine Kluft zwischen Lehre und Leben zeige sich heute besonders hinsichtlich Fragen der Empfängnisverhütung, des außerehelichen Sex, der wiederverheirateten Geschiedenen und der homosexuellen Partnerschaften, heißt es weiter. Kardinal Reinhard Marx formulierte dazu im Vorfeld des Synodalen Weges: „Die Sexualmoral der Kirche hat entscheidende Erkenntnisse aus Theologie und Humanwissenschaften noch nicht rezipiert. Die personale Bedeutung der Sexualität findet keine hinreichende Beachtung. Wir spüren, wie oft wir nicht sprachfähig sind in den Fragen an das heutige Sexualverhalten“. Die Moralverkündigung gebe der überwiegenden Mehrheit der Getauften keine Orientierung. (2)
Im Umgang mit und der Bewertung von Homosexualität hat Papst Franziskus seit seinem Amtsantritt eine gewisse Offenheit gezeigt. Es wandte sich im Jahr 2013 gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Homosexuellen. Auf seinem Rückflug vom Weltjugendtag in Brasilien sagte er vor Journalisten: „Wenn einer homosexuell ist und Gott sucht und guten Willen hat – wer bin dann ich, ihn zu verurteilen?“ (3) Gleichwohl lehnt die katholische Kirche auch unter Franziskus eine gelebte Homosexualität und die gleichgeschlechtliche Ehe ab. (4)
Das Vorbereitungsforum zum Thema Sexualmoral war sich bei der Frage, ob es eine neue kirchliche Sexualmoral braucht, nicht ganz einig, wie aus seinem Arbeitspapier hervorgeht. Eine Mehrheit der Teilnehmer hielt es für notwendig, die bisherigen Normen grundsätzlich zu überprüfen. Wogegen ein anderer Teil forderte, sie müssten heute lediglich plausibler erklärt und vermittelt werden. Dementsprechend unterschiedliche Antworten gaben die Teilnehmer hinsichtlich konkreter Fragen der Sexualität und des Umgangs mit Sexualität. Uneins war man sich zum Beispiel bei der Frage der sexuellen Selbstbestimmung und hinsichtlich einer Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.
Evangelii gaudium und Amoris laetitia
Für die Vorbereitung des Gesprächsforums zum Thema Sexualmoral wurden Ergebnisse von Befragungen einbezogen, die Papst Franziskus im Vorfeld der beiden Weltbischofssynoden zum Thema Ehe und Familie von 2014 und 2015 weltweit unter Gläubigen durchführen ließ. Es war das erste Mal, dass der Vatikan auf diese Weise Meinungen der Gläubigen in die Vorbereitung einer Synode einbezog. (5) Auch stützte sich das Vor-Forum zur Sexualmoral auf die beiden Schreiben von Papst Franziskus „Evangelii gaudium“ (2013) und „Amoris laetitia“ (2016). In „Evangelii gaudium“ hatte er dazu ermutigt, das Evangelium nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Frische und Freude zu vermitteln. (6) In „Amoris laetitia“ hatte der Papst betont, dass das Gewissen der Gläubigen bei Fragen der Ehe und Familie ernster genommen werden müsse. (7)
Worum geht es im Priester-Forum?
Sendung aller Gläubigen
Die Aufgaben, das Amt und die Lebensform der Priester in der heutigen Zeit sind ein Schwerpunkt des Forums „Priesterliche Existenz heute“. Allerdings legte das vorbereitende Forum Wert darauf, die priesterliche Existenz „nicht als Stand, sondern nach den Kriterien der Evangelisierung“ zu behandeln und grundsätzlich über die Sendung aller Gläubigen in einer säkularer werdenden Gesellschaft zu sprechen. (1) Der Ansatz ist hier, dass Priester ebenso wie nicht geweihte Gläubige Wege finden müssen, um auf den Glaubensschwund und die Krise der Kirche zu reagieren.
Zölibatäre Lebensform
Gleichwohl waren im Kontext des Missbrauchsskandals gerade klerikale Lebensformen und Ämter problematisiert worden. Mit Blick auf die katholischen Geistlichen war von Schwierigkeiten mit der eigenen Sexualität und dem Zölibat sowie Amtsmissbrauch die Rede gewesen. (2) „Wir wissen, dass die Lebensform der Bischöfe und Priester Änderungen fordert, um die innere Freiheit aus dem Glauben und die Orientierung am Vorbild Jesu Christi zu zeigen“, formulierte Kardinal Marx im Vorfeld des Synodalen Weges: „Den Zölibat schätzen wir als Ausdruck der religiösen Bindung an Gott. Wie weit er zum Zeugnis des Priesters in unserer Kirche gehören muss, werden wir herausfinden.“ (3) Im Vor-Forum zur priesterlichen Existenz wurde dann unter anderem die Frage formuliert, ob der Zölibat die allein angemessene Lebensform der Priester sei.
Ausbildung und Rollenbild
Weitere Fragen, die beim Synodalen Weg mit Blick auf die Priester zur Sprache kommen sollen, beziehen sich auf die Ausbildung und Eignung, persönliche Reife und Identität sowie den Umgang mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Zudem soll es um das Rollenbild der Priester und das Verhältnis von Sakramentalität und Macht gehen. Dabei soll überlegt werden, wie einer Selbstüberhöhung und einem Machtmissbrauch im Priesteramt vorgebeugt werden kann.
Heutiges Berufsbild der Priester
Alltag und Berufsbild der Priester haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Priester müssen heute nicht nur Seelsorger sein, sondern in ihrem Alltag oft auch als Manager und Vermittler auftreten. Sie sind selten nur noch für einzelne Gemeinden zuständig, sondern müssen sich um Großpfarreien kümmern, die vielfältige Herausforderungen mit sich bringen. Für die Priester bedeutet dies oft eine Zerreißprobe, Frust und Erschöpfung. Hinzu kommt, dass die Strukturreformen bei vielen Gläubigen umstritten sind, die damit ein Ende der Seelsorge und die Abschaffung der Kirche vor Ort vorhersehen. (4) Eine weitere Frage, die deshalb beim Synodalen Weg thematisiert werden soll, ist die Amtsfrustration: Wie und wo ließe sich das priesterliche Leben besser gestalten? Hier ließe sich etwa über gemeinschaftliche Lebensformen von Geistlichen sowie neue Formen der Gemeindeleitung sprechen.
Frauenpriestertum kein Thema
Die Teilnehmer des Vor-Forums waren im Grundsatz uneins darüber, ob das Priesteramt auch für Frauen gedacht werden kann. Deshalb verweisen sie bei dieser Frage auf das Frauen-Forum beim Synodalen Weg, wo dieses Thema zur Sprache kommen soll.
Worum geht es im Frauen-Forum?
Rolle der Frau in der Kirche
Das Forum „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ stellt die Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche. (1) Dazu sollen auf dem Synodalen Weg konkrete Vorschläge erarbeitet werden, wie Frauen stärker an der Kirchenleitung beteiligt werden können. Bereits existierende Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des Kirchenrechtes müssten sichtbarer gemacht und verbindliche Verabredungen dazu getroffen werden, heißt es im Arbeitspapier der vorbereitenden Arbeitsgruppe.
In diese Richtung zielt etwa das Mentoring-Programm für Frauen, dass die Deutsche Bischofskonferenz seit 2015 in Zusammenarbeit mit dem Hildegardis-Verein für die Erzbistümer durchführt. (2) Bei dem Förderprogramm geht es um alle Ämter, die nicht an ein Weiheamt geknüpft sind. Ein hohes Amt, in das in den letzten Jahren immer mehr Frauen aufsteigen, ist zum Beispiel das der Seelsorgeamtsleiterin.
Zugang von Frauen zu Weiheämtern
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hatte ein Frauen-Forum für den Synodalen Weg ursprünglich vorgeschlagen; und zwar unter dem Titel „Zugang von Frauen zu Weiheämtern“. Auch wenn dieser Titel abgeändert wurde, soll beim Synodalen Weg auch das Thema Weiheämter für Frauen besprochen werden. Wie aus dem Arbeitspapier der Vorbereitungsgruppe hervorgeht, sollen Begründungen des Ausschlusses von Frauen von den Weiheämtern unter die Lupe genommen und theologische Gegenargumente angehört werden. Unter den geladenen Experten, Theologen und Kirchenrechtlern sollte, so war es ursprünglich geplant, auch die deutsche Theologin Marianne Schlosser sitzen. Aufgrund der Frage der Frauenordination ist Schlosser jedoch auf Distanz zum Frauen-Forum gegangen. Für sie ist eine Weihe von Frauen zum Priesteramt ausgeschlossen und lehramtlich abschließend geklärt. (3)
Eine „Nagelprobe“ für den Reformwillen
In der öffentlichen Wahrnehmung sei die Frauenfrage eine „Nagelprobe“ für die Authentizität des Reformwillens der katholischen Kirche, hält das Vorbereitungsforum grundlegend fest. (4) Es gehe um die Zukunft der römisch-katholischen Kirche, gingen der Institution doch gerade immer mehr Frauen verloren. Zudem seien mit dem Thema der Evangelisierungsauftrag, die Glaubwürdigkeit der Kirche und Fragen der Gerechtigkeit berührt. Papst Franziskus habe in seiner Schrift „Evangelii gaudium“ (2013) betont, es brauche Frauen an Stellen, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden: es gebe also Raum für weitere Entwicklung.

Ist der Synodale Weg eine Synode oder ein Konzil?
Offiziell nicht. Allerdings war nach der Ankündigung des Projektes ein Streit darüber entbrannt, was unter dem Begriff „verbindlicher Synodaler Weg“ denn nun eigentlich zu verstehen sei. Das liegt daran, dass es für Beratungen und Entscheidungen in der katholischen Kirche eine Reihe von Versammlungsformen mit jeweils unterschiedlicher Verbindlichkeit gibt. Diese folgen bestimmten Regeln und Abläufen und sind im Kirchenrecht genau festgelegt. Auf Weltkirchenebene gibt es zum Beispiel Bischofssynoden, die den Papst zu bestimmten Themen beraten. Wenn hingegen auf Ebene der Kirche eines bestimmten Landes Bischöfe zu Beschlüssen zusammentreten, wird dies Partikularkonzil oder auch Nationalkonzil genannt. Damit deren Vorschläge oder Beschlüsse rechtskräftig werden können, müssen sie in der katholischen Kirche grundsätzlich vom Papst abgesegnet werden.
Die bisherigen Formate passten für den Synodalen Weg alle nicht, und je mehr man über das Projekt erfuhr, desto verwirrender wurde es: Hatte das Ganze nicht den Zuschnitt eines Konzils? Wie verbindlich sollte es werden? Ging es nur um Beratungen oder auch um Entschlüsse? Diese Diskussion schlug ebenso in der Weltkirche Wellen.
Kardinal Marx bemühte sich in der Vorbereitungsphase des Synodalen Weges um eine Eingrenzung. Der Synodale Weg sei „keine Synode im klassischen kirchenrechtlichen Sinn“, die Veranstaltung bewege sich „aber auch nicht außerhalb des Kirchenrechts“, erklärte er Journalisten. (1) Die deutschen Bischöfe hätten für den Reformdialog bewusst keines der üblichen Formate gewählt, man wolle den Synodalen Weg als „eigenen Prozess“ verstanden wissen, erklärte er dem Vatikan. (2) Warum diese Vagheit? Das wurde einen Monat vor dem offiziellen Startschuss deutlich: „Eine Synode bedarf der Zustimmung durch den Heiligen Stuhl, die oft erst nach einem längerfristigen Verfahren erteilt werden kann. Das verlangsamt das notwendige Tempo in der Behandlung der anstehenden Fragen“, schrieb die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer Homepage. (3)
Zwischen Synode und Gesprächsprozess
Angesichts der tiefen Krise der deutschen Kirche sollte möglichst schnell über alles geredet werden, ohne Einschränkungen, ganz offen. Zugleich wollte man wohl auch jene Bischöfe mit ins Boot holen, die der ganzen Reformdebatte eher skeptisch gegenüber eingestellt waren. Auf der DBK-Internetseite wiesen die Veranstalter das Projekt schließlich als Mischform aus: Der Synodale Weg bewege sich „als Format zwischen einer Synode und einem Gesprächsprozess“. (4)
Im Klartext heißt das: Es soll nicht nur geredet werden, sondern Bischöfe und Laien sollen auch zu gemeinsamen Beschlüssen gelangen. Ob und wie diese umgesetzt werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt. So ordnete der deutsche Theologe und Professor für Kirchenrecht Georg Bier die Beschlüsse des Synodalen Weges im Vorfeld eher als Empfehlungen ein. „Je mehr Leute hinter diesen Voten stehen, umso höhere moralische Verbindlichkeit haben sie“, sagte Bier: „Aber auch eine noch so hohe Zustimmungsquote genügt nicht, um einen Bischof rechtlich verbindlich dazu zu bringen, sie umzusetzen. Rechtswirkung erlangen die Voten nur durch die Inkraftsetzung der einzelnen Bischöfe. Das widerstrebt zwar dem demokratisch geprägten Verständnis der Gesellschaft – aber so funktioniert die Kirche.“ (5)
Keine Entscheidungen über grundlegende Fragen
Darüber hinaus gibt es beim Synodalen Weg hinsichtlich der Entscheidungsprozesse eine Einschränkung, die mit den verhandelten Themen zusammenhängt. Über grundlegende Fragen, die die ganze Weltkirche betreffen, wie den Zölibat oder die Frauenordination, kann die Teilkirche Deutschland sich zwar einigen, aber nicht entscheiden. Allein der Papst kann hier die Weichen neu stellen. Der Synodale Weg der deutschen Kirche will dieses Prinzip nicht in Frage stellen, wie die Veranstalter mehrfach betonten.
Ist der Synodale Weg wieder ein Gesprächsprozess?
Bereits zwischen 2011 und 2015 haben sich Bischöfe und Laien in Deutschland landesweit zusammengesetzt, um über Herausforderungen ihrer Kirche zu sprechen. In der Tat nennt die Deutsche Bischofskonferenz diesen „Überdiözesanen Gesprächsprozess ‚Im Heute glauben‘“ als einen Wegbereiter des Synodalen Weges. (1)
Gesprächsprozess und Glaubwürdigkeit
Ähnlich wie auch beim Synodalen Weg ging es beim Gesprächsprozess darum, die Kirche wieder glaubwürdig zu machen. (2) Begonnen wurde der Prozess noch unter dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, beendet unter Kardinal Reinhard Marx. An den bundesweiten Dialogtreffen nahmen Bischöfe und Laien, Vertreter katholischer Verbände und verschiedener Berufsgruppen der Kirche teil.
Reaktion auf sexuellen Missbrauch
Schon mit dieser Reihe an Treffen hatten die Bischöfe versucht, auf das Problem des sexuellen Missbrauchs in der deutschen Kirche zu reagieren. Dabei ging es jedoch vorrangig um die „gestörte Kommunikation“ zwischen Klerus und Laien, die man verbessern wollte; nicht um kirchliche Strukturreformen. Nachdem der Jesuitenpater Klaus Mertes im Jahr 2010 Fälle sexualisierter Gewalt am Berliner Canisius-Kolleg bekanntgemacht hatte und immer mehr Betroffene an die Öffentlichkeit traten, hatten sich Gräben in der Kirche aufgetan. Austritte und Generalverdacht war die Rechnung, die viele Gläubige der Institution ausstellten.
Vor diesem Hintergrund ging es den Bischöfen um Schadensbegrenzung: „Wir sehen die reale Gefahr, dass wir uns in unserer Kirche so zerstreiten, dass Brücken abgebrochen und bestehende Einheit aufgegeben wird. Auf Barrikaden aber lässt sich bekanntlich schlecht miteinander reden“, schrieben sie in einem Brief an die Gemeinden. (3) Die Glieder der Kirche müssten wieder zusammengeführt werden und sie luden das Kirchenvolk zum Gesprächsprozess ein.
Gesprächsthemen
Worüber wurde gesprochen? Weniger über kontroverse Themen wie Zölibat oder Sexualmoral als vielmehr über kirchliche Erneuerung allgemein. So ging es etwa um die „gemeinsame Verantwortung aller Getauften in der Kirche“, das „erneuerte christliche Zeugnis in unserer Gesellschaft“ und das „geschwisterliche Miteinander von Frauen und Männern in der Kirche“; um ein paar Themenbeispiele zu nennen. (4)
Erfahrungen aus Gesprächsprozess
Vielen Menschen war das rückblickend nicht konkret genug; sie hätten sich angesichts des Missbrauchsdebakels mindestens ein paar bindende Beschlüsse gewünscht. Aus diesem Grund sind nach der Erfahrung des Gesprächsprozesses bei vielen Gläubigen die Erwartungen an den Synodalen Weg hoch. Sabine Demel, Professorin für Kirchenrecht in Regensburg, bemängelte in einem Interview, dass beim Gesprächsprozess letztlich „alles im Unverbindlichen geblieben ist“. Mit Blick auf die Struktur ist ihr Hauptkritikpunkt, dass es „keine transparente, geschweige denn gemeinsam erarbeitete Verfahrensordnung über die Steuerungs-, Planungs- und Themenkompetenz“ gegeben habe. (5)
Auch Kardinal Marx sieht die Unverbindlichkeit des Gesprächsprozesses rückblickend als falsch an: „Das machen die Leute nicht mehr mit, da war eine große Unzufriedenheit“, sagte er bei Ankündigung des Synodalen Weges im März 2019 in Lingen. (6) Der Synodale Weg soll also auf Augenhöhe stattfinden und zu gemeinsamen Beschlüssen führen; die Satzung des Reformweges ist dafür die formale Grundlage.
Ist der Synodale Weg eine zweite Würzburger Synode?
Als einen weiteren Wegbereiter des Synodalen Weges nennen die deutschen Bischöfe die Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland, also der westdeutschen Bistümer, die von 1971–1975 im Würzburger St.-Kilians-Dom stattfand und deshalb auch „Würzburger Synode“ genannt wird. (1)
Approbierte Synode durch den Vatikan
Diese historische Synode, die vom Vatikan abgesegnet war, veränderte das Gesicht der Kirche nachhaltig. Ihre Beschlüsse prägen die kirchliche Struktur und Seelsorge in Deutschland bis heute. Fünf Jahre lang rangen Laien und Bischöfe in Würzburg um eine Erneuerung der Kirche, darunter eine stärkere Mitsprache der Laien. Im Großen ging es um die Umsetzung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965), das einen Wandel in der Weltkirche eingeleitet hatte. Diese Aufbruchsstimmung schlug sich in Deutschland in lebhaften Debatten nieder, unter Eindruck der 68er-Bewegung brodelte es im Kirchenvolk; kontrovers wurde zum Beispiel über Sexualmoral und Empfängnisverhütung sowie wiederverheiratete Geschiedene diskutiert.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.