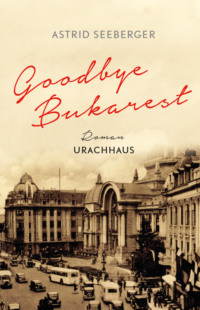Kitabı oku: «Goodbye, Bukarest», sayfa 3
Dmitri und seine Mutter landeten in Galitsch, einer Kleinstadt am Galitschsee, fünfhundert Kilometer nordöstlich von Moskau. Der See war eine Eisfläche, umgeben von dunklen Wäldern. In klaren Nächten waren die Sterne groß, mit Sternbildern, die die Menschen einst auf ihrem Weg geleitet hatten. Jetzt war nicht mal mehr ein Ausweg geblieben, sagte die Mutter einmal, was immer sie damit auch meinte. Tagsüber arbeitete sie in einer Holzfabrik, während er die Schule besuchte. Am Abend saßen sie in dem kalten Mietzimmer auf ihrer Bettkante und löffelten die lauwarme Kohlsuppe. Und sprachen ausschließlich Russisch miteinander. Vielleicht waren die Wände zu dünn. Oder das Deutsche tat zu weh.
Im Januar 1942 erhielten sie einen Brief. Wenn sie ihn wenigstens in Moskau bekommen hätten, und nicht in dieser gottvergessenen Stadt. Dmitris Vater war im Kampf um Moskau gefallen. Es half nichts, dass er als Held gestorben war. Auch nicht, dass man die Deutschen zurückgedrängt hatte. Die Mutter wurde von der Trauer mitgerissen, weg von Dmitri, weg von allem. Es half nicht einmal, dass er Mutti zu ihr sagte. Sie schaute ihn an, als wisse sie nicht mehr, wer er war, oder wer sie war.
Es begann nach dem Tod des Vaters, dass er immer wieder einen schrecklichen Traum hatte. Er fuhr mit einem Floß auf dem See. Das Wasser war still und blank. Plötzlich sah er seine Mutter mit ausgestreckten Armen am Seegrund liegen, und kleine rote Fische schwammen durch ihr Haar. Als er voller Angst aufwachte, musste er rasch aufstehen, um sich zu überzeugen, dass sie in ihrem Bett lag und atmete.
Anfang März durften sie nach Moskau zurückkehren. Die Wohnung war eiskalt, es gab kein Wasser, die Wasserleitungen des Hauses waren in der Kälte geborsten. Stalin auf seinem Gemälde starrte noch immer misstrauisch nach rechts. Während die Mutter dünn und blass vor ihm stand und auf Deutsch sagte: »Was sollen wir jetzt tun?«
Wäre wenigstens die Stadt dieselbe gewesen. Doch die Straßen waren leer, viele ihrer Einwohner waren noch nicht zurückgekehrt. Und die wenigen, die zu sehen waren, hatten Gesichter wie die Mutter: Wenn man weiß, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Lediglich die Verkäufer an den Straßenecken schienen an die Zukunft zu glauben und kassierten für jeden Zug aus einer Zigarette zwei Rubel.
Doch auch in Moskau gab es rettende Engel. Eine von Vaters Kolleginnen, eine Frau um die vierzig, die nie geheiratet hatte, Jefrossina Komarowa, war zu seiner Nachfolgerin bestimmt worden. Sie durfte die Direktorswohnung übernehmen, Dmitri und seine Mutter aber konnten bleiben. Sie wäre es gewohnt, beengt zu leben, sagte die Komarowa, hätte jahrelang mit ihrem Bruder und dessen Familie zusammengelebt.
Sie kam hereingestürmt und übernahm sofort das Kommando, eine kraftvolle Frau, trotz ihrer schmalen Gestalt, mit schwarzem kurz geschnittenem Haar, dunklen brennenden Augen und einem großen rot geschminkten Mund. Sie zog mit all ihren Büchern in Vaters Arbeitszimmer ein, während Vaters Bücher ins Wohnzimmer kamen. Sodass Stalin nun misstrauisch auf die gesammelten Werke von Hegel, Marx und Lenin starrte.
Und sie stellte ihr Radio neben das Porträt von Vater. Abend für Abend saßen sie dort beisammen, die Komarowa, Dmitri und seine Mutter, und lauschten den Frontberichten. Die Komarowa rauchte hektisch, als könnte der Rauch die Deutschen vertreiben. Während die Mutter mit einem Gesicht an ihrer Zigarette zog, als beneidete sie den Rauch, der sich auflöste und verschwand.
Manchmal blieben sie auch nach den Nachrichten am Radio sitzen. Wie an dem Abend, als einer von Moskaus bekanntesten Schauspielern ein Gedicht rezitierte, das, wie es hieß, die Offiziere der Roten Armee ihren Männern vortrugen, bevor diese in den Kampf zogen:
Dann töte einen Deutschen – töte ihn!
Töte ihn, sobald du kannst!
Jedes Mal, wenn du ihn siehst,
Töte ihn, töte ihn unbedingt!
Während der Rezitator noch sprach, mit einer Stimme, die vor Kampfeslust vibrierte, stand die Mutter auf und schloss sich in der Toilette ein. Vielleicht revoltierte ihr Magen, wie so oft nach Vaters Tod. Oder ihr war aufgegangen – woran auch Dmitri gedacht hatte –, dass sie ja Deutsche war, obwohl inzwischen Bolschewikin. Und dass er Halbdeutscher war, was er um nichts in der Welt sein wollte. Er sah die Komarowa an. Sie lauschte konzentriert, als wolle sie kein einziges Wort verpassen. Er konnte den Gedanken nicht loswerden, dass alles einfacher wäre, wenn sie seine Mutter wäre.
Es gab Gerüchte, dass die Komarowa ein Verhältnis mit einem ganz oben in der Partei hätte. Wieso bekam sie sonst einen ganzen Sack Kartoffeln direkt an die Tür geliefert? Oder eine Kanne Milch, die man in Moskau nur schwer beschaffen konnte. Oder ein ganzes Kilo Zucker zum Süßen des Tees. Er pfiff auf die Gerüchte. Für ihn war die Komarowa der beste Mensch, den es gab. Allein schon deshalb, weil sie alles mit ihnen teilte.
Sie gewann ihn für sich. Wurde seine Frossjenka. Während er immer öfter wütend auf seine Mutter wurde. Sie blieb weiter niedergeschlagen, obwohl es der Komarowa gelungen war, ihr Arbeit in einer Druckerei zu beschaffen. Vielleicht verstand seine Mutter, was er fühlte. Denn manchmal warf sie ihm einen Blick zu, als wäre sie ans Ende der Welt geraten, während er sich mitten in der Welt befand. Vielleicht gab sie deshalb alle Versuche auf, mit ihm Deutsch zu sprechen.
Ihm war es egal. Wo er doch Frossjenka hatte und Sascha, der sein bester Freund geworden war, ein schmaler, aufgeweckter Junge mit hellbrauner Igelfrisur und hitzigem Temperament. Sie hatten vieles gemeinsam: tote Väter, schweigende Mütter und Modellflugzeuge.
Manchmal gingen sie mit ihren Flugmodellen zu den Leninbergen. Wenn es Aufwind gab, flogen die Flugzeuge weit, über die Häuser weg, über den Fluss, vielleicht sogar bis nach Sibirien. Und Dmitri und Sascha rannten den Berg hinunter, mit ausgebreiteten Armen, als könnten sie jeden Augenblick selbst abheben.
Es ist merkwürdig, sagte Grünhoff, wie das Erinnern funktioniert. Vieles vergisst man. Doch was man noch weiß, ist fest im Gedächtnis geblieben, in allen Einzelheiten. Wie, als er eines Morgens ins Bad gekommen war und die Sonne durch das kleine Fenster schien. Sie beschien die Strümpfe der Mutter und die der Komarowa, die auf einer Leine über der Wanne hingen, lange, dünne beigefarbene Baumwollstrümpfe, die aussahen, als leuchteten sie von selbst. Und in ihm breitete sich etwas aus, ein intensives Glücksgefühl: Er hatte zwei Mütter und einen Freund, mit dem er sein Leben lang zusammenbleiben würde. Und für die Rote Armee lief es gut, Hitlers Wehrmacht aber war auf dem Rückzug. Er kam nicht einmal auf den Gedanken, dass auch das Glück sich zurückziehen konnte.
Es war an einem sonnigen Apriltag 1944. Sascha und er lagen auf den Leninbergen im Gras. Sein Freund hatte ihm ein Bild der amerikanischen Golden Gate Bridge gezeigt. Und sie hatten beschlossen, Brückenbauer zu werden. Sie würden die größte und schönste Brücke bauen, die es gab. Und dann mit ihrem eigenen Flugzeug darüberfliegen. Als er nach Hause kam, wartete die Komarowa auf ihn. Als er ihr Gesicht sah, verflog seine Hochstimmung sofort.
Sie wollte, dass sie sich zusammen aufs Sofa im Zimmer mit dem Stalin-Bild setzten. Als sie eine Zigarette aus dem Etui zog, sah er, dass ihr die Hände zitterten. Dann rauchte sie, als könnte jeder Zug ihr Leben retten. Er musste auf seine Hände schauen, um nicht in Panik zu geraten. Sie waren kleiner als ihre, die Hände eines Zwölfjährigen, mit Schmutz unter einem Daumennagel.
Er versuchte, den Schmutz zu entfernen. Das war besser, als dem zuzuhören, was sie sagte: dass seine Mutter in die Lubjanka gebracht worden war, das Hauptquartier des KGB am Dserschinski-Platz. Er wusste, wer dort hinkam: Konterrevolutionäre, die ins Netz der Geheimpolizei geraten waren und die hinterher bestenfalls in Sibirien landeten, manche aber verschwanden auf der Stelle vom Erdboden. Er konnte nur schwer atmen, der Hals wurde ihm plötzlich eng. Vielleicht ging es der Komarowa genauso. Es klang, als würden ihre Stimmbänder zusammengepresst, als sie sagte, er solle es wie ein Bolschewik nehmen. Er wusste, dass ein Bolschewik nicht weinte. Das Weinen aber kam doch, als die Komarowa ihn in die Arme nahm.
Hätte es Frossjenka nicht gegeben, wäre er völlig allein gewesen. Von der Familie des Vaters, die in Leningrad lebte, hatten sie nicht das geringste Lebenszeichen erhalten, selbst dann nicht, als die Stadt nach neunhundert Tagen Belagerung durch die Hitler-Wehrmacht befreit worden war. Vermutlich waren sie wie Hunderttausende anderer verhungert. Und die Familie der Mutter konnte er vergessen, sie gehörte der Feindesseite an. Frossjenka aber war da. Sie war seine zweite Mutter. Solange es sie gab, brauchte er sich vor nichts zu fürchten.
Vielleicht versuchte sie, ihre eigene Haut zu retten. Als sie ihn am nächsten Tag holten, griff sie nicht ein. Als er versuchte, sich an ihr festzuklammern, riss sie sich los und verschwand in ihr Zimmer. Und sie kam nicht heraus, obgleich sie seine verzweifelten Rufe gehört haben musste. Er schrie immer wieder ihren Namen, während man ihn wegschleppte. Erst viel später war ihm der Gedanke gekommen, dass sie vielleicht selber verzweifelt war. Wie soll man sich von jemandem trennen können, dessen Frossjenka man zwei Jahre lang gewesen war?
An die Zeit, die folgte, erinnerte er sich nur wenig, lediglich Fragmente waren geblieben: dass der Mann, der ihn verhörte, einen blitzenden Goldzahn hatte. Und dass die Zelle, in der er saß, eng und dunkel war. Und dass Schreie zu hören waren, die durch alle Wände drangen. Vielleicht stimmte es ja, was sie sagten: dass er eingestanden hatte, seiner Mutter bei ihrer antisowjetischen Agitation geholfen zu haben. Er erinnerte sich nicht. Auch nicht an die Fahrt nach Sibirien, zur Arbeitskolonie für Kinder. Nur daran, dass er geglaubt hatte ersticken zu müssen, als er, zusammengepfercht mit anderen Kindern, im Güterwaggon saß.

Grünhoff verstummte. Er strich mit den Fingern über die Tischfläche, während sich sein Blick in der Ferne zu verlieren schien. So habe er nie zuvor gedacht, sagte er, aber jetzt, wo ich vor ihm sitze, mit dem Wunsch, etwas über Bruno zu hören …
Da war ihm der Gedanke gekommen, dass Bruno, als er selbst dort im Güterwaggon saß, unterwegs nach Sibirien, noch immer als Pilot in Hitlers Wehrmacht diente. Während er dort eingesperrt saß, flog Bruno im großen, freien Luftraum umher. Hätte eine Rakete der Stalinorgeln nicht sein Flugzeug getroffen, wären sie sich nie begegnet.
Die Sonne war hinter den Kirschbaum gesunken. Der erstrahlte in vollem Glanz. Grünhoff aber sah es nicht. Man konnte glauben, er sitze noch immer in jenem Waggon. Er wirkte plötzlich ungemein müde. Ich fragte, ob er eine Pause einlegen wolle. Das wäre gut, sagte er. Könnte ich nicht morgen wiederkommen?
Dmitri Fjodorows
alias Hannes Grünhoffs Geschichte
Teil 2
Grünhoff saß auf der Terrasse, als ich kam. Auch heute schien die Sonne, und es war warm. Als ein Lüftchen durch den Kirschbaum wehte, rieselten Blütenblätter herab. Den Baum, sagte er, habe sein Onkel gepflanzt, als er aus dem Krieg heimgekehrt war und entdeckt hatte, dass der alte Kirschbaum nicht mehr existierte. Jemand hatte ihn abgesägt, jemand, der Feuerholz brauchte. Nun aber sei es wieder Zeit für Kirschen, hatte sein Onkel gesagt und einen Baum derselben Sorte gepflanzt.
Ich setzte mich an den Tisch ihm gegenüber. Sabine holte die Berliner Weiße. Und Grünhoff nahm einen Schluck, ohne zuvor anzustoßen. Er schien kaum zu bemerken, was er trank. Schaute nur auf die vor ihm liegenden Papiere, wo er notiert hatte, was er berichten wollte.
In Sibirien, sagte er, habe er oft an die Worte seines Vaters gedacht: dass man lerne, solange man lebe. Was aber lernt man in einem Strafarbeitslager? Dass es besser ist, zu stehlen und Leute umzubringen, als politischer Gefangener zu sein? Die Kriminellen unter den Jugendlichen waren die Nummer eins in der Hierarchie. Das Schlimmste war, dass ihr Anführer Sascha hieß. Als Dmitri an einem der ersten Tage von ihm verprügelt wurde, damit er begriff, wo sein Platz war, hätte er sich damit abfinden müssen. Sein Gegner war drei Jahre älter und bärenstark. Dmitri aber hieb mit aller Kraft zurück, als hätte Sibirien-Sascha seinem Freund den Namen gestohlen. Dann wurde alles schwarz um ihn. Er verlor das Bewusstsein, als sein Gegner mit einem vernichtenden Schlag reagierte. Als er wieder zu sich kam, wusste er, worauf das Leben im Arbeitslager hinauslief: Es galt, um jeden Preis zu überleben.
Und das war nicht leicht. Es gab ein Gesetz, das besagte, Kinder zwischen zwölf und sechzehn Jahren, die sich in Arbeitslagern befanden, dürften nicht mehr als vier Stunden am Tag arbeiten. Ebenso viele Stunden sollten sie in die Schule gehen. Und sich ausruhen können, damit sie den nächsten Tag bewältigten. Dmitri und die anderen Kinder aber mussten den ganzen Tag lang schuften. Erst abends durften sie die Schule besuchen, wenn sie nur noch eins wollten: sich auf ihre Pritsche legen, um im Schlaf allem zu entkommen.
Früh am Morgen marschierten die Kinder zur Ziegelei hinüber, die direkt neben dem Lager lag. Dmitri bekam einen frei gewordenen Platz in der Trockenmannschaft. Es gab Kinder – das lernte er rasch –, die zugrunde gingen. Die Trockenmannschaft nahm die Lehmziegel entgegen, die vom Walzwerk kamen. Und legte sie in die Trockenkisten. Die wurden auf einem Wagen in einen Raum gerollt, in dem sie trocknen sollten: der Raum, in dem die Brennöfen standen. Im Winter war er ein Paradies. Man konnte dort wohlig warm werden, wie in Moskau an einem heißen Sommertag.
Einer der Brennofenwärter, ein Mann mittleren Alters, der aussah, als hätte man ihn selbst zu Stein gebrannt, schien nur Augen für seinen Ofen zu haben. Nur einmal, als draußen ein Schneesturm tobte und Dmitri nicht anders konnte, als sich zum Brennofen zu schleichen, schaute der Brennofenwärter ihn an, genau wie er die Ziegel anschaute, konzentriert, mit zusammengezogenen Brauen. Dann fragte er den Jungen, ob er wisse, was Kaolin ist. Als Dmitri den Kopf schüttelte, sagte er, das sei die feinste Tonerde, die es gebe, vollkommen rein. Wenn man sie brannte, würde sie blendend weiß. Anders als der Ton hier, der Eisen enthielt und deshalb rot wurde.
Dmitri fragte, wo man das Kaolin finde. Vielleicht hörte der Ofenwärter nicht, was er sagte. Er drückte dem Jungen nur etwas in die Hand und sagte »Geh!«, mit einer Stimme, als wäre er plötzlich wütend geworden. Er hatte ein Stück Brot verschenkt. Doch vor allem ein Wort, dessen Besitz sich als wertvoll erweisen sollte: Kaolin.
In den Nächten, wenn der Hunger den Schlaf vertrieb, dachte Dmitri an das Kaolinland, ein Land, in dem es große blaue Flüsse gab, mit Brücken aus blendend weißem Kaolin. Sascha und er würden eine der von ihnen erbauten Kaolinbrücken nach der anderen sehen, von ihrem Flugzeug aus, wenn sie den Fluss entlangflogen bis hin zu einem richtigen Meer.
Noch mehrere Male schlich er sich zum Brennofen hinüber, der Ofenwärter aber sprach nie mehr von dem Kaolin. Auch sonst sagte er nichts, warf ihm nur einen Blick zu, in dem es aufglimmte. Und hin und wieder, nicht jedes Mal, drückte ihm der Ofenwärter etwas in die Hand. Vielleicht könnte er ihn und Sascha ja ins Kaolinland begleiten. Und die weißeste Tonerde, die es gab, dort brennen. Dann würden sie zusammen Brot essen, süßes weißes Hefebrot, wie in Moskau. Und wenn sie satt wären, würde noch immer viel Brot übrig sein.
Einige Monate waren vergangen, als ein Brief von seiner Mutter eintraf. Sie schrieb, dass sie Tag und Nacht an ihn denke. Dass sie sich nach dem Tag sehne, an dem sie sich wiedersehen würden. Und dass sie einen Stein gefunden habe, der mit etwas Fantasie wie ein Flugzeug aussah. Sie habe nichts anderes, was sie ihm schenken konnte, wenn er bald dreizehn wurde. An dem Ort, wo sie war, gäbe es nicht gerade viel, was man weggeben konnte. Aber er sollte sich keine Sorgen machen: es ginge ihr gut. Mehr schrieb sie nicht von sich selbst. Der Brief war voller Flecken, als wäre etwas daraufgetropft. Doch lag er in einem feinen weiß gefütterten Kuvert.
Er erkannte das Kuvert wieder. Auch die Handschrift! Die Komarowa war es, die seine Adresse geschrieben hatte. Kein Wort aber von ihr an ihn, nicht ein einziges. Und nirgendwo eine Angabe zur Adresse seiner Mutter. Er rannte aufs Klo hinaus und warf das Kuvert zerfetzt in all die Kacke. Auch wenn das Klo stank, war es ein guter Ort zum Weinen.
An jenem Abend fiel es ihm schwer einzuschlafen, obwohl er müde war. So müde wie nie zuvor. Er war überzeugt, das Einzige, was ihn damals am Leben erhielt, war ein kleiner grauer Stein. Er hielt ihn ganz fest in der Hand, so als wäre er aus Kaolin.

Dann kam der Mai 1945. Der Boden war mit altem eisverkrustetem Schnee bedeckt. Doch wenn man in der Sonne stand, fühlte man ihn langsam warm werden. Manche Tage reichte das aus, um einen glauben zu lassen, dass es ein anderes Leben gäbe, irgendwann jedenfalls. Am Morgen entdeckte er die erste Fliege des Jahres, eine kleine jämmerliche Fliege, die auf dem schmutzigen Fenster umherkroch, dem einzigen Fenster im Schlafsaal der Kinder. Als er näher heranging, um sie anzusehen, drosch Sibirien-Sascha das Tier zu Brei. Gerade als ein Wärter hereinkam und schrie, alle sollten sich auf dem Hof vor der Ziegelei versammeln. Und dann marschierten die Jungen in Zweierreihen los, die Arme schwingend, genau wie die Soldaten der Roten Armee.
Der Leiter des Straflagers, ein Mann mit Stalinschnurrbart und schwarzem fettigem Haar, sollte eine Rede halten. Mit einem großen Megafon stand er auf der Treppe des Verwaltungsgebäudes. Es sei ein Tag der Freude, schrie er. Die Rote Armee habe gesiegt, die Faschisten seien zerschlagen, der Krieg sei zu Ende. Heute beginne eine neue Zeit. Eine Zeit, in der alles wiederaufgebaut würde, was die Nazischweine zerstört hatten. »Kameraden!«, schrie er mit einer Stimme, die durch das Megafon so klang, als säße er in einer Blechbüchse fest. »Jetzt werden unsere Ziegel mehr denn je gebraucht. Gemeinsam bauen wir unsere Nation in ihrer ganzen Größe auf.« Und alle jubelten, auch Dmitri.
Mitten im Jubel entdeckte er ein Stück weiter weg den Ofenwärter. Er stand einfach nur da, stumm und mit finsterer Miene. Plötzlich dachte Dmitri an seine Mutter. Stand auch sie jetzt auf einem Hof und lauschte einem Mann mit Megafon? Auch sie stumm und mit finsterer Miene? Er hörte, wie alle die patriotische Hymne »Sei gepriesen!« anstimmten. Es war das Beste mitzusingen, aus vollem Hals. Während er in der Hosentasche seinen Stein umfasste.
Und die Zeit der Hoffnung kam. Tausende politische Gefangene wurden nach Kriegsende freigelassen. Freigelassene Mütter und Väter tauchten im Arbeitslager auf, um ihre Kinder abzuholen. Auch Sibirien-Sascha und mehrere andere der kriminellen Jugendlichen durften zurückkehren in die Freiheit. Abend für Abend dachte Dmitri, dass er am nächsten Tag an der Reihe wäre. Seine Mutter aber kam niemals, nur ein Brief, in dem sie schrieb, dass sie an ihn denke. Wenn man einen zerknitterten Zettel als Brief bezeichnen kann. Obwohl er in einem grauen, an ihn adressierten Kuvert mit der Handschrift seiner Mutter lag. Und einen Absender hatte: Sie war in Sibirien, genau wie er, sie allerdings im südlichen und er im nördlichen Teil. Wer hatte ihr seine Adresse gegeben? Konnte das die Komarowa gewesen sein? Er schob den Gedanken weg. Es gab Gedanken, die man nicht denken durfte. Man musste die Zähne zusammenbeißen und durfte niemandem vertrauen. Nur seiner Mutter, bestenfalls.
Sie schrieb, ihr ginge es gut, doch dass er ihr fehle. Er schrieb in seiner Antwort dasselbe. Und dass er in der Schule jede Menge lerne und in einer Ziegelei behilflich sei. Doch nichts über den Hunger und die Müdigkeit. Auch nichts über den Ofenwärter, der verschwunden war, und kein einziges Wort über das Kaolin. Er schrieb auch nichts über den Stein, den sie ihm geschickt hatte. Das hätte er tun sollen. Doch als ihm das einfiel, hatte er den Brief schon einem der Wärter übergeben, in einem Kuvert, das den Regeln entsprechend nicht zugeklebt war. Dann aber hätten sie ihm den Stein vielleicht weggenommen. Beschlagnahmten sie nicht alles, was einem am Herzen lag?
Und weitere Briefe kamen, in langen Abständen. Die Mutter schrieb, sooft man es ihr erlaubte. Während er immer länger damit wartete, ihre Briefe zu öffnen. Es stieg etwas in ihm auf, wenn er sie las, Erinnerungen, die wehtaten. Besonders wenn er daran dachte, wie er sich von ihr abgewandt hatte, der Komarowa wegen, die ihn, als es darauf ankam, im Stich gelassen hatte. Es war leichter zu verkraften, wenn allein der Körper wehtat. Und man sich nur nach Essen und Schlaf sehnte. Und einem seltsame Wörter wie Kaolin egal waren. Den Stein der Mutter aber hatte er nicht vor wegzuwerfen. Irgendwie war es ein gutes Gefühl, ihn zu besitzen, als sei er eine Art Amulett.

Es geschah im Frühsommer 1948, als er sechzehn Jahre alt war. Als alle anderen zum Abendessen abmarschierten, wurde er zum Verwaltungsgebäude gebracht, gerade als die Abendsonne, eine große rote Kugel, das Dach der Ziegelei zu berühren schien. Vielleicht hatte ihn jemand angezeigt, obwohl er nicht wusste, warum. Man führte ihn in ein Zimmer, in dem ein blonder Mann um die vierzig hinter einem Schreibtisch saß. Der Mann hatte seine Uniformjacke abgelegt und das Hemd aufgeknöpft, weil die Hitze des Tages noch immer im Raum stand.
Er sah das Plakat, das hinter dem Mann an der Wand hing: Stalin, der ein Kind zum hellblauen Himmel hob. Das Kind, in einer Hand die rote Sowjetfahne, in der anderen einen Blumenstrauß, lächelte übers ganze Gesicht. Und auch Stalin lächelte und zeigte sich von dem Kind entzückt. Es war ein rundes rosiges Kind in fleckenloser weißer Kleidung. Kein Drecksgör wie er, der nur Haut und Knochen war.
Der Mann hinter dem Schreibtisch hingegen lächelte nicht. An das, was er genau gesagt hatte, sollte sich Dmitri nie erinnern. Nur, dass es um Typhus ging und Dmitris Mutter tot war. Konnte er etwas dafür, dass sich in seiner Brust etwas löste, ein Schrei wie der eines verletzten Tieres? Und dass er um sich schlug, als der Mann und andere, die hereingestürmt kamen, ihn zu beruhigen suchten. Hinterher behaupteten sie, er habe die Behörden beschuldigt, seine Mutter getötet zu haben. Vielleicht war ihm das ja entschlüpft. Er erinnerte sich nicht. An nichts. Nur daran, dass seine Mutter tot war. Und dass man ihn in eine Zelle trieb, wo er dann saß, mit dem Stein seiner Mutter in der Hand.
Man verurteilte ihn zu sechs Jahren Zwangsarbeit in einem Straflager für Erwachsene in Kasachstan. Als er das Urteil erhielt, überlegte er, ob es nicht das Beste wäre zu sterben.

Das erste Wort, das er in Kasachstan lernte, war »su« (Wasser). Denn Wasser war das Einzige, woran er dachte, als er nach mehrtägiger Reise im glutheißen Güterwaggon, in dem er mit siebzig anderen Verurteilten zusammengepfercht war, aus dem Zug stieg. Das zweite Wort war der Name des Durchgangslagers, in dem sie fünfundzwanzig Tage in Quarantäne bleiben mussten: Karabass.
Es war so nahe am Paradies, wie ein Verurteilter nur kommen konnte, obwohl es Wachhunde und Stacheldrahtzäune gab. Zwar mussten er und die anderen Gefangenen mehrmals am Tag in brütender Sonne stehen, um gezählt zu werden oder auf eine Schüssel mit Suppe oder Grütze zu warten. Doch brauchten sie nicht zu arbeiten. Den Wärtern war es egal, wenn man den ganzen Tag auf seiner Pritsche lag. Man konnte dort im Halbdunkeln liegen und seinen Stein befühlen. Auch dass er ihn noch immer haben durfte, war merkwürdig.
Der Wärter, der jeden Winkel seines nackten Körpers durchsucht hatte, fand ihn in seinem Mund und warf ihn auf den Boden, doch erst, nachdem er ihn fast zärtlich betrachtet hatte. Dann sagte er mit äußerst sanfter Stimme, wenn Dmitri ihn haben wolle, müsse er ihn aufheben, aber nicht mit der Hand, sondern mit dem Mund.
Der Stein lag auf dem Zementboden, ein kleiner grauer Stein, der glänzte. Als sei er feucht vor Speichel, obwohl das unmöglich war, denn die Angst hatte Dmitris Mund vollkommen austrocknen lassen. Oder wusste der Stein vielleicht, dass er alles war, was Dmitri von seinem früheren Leben noch besaß? Ein Leben, bei dem man an einem Fluss sitzen und sich fortträumen konnte. Er ging auf alle viere nieder, ein magerer nackter Junge, jedes Härchen an seinem Leib war abrasiert, auch das bisschen Schamhaar, das eben erst gewachsen war. Und er nahm mit den Lippen den Stein auf. Den Geschmack des Zementbodens würde er nie vergessen. Und dass der Stiefel des Wärters dicht neben seinem Mund ebenfalls geglänzt hatte.
Als die Zeit der Quarantäne vorbei war, trieb man ihn mit einer Gruppe Gefangener zusammen, die sich auf den Marsch begeben mussten, bewacht von bewaffneten Soldaten zu Pferde. So lernte er kennen, was die Steppe war: eine endlose Ebene, in der es keine Bäume gab, keinen Schutz, nur eine alles versengende Sonne. Am zweiten Abend erreichten sie eine Anhöhe. Und sie sahen Burma, nicht das Land mit den goldenen Pagoden, von dem er in der Schule gelesen hatte, sondern das Straflager, in dem er sechs lange Jahre bleiben sollte. Doch glich es einer Oase: ein See, umgeben von niedrigen Häusern, und um sie herum ein fruchtbarer Landstrich mit Getreidefeldern und Gemüseplantagen. Und alles leuchtete in der Abendsonne, auch die Luft über dem Dorf, ein goldfarbener Dunst. Vielleicht war das der Grund, warum die Bewacher ihre Pferde einen Augenblick zügelten. Oder aber sie wollten die Gefangenen nur noch einmal durchzählen.
Die Prozedur war dieselbe wie bei der Ankunft in Karabass: Verhör, Leibesvisitation, Reinigung des Körpers und Ganzkörperrasur, während die Häftlingskleidung, die man getragen hatte, desinfiziert wurde. Dann erfolgte die Musterung durch eine ärztlich geleitete Arbeitskommission. Diesmal nahmen sie seinen Stein.
Es war später Abend, als die Aufnahmeprozedur zu Ende war. Man führte ihn zur Zone Süd, dort lagen vier Baracken, mit dreifachem Stacheldrahtzaun umgeben. Im Gang zwischen den beiden äußeren Zäunen jagten Hunde im Scheinwerferlicht umher, so als wollten sie sich von ihren Ketten reißen und alles Lebendige, das sie packen konnten, zerfetzen.
Als er in die Baracke eins hineingestoßen wurde, wäre er fast gestürzt. Der Raum lag eine Armeslänge unterhalb der Erdoberfläche, an den Wänden Pritschen in drei Etagen. Die Wachposten ließen das Licht ihrer Taschenlampen über die Schlafenden streichen und schrien: »Appell!« Die Gefangenen erhoben sich von ihren Pritschen, mühevoll, so als müssten sie sich aus dem Schlaf losreißen. Und standen vollkommen stramm, mit nacktem Oberkörper, an dem sich jede Rippe abzeichnete, und riefen, wie man ihnen befohlen hatte, ihre Namen und Häftlingsnummern, und zwar nicht nur ein-, sondern dreimal. Dann gingen die Wachposten, und die Männer legten sich wieder hin. Dmitri jedoch nicht. Für ihn gab es keine freie Pritsche.
Am Ende streckte er sich auf dem Boden aus, einem harten Lehmfußboden, wo ihm jede Unebenheit ins Fleisch schnitt. Es war, als hätte er alles verloren, alles, was sein Leben ausgemacht hatte. Ihm war nichts mehr geblieben, nicht einmal mehr ein Stein, nur sein schmerzender Leib.
Er warf sich von einer Seite auf die andere. Einige Schläfer schnarchten. Jemand atmete schwer. Er hörte eine Stimme, die ganz leise sagte: »Komm!« Er rührte sich nicht. Am besten schloss man vor allem die Augen und Ohren. Wieder flüsterte jemand: »Komm!« Er aber blieb liegen, ganz still, so als schlafe er. Der Flüsternde aber gab nicht auf und sagte noch einmal: »Komm! Hab keine Angst!« Dmitri wollte schon sagen, er komme allein zurecht. Dann aber stand er auf und ging zu dem Flüsternden, der mit der Hand winkte.
Er könne sich zu ihm legen, sagte der Mann, der auf einer der untersten Pritschen lag, er sei so dünn, dass es gehen würde, wenn sie Kopf an Fuß lägen. Dmitri legte sich zu ihm, nur widerwillig. Wenn sie jetzt das Bett teilten, sagte der Fremde mit einem Akzent, der zeigte, dass er kein Russe war, wäre es wohl gut, wenn sie sich einander vorstellten. Er heiße Constantin-Mircea Adamescu, kurz gesagt Dinu. Und der Junge sagte seinen Namen: Dmitri Michailowitsch Fjodorow. Er sagte nicht, dass er auch Hannes hieß. Der Name gehörte zu einem, den es nicht mehr gab, einem Jungen, der mit seiner Mutter am Fluss gesessen hatte.
Er spürte, wie Dinus Fuß seine Wange berührte. Ein Fuß in einem Strumpf, der nach Schmutz und Schweiß roch. Ein Strumpf, bei dem der kleine Zeh aus einem Loch ragte. Wäre Dmitri nicht so müde gewesen, wäre er wieder aufgestanden. Man wird so dünnhäutig, wenn man die warme Haut eines anderen spürt.
Es wurden sechs Nächte mit Dinu. Abend für Abend zögerte er, doch Dinu sagte: »Komm!« Er sagte es leichthin. Alles an Dinu hatte eine Leichtigkeit, die Dmitri nicht begriff. Aber man konnte sich an ihr festhalten, als sei diese Leichtigkeit eine Art Stein.
Als die siebente Nacht bevorstand, bekam er eine eigene Pritsche. Einer der Männer, der während des Morgenappells kaum noch hatte stehen können, kehrte nicht von der Arbeit zurück. Jemand sagte, er sei umgekippt, als er Unkraut in den Tomatenpflanzungen rupfte. Sei einfach zur Seite gekippt, als er dort kniete, und tot gewesen, in der Hand eine große Distel. Ein anderer sagte: Gott, sei seiner Seele gnädig!
Ein grauhaariger Mann mit einer Autorität, der nicht einmal die Häftlingskleidung etwas anhaben konnte, durchsuchte das Bett des Toten. Er fand eine Sammlung Briefe, die er im Holzofen verbrannte, ohne sie zu lesen und ohne dass jemand ein Wort dazu sagte. Nicht einmal Dinu. Er saß nur auf der Bettkante und schien intensiv zu lauschen. Als sei das aufflammende Feuer etwas, dem man lauschen konnte. Dann bekam Dmitri die Pritsche. Und den Strohsack des Mannes samt Decke.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.