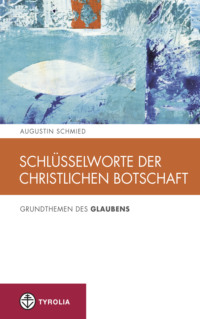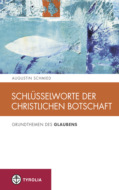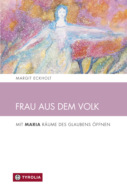Kitabı oku: «Schlüsselworte der christlichen Botschaft», sayfa 2
EIN WORT ZUGUNSTEN DER „GERECHTEN“?
Würde Jesus heute positiver über die „Gerechten“ sprechen?
Mit der Akzentuierung der Botschaft Jesu als Botschaft vom gütigen und barmherzigen Gott sollte dem Bemühen des Menschen um den Willen Gottes nicht der Antriebsschub entzogen werden. Es gibt Aufträge und Pflichten von Gott her, die erfüllt werden müssen, auch wenn das schwerfällt. Das zeigt auch das Leben und Verhalten Jesu selbst. Er ist selbst an Punkte gekommen, wo er gegen seine Wünsche und Ängste dem Auftrag des Vaters treu bleiben musste.
In einer Gesellschaft wie der unseren heute, in der „law and order“ eher Negativbegriffe sind; in einer Zeit und Gesellschaft, wo es keine so starke „Sozialkontrolle“ gibt wie früher, auch wie zur Zeit Jesu, kann man sich fragen, ob Jesus heute nicht stärker das gerechte und gute Tun betonen würde, statt sich vor die „Sünder“ zu stellen. Hätte er nicht eher diejenigen gestützt, die sich sittlich und religiös anstrengen?
Dietrich Bonhoeffer hat sich in dieser Richtung Gedanken gemacht. Er schreibt in seiner Ethik: „In festgefügten Zeiten, in denen das Gesetz regiert, und der Übertreter des Gesetzes der Ächtung und Verstoßung verfällt, sind es die Gestalten des Zöllners und der Dirne, an denen das Evangelium Jesu Christi sich den Menschen deutlich macht. (…) Jedoch aus den Fugen gegangenen Zeiten, in denen Gesetzlosigkeit und Bosheit selbstherrlich triumphieren, wird sich das Evangelium eher an den wenigen übriggebliebenen Rechtlichen, Wahrhaftigen, Menschlichen erweisen“.17
„Aus den Fugen gegangene Zeiten“. Bonhoeffer denkt an die Zeiten der Nazi-Herrschaft. Wie sieht es heute aus? Leben wir in „festgefügten Zeiten“? Oder geht auch bei uns einiges „aus den Fugen“? Was Bonhoeffer schreibt, ist sicher bedenkenswert. Das Reden von der Barmherzigkeit Jesu für die Sünder darf nicht dazu führen, den Unterschied von Gut und Böse, von Recht und Unrecht einzuebnen. Es darf nicht zu einer Geringschätzung der Redlichen, der Treuen und der Sich-Mühenden führen. Wir leben in einer „permissiven“ Gesellschaft, in der fast alles erlaubt ist. Da geraten diejenigen manchmal in Erklärungsnot, die sich noch „ein Gewissen machen“ aus dem, was sie tun. An den Geboten Gottes festhalten zu wollen, scheint ein Zeichen von Einfallslosigkeit oder von Zwangskrankheit zu sein. Ein evangelischer Theologe meinte, dass heute gerade diejenigen, die sich keine Eskapaden leisten, „einiger Streicheleinheiten“, das heißt einer Ermutigung bedürfen; die Gesellschaft verdanke ihnen viel.18
Trotzdem: Die Betonung der zuvorkommenden und barmherzigen Güte Gottes und Jesu, die wir in den Evangelien finden, gilt auch für unsere Zeit und ist für alle von Bedeutung. Denn: auch die „Gerechten“ (das Wort ist hier nicht ironisch gemeint) leben nicht nur von ihrer eigenen Leistung. Vieles, Grundlegendes ist vorgegeben durch das schöpferische und gnadenhafte Wirken Gottes, durch Vorgaben aus dem menschlichen Bereich. Und auch im Verlauf des Lebens, wenn es einigermaßen gut und rechtschaffen läuft, ist nicht nur das eigene Wollen und Können im Spiel. Es ist auch „Glück“ oder „Gnade“ dabei; man spricht von guten „Fügungen“. Den Betreffenden sind vielleicht manche schwierige und gefährliche Situationen erspart geblieben. Sie sind unter Umständen an Abgründen vorbeigeführt worden, ohne dass sie es so recht gemerkt hatten. Die heilige Theresia von Lisieux hat von sich gesagt, im Blick auf ihre Anlagen und ihre eigenen Kräfte sei es nicht ausgeschlossen, dass sie unter bestimmten Bedingungen zum Verbrecher geworden wäre. Dem entspricht, was jemand einmal so ausdrückte: „Ich bin nicht anders als manche, die gescheitert sind; ich hatte es nur anders.“ Wir sind selbst nicht so eindeutig auf das Gute eingestellt und sind darin nicht so gefestigt, dass wir ein ehrenwertes Leben allein unserer Leistung zuschreiben könnten.19
„VATER“
Zu den biblischen Worten, die den Glauben und die Spiritualität der Christen in spezifischer und zentraler Weise charakterisieren, gehört das Wort „Vater“ als Name für den Gott Jesu und als Anrede dieses Gottes. „Vater“, „Abba“: Diese Worte führen in das Innerste der Gotteserfahrung Jesu, und sie signalisieren die Gottesbeziehung, die den Christen durch Jesus ermöglicht und geschenkt ist. Nach Paulus legt der Heilige Geist den Ruf „Abba! Vater!“ auch den Glaubenden in den Mund (Röm 8,15; Gal 4,6). Was das bedeutet, soll im Folgenden verdeutlicht werden.
GOTT UND DIE GÖTZEN
Wenn von „Gott“ gesprochen wird, muss gesagt werden, was, wer mit diesem Wort näherhin gemeint ist. In der Rede vom „Vater“ steckt die christliche Antwort auf die Frage, wer „Gott“ ist und wen wir als „Gott“ verehren.
Das Wort „Gott“ ist ja zunächst nicht ein Eigenname, sondern eine Prädikation, eine Kennzeichnung. Es bezeichnet die höchste und mächtigste Wirklichkeit bzw. die am höchsten geschätzte und verehrte Wirklichkeit, auf die alles Andere hingeordnet wird. Den vielen „Göttern“ gegenüber stand in Israel das Bekenntnis: „JHWH“ ist Gott“ (1 Kön 18,39).
Von Martin Luther stammt der bekannte Satz: „ ‚Ein Gott‘ heißt das, von dem man sich erhoffen soll alles Gute und zu dem man seine Zuflucht nehmen soll in allen Nöten. (…) Allein das Trauen und Glauben des Herzens macht beide: Gott und Abgott. Worauf du nun dein Herz hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott.“20
Wovon sich jemand letztlich Lebenssinn und Erfüllung verspricht, das ist sein / ihr „Gott“. Das kann Verschiedenes sein, je nach der Grundeinstellung eines Menschen. Es gibt Verschiedenes, das als „höchstes Gut“ („summum bonum“) betrachtet wird, und dem vieles Andere untergeordnet und „geopfert“ wird. Im konkreten Fall kann das ein „Götze“ sein: wenn nämlich ein begrenzter irdischer Wert zum alles beherrschenden Ziel und Maßstab gemacht und so verabsolutiert wird.
Ein „Götze“ kann die Nation und ihr Glanz sein, der Staat und dessen Repräsentanz. In der Offenbarung des Johannes wird die römische Staatsmacht als ein Götze dargestellt, der göttliche Würde usurpiert, dem die Christen die Huldigung verweigern (vgl. Offb 13–14; 18). Ein „Götze“ kann sein der Besitz und dessen Vermehrung (vgl. Mt 6,24: „Gott“ oder „Mammon“; Lk 12,13–21: Selbstsicherheit durch Reichtum; 1 Tim 6,10: die „Habsucht“ als „die Wurzel aller Übel“). Im Kolosserbrief wird die „Habsucht“ direkt als „Götzendienst“ bezeichnet (Kol 3,5). Auch der höchstmögliche Genuss kann zum „Götzen“ werden (vgl. 1 Joh 2,15ff; 5,19–21). Ein „Götze“ kann sein das eigene Ich, wenn nur noch das eigene Prestige, die eigenen Interessen gesehen werden, ohne Rücksicht auf Andere.
Paulus schreibt im Ersten Korintherbrief, dass es für die Christen „keine Götzen gibt und keinen Gott, außer dem einen“. „Und selbst wenn es sogenannte Götter gibt – und solche Götter und Herren gibt es viele –, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, und einer ist der Herr, Jesus Christus“ (1 Kor 8,4–6; vgl. Gal 4,8).
Jesus und das Neue Testament können auf die Propheten Israels zurückgreifen. Bei ihnen findet sich deutlich und markant die Unterscheidung zwischen dem wahren, „lebendigen“ Gott und den „Götzen“. Diese sind konkret Vergöttlichungen von Vitalität und Fruchtbarkeit (vgl. Jer 7,17ff; Hos 2,7–10; 10,1f; 14,2–9); von Herrschermacht (vgl. Dan 3,8–18), von militärischer Potenz (vgl. Jes 2,7f.17f; 31,1–3), von Geschäft und Profit (vgl. Jes 2,12–18).21
Wenn heutzutage bei Unfällen auf den Straßen so selbstverständlich von „Verkehrsopfern“ gesprochen wird, kann man sich fragen, ob nicht für manche das möglichst schnelle Verkehrsmittel zu einem vergötzten Kultobjekt geworden ist. Im Jahr 2005 gab es weltweit 1,2 Millionen Verkehrstote.22
„Gott und Götzen“! Man hat mit Recht gesagt: Der eigentliche Gegensatz zum Glauben an Gott ist nicht der Atheismus, sondern die Idolatrie, der Götzendienst.23 Man könnte denen, die nicht an den in der Bibel sich zeigenden Gott glauben, vorschlagen, darüber nachzudenken, ob es nicht „Götzen“, d. h. unheilvolle Verabsolutierungen und dementsprechende Bindungen bzw. Abhängigkeiten gibt in ihrem Leben oder in der Gesellschaft, und sich zu überlegen, wie man von solchen „Abgöttern“ frei werden kann.
DER GOTT UND VATER JESU
Als Christen glauben wir, dass uns durch und in Jesus Christus entscheidend und letztgültig offenbar, erkennbar geworden ist, wer „Gott“ ist und wer er für uns sein will (vgl. Mt 11,25ff par Lk; Joh 1,18; 14,6; 17,2f.25; Eph 1,17; 2,17f; Hebr 1,1f).
Der einzige und heilige Gott
Wenn Jesus von Gott spricht, dann meint er den „einzigen Gott“, den Israel bekennt (vgl. Mk 12,28–34; 10,18), den „Herrn und Schöpfer“ (Mt 11,25), den „einzigen wahren Gott“, zu dessen „Verherrlichung“ er sich gesandt weiß (Joh 17,3f).
Auf der Grundlage der alttestamentlichen Offenbarung ist Gott für Jesus der „Heilige“: der Nicht-Verfügbare; der von Menschen nicht für selbstgesetzte Zwecke instrumentalisiert werden kann und darf – der eben kein „Götze“ ist, den man sich „macht“. Ihn ehrt der Mensch, wenn er ihn über jede Berechnung hinaus anerkennt und sich ihm anvertraut.
Im frühjüdischen Buch Jesus Sirach heißt es: „Versuche nicht, ihn (Gott) zu bestechen; denn er nimmt nichts an“ (Sir 35,14). Es geht im Zusammenhang um die Darbringung von Opfern. „Bestechung“, das bedeutet, etwas durch Schmeicheleien, List oder Druck erreichen zu wollen. Teure Gaben opfern, etwas Kostbares hergeben mit dem Ziel, Gott irgendwie „herumzukriegen“, ihn sich gefügig zu machen. Vor Gott, mit Gott kann es aber kein Tricksen und keinen Handel geben. Wir können ihm ja nichts bieten, was nicht im Letzten auch seine Gabe ist. Es gilt, sich ihm ohne Rückversicherung anzuvertrauen, in der Zuversicht, dass er es ehrlich und gut mit uns meint. In dieser Gesinnung hat Jesus vor seinem Gott und Vater gelebt.
Diese Einstellung Jesu kommt zum Ausdruck in den ersten drei theozentrischen Bitten des „Vaterunsers“ (Mt 6,9f): dein Name, dein Reich, dein Wille. Sie kommt zum Ausdruck in der Art, wie Jesus auf die „Versuchung“ Satans reagiert, sich von der Höhe des Tempels zu stürzen: Gott bzw. sein Tun soll nicht für ein Schauwunder eingespannt und missbraucht werden (Mt 4,5ff). Sie äußert sich weiter im Verbot zu schwören: Gott darf nicht „in Pflicht genommen“, zu einer Reaktion gezwungen werden, um die Wahrheit menschlicher Aussagen zu garantieren; im Zurückweisen der Vorstellung, man könne Gott durch Häufung von Worten gefügig machen (Mt 6,7f); schließlich in der Bereitschaft Jesu, sich dem Willen des Vaters auch in der Annahme des Leidens und des Todes anheimzugeben (Mk 14,36).
Der Vater – Abba
Dieser heilige Gott ist für Jesus der bzw. sein „Vater“. Wo Jesus in den Evangelien von „Gott“ spricht, steht überwiegend das Wort „Vater“ (174-mal); so auch an allen Stellen (ausgenommen Mk 15,34: Verlassenheitsruf), wo Jesus betet (Mk 14,36 par; Mt 11,25f par; Lk 11,2 par; Lk 23,34.46; Joh 11,41; 12,27f; 17,1.5.11.21.24f).24 Besonders die Anrede Gottes als „Abba“, in seiner aramäischen Muttersprache, ist für Jesus wohl charakteristisch gewesen (Mk 14,36; vgl. Mt 26,39.42; Lk 10,21). Dass der Gebetsruf „Abba! Vater!“ auch noch in der griechisch sprechenden Urkirche gängig war (Röm 8,15; Gal 4,6), zeigt, dass man sich hier einer Besonderheit bewusst war, die auf Jesus zurückging.
Mit seiner „Abba“-Anrede steht Jesus im Bereich jüdischer Gebetsanrede zwar nicht völlig allein, aber es war nicht die übliche und oft genutzte Art und Weise, Gott anzurufen. Das früheste literarische Zeugnis für diese Anrede findet sich jedenfalls in der neutestamentlichen Bibel.25
Dieses „Abba“ stammt aus der Familiensprache. Es wurde zur Zeit Jesu als Anrede von kleinen Kindern, aber auch von erwachsenen Söhnen und Töchtern ihrem Vater gegenüber gebraucht. Dass „Abba“ einfach dem „Papa“ oder „Papi“ des Kleinkinds entspreche, ist nicht richtig („Abba isn’t Daddy“: James Barr). Im Neuen Testament wird das aramäische „Abba“ ja nicht mit dem griechischen Wort pappas (Vater, Papa) übersetzt, sondern mit pater (Vater). Heinz Schürmann übersetzt „Abba“ mit „lieber Vater“. Richtig ist aber, dass das Wort in die Sphäre des Hauses und der Familie verweist. Es kommt nicht aus der kultischen Sprache. Es lässt ein unbefangenes, angstloses, vertrauendes Verhältnis zu Gott erkennen.26 Die Einzigartigkeit des Gottesverhältnisses Jesu muss allerdings von seinem ganzen Verkünden und Verhalten her aufgezeigt und begründet werden.
Die „Abba-Erfahrung“ Jesu
Die „Vater“-Anrede Jesu ist zunächst Ausdruck dafür, wie Jesus seine eigene Beziehung zu Gott erfahren hat. Die Schilderung der Taufe Jesu in den Evangelien enthält Elemente, die aufgegriffen werden können, um die Gotteserfahrung Jesu zu kennzeichnen.
„Du bist mein geliebter Sohn!“ Aus einem solchen Zuspruch konnte Jesus leben und wirken. Dabei ist eher an einen Vorgang innerer Erfahrung gedacht als an ein von außen hörbares Wort (vgl. Mk 1,9ff par). Wenn man die im Hintergrund stehende Jesaja-Stelle (42,1–9) einbezieht, dann weiß sich Jesus „bevorzugt“ und dazu „erwählt“, einem umfassenden Werk des Heils zu dienen – ein einmaliger Vertrauensbeweis Gottes ihm gegenüber. Jesus hat eine Wertschätzung, eine Zuneigung vonseiten Gottes gespürt, die ihm das Herz geweitet und seine Energien geweckt haben; die ihm ermöglichten, auch mit einer großen Liebe auf die Menschen zuzugehen. „Sein Weg steht unter der Zusage Gottes. Nichts steht zwischen ihm und dem Vater. Er weiß sich so eins mit ihm, dass er keine Angst um sich selbst hat. Gerade so ist er ganz den Menschen zugewandt.“27
„Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden“ (Einheitsübersetzung). Das Wort „Gefallen“ oder „Wohlgefallen“ drückt nicht genügend aus, worum es geht. Es klingt, als ob Jesus eine gute Note für Betragen und Leistung verdient hätte. Geeigneter wäre die Übersetzung: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude, du hast mein volles Vertrauen“.28
Jesus ist bewusst geworden, dass ihm Gott, der Vater, Vertrauen schenkt. Jesus darf den Weg gehen, den er als richtig erkannt hat. Er darf auch ungewohnte Wege gehen, darf Neues, Unerhörtes sagen. In einem Ausspruch, der zum ältesten Bestand der Evangelienüberlieferung gehört, sagt Jesus: „Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will“ (Mt 11,27 = Lk 10,22). Jesus ist bevollmächtigt, im Namen Gottes zu handeln: befreiend, erneuernd, schöpferisch. Er hat Anteil am Wirken Gottes in der Welt. Jesus ist so „eingeweiht“ und einbezogen in das, was Gott offenbaren und schenken will, dass dieses Miteinander einer Beziehung entspricht, wie sie zwischen einem Vater und seinem Sohn besteht. Jesus vergegenwärtigt in einmaliger Weise den Leben und Heil schaffenden Gott. Davon spricht Jesus besonders in seiner Verkündigung vom Anbruch der „Herrschaft Gottes“ (vgl. Mk 1,14f). Im Johannesevangelium wird die vertrauende und liebende Verbundenheit zwischen Gott und Jesus geradezu systematisch durchbuchstabiert und als eine Beziehung göttlicher Art dargestellt (vgl. Joh 5,19–26; 8,29; 15,9f; 17,22–26).
„Du bist mein geliebter Sohn!“ Die Erfahrung der in diesen Worten ausgedrückten Zuneigung und Zusage hat Jesus zu einer grundlegend positiven Einstellung in seinem Denken und Verhalten befähigt. Jesus hat nicht aus einer negativen Grundstimmung heraus gelebt und gehandelt, aus einer Unzufriedenheit mit sich und den anderen; oder aus einem Ärger, einer Verbitterung heraus, oder aus einer bösen Freude daran, die Leute in Angst versetzen zu können. Jesus hat sich nicht auf die problematischen und negativen Seiten der Menschen fixiert. Er hat ihnen neue Anfänge und Wege in Richtung des Guten zugetraut. So hat er nicht Angst und Lähmung verbreitet. Sein Anliegen war es, die Menschen in seine eigene Nähe zum Vater-Gott hineinzuziehen, in seine Freude an diesem Gott und Vater.29
Ambivalenz des „Vater“-Bildes.
Gott: Vater – Mutter?
Wenn Jesus Gott „Vater“ nennt, dann überträgt er damit nicht das allgemeine menschliche Vater-Kind-Verhältnis auf Gott, sondern was er in der eigenen Gottesbeziehung erfahren hat, das veranschaulicht er in einem letztlich unzulänglichen Bilde. Was er über Gott als „Vater“ sagt, hat er nicht an faktischen oder idealen Familienverhältnissen abgelesen. Deshalb seine nüchterne und kritische Feststellung: „Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten“ (Mt 7,11; vgl. Lk 11,13). Hierher gehört auch das Wort: „Ihr sollt niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel“ (Mt 23,9). Das bedeutet wohl: Was „Vater“ eigentlich heißt und was „Vaterschaft“ sein sollte, das ist vom himmlischen Vater her zu sehen; davon können irdische Väter nur ein schwaches Abbild sein; deshalb wäre es besser, in der Welt niemand „Vater“ zu nennen. – Das schließt allerdings auch eine gewisse Relativierung der Vater-Bezeichnung für Gott ein.
Jesus hat wohl um die Ambivalenz menschlicher Vaterschaft gewusst: dass sie patriarchalische, autoritäre und despotische Formen annehmen kann. Im Gottesverständnis Jesu gibt es auch das mütterliche Element (vgl. Lk 6,35; 15,20ff; Mt 23,37), und er konnte dabei an entsprechende Gedanken im Alten Testament anknüpfen (z. B. Jes 49,15f; 66,13; Hos 11,4f). Diese Sicht kam aber im damaligen Vorstellungsfeld „Vater“ nicht genügend zum Ausdruck (trotz Ps 103,13).
Im Markusevangelium heißt es, dass diejenigen, die um Jesu willen „Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder“ verlassen haben, das Hundertfache dafür erhalten werden, auch „Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder“. Von „Vätern“ ist hier aber bezeichnenderweise nicht die Rede (vgl. Mk 10,29f). Neue „Väter“ zu erhalten, erscheint demnach als nicht besonders verlockend und verheißungsvoll. Sie würden sich vielleicht zu breit machen, eine brüderlich-schwesterliche Atmosphäre eher verhindern.30
Jean-François Six schreibt (wohl überpointiert): Wir müssen „auszusprechen wagen, dass Gott nicht Vater ist im menschlichen Sinn dieses Wortes. Von solcher Vaterschaft wissen wir genug und wir zappeln endlos in ihren Netzen. Es ist vielmehr jene Vaterschaft, die nicht unterdrückt, die nichts von dem immer schon vorausliegenden Gewicht hat, das jede irdische Vaterschaft darstellt.“31 Ein bestimmtes, lange aufrechterhaltenes Vaterbild war mit der Drohung verbunden, den Söhnen und Töchtern das Wohlwollen zu entziehen, wenn eigene und freie Schritte gewagt werden.
Die Überwindung des zwiespältigen Gottesbildes
Eugen Biser betont in seinen Schriften, dass Jesus Eindeutigkeit ins Gottesverständnis gebracht habe.32 In der Religionsgeschichte erscheine Gott in einer bleibenden Doppeldeutigkeit. Er ist gütig und barmherzig, aber ebenso bedrohlich und gefährlich. Liebe und Zorn, Erbarmen und Strafgerechtigkeit stehen als gleichursprüngliche und unvermittelte Eigenschaften nebeneinander. Es gibt in Gott willkürliche Reaktionen, gegen die man sich absichern muss: durch Beschwörungsund Besänftigungsriten, die als umso wirksamer gelten, je mehr sie wehtun. Gottes Vergebung muss man erkaufen.
J.-F. Six: „Warum hat das Gebet einen Hang zum Magischen? Weil der Mensch leicht geneigt ist, Gott als ein gefährliches Wesen anzusehen. Genau darin besteht die Sünde, dass man darauf besteht, Gott als ein gefährliches Wesen zu sehen … Seltsamerweise gefällt das vielen. Diese Sicht Gottes bietet ihnen einen bestimmten Schauder, den sie nicht missen wollen“.33 Es gibt tatsächlich ein geheimes Selbstbestrafungsbedürfnis, dem das Bild eines dreinschlagenden Gottes entgegenkommt.34
Sicher gibt es Erfahrungen einer Verdunkelung des Antlitzes Gottes, der Ferne Gottes, der Verlassenheit. So etwas hat auch Jesus erlebt. Aber der „Gott und Vater Jesu“ ist kein von vornherein zwiespältiger Gott, kein gleicherweise „grausamer und gütiger Herr“ (wie ihn selbst Martin Buber kennzeichnen zu müssen glaubte). Bei ihm gibt es keine Strafgerechtigkeit, die losbrechen muss und die erlitten werden muss, bevor er wieder Liebe sein kann. Vergebung der Schuld wird nicht verdient durch Abbüßung einer Strafe, sondern ist begründet in einer treu gebliebenen und suchenden Liebe (vgl. Mt 18,13f; Lk 15), die freilich ungeschuldet ist und nicht zur Wirkung kommen könnte, wenn ein Anrecht auf sie angemeldet würde. – „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist“, „denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen“, heißt es in der lukanischen Fassung der Bergpredigt (Lk 6,35f). In der programmatischen Antrittspredigt Jesu in Nazaret übergeht Jesus in der von ihm zitierten Jesajastelle das Wort vom kommenden „Tag der Vergeltung (Rache)“ (Lk 4,18f – Jes 61,2); er spricht nur vom „Gnadenjahr des Herrn“, das er ausrufen will (vgl. oben, S. 11).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.