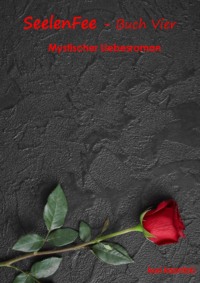Kitabı oku: «SeelenFee - Buch Vier», sayfa 2
42 – Nachdenklich, achtsam und …
… verhalten setzte sich Elektra auf die große Couch im Wohnbereich der Suite. Mit ängstlich aufgerissenen Augen fixierte ihr Blick einen Punkt am Boden und verlor sich sogleich spürbar und tief in ihren Gedanken und Erinnerungen. Bald schon war sie bei sich. Silvanas Anwesenheit vernahm sie wohl kaum noch, doch fraglos fühlte sie die Nähe der anderen Frau.
Und dann kam es zu einer Offenbarung, die es im wirklichen Leben nur sehr selten gibt – in Träumen und Gedanken schon viel öfter, doch wurden diese Bilder nur selten in Worte gefasst. Auch würde jeder normale Mensch eine solche Offenbarung schlichtweg für unglaubwürdig halten. Aber was war an Silvana schon normal. Und sind es nicht oft erst die sonderbar scheinenden Dinge, Worte oder Gedanken, die wirkliche Veränderungen verursachen?
»Bella …«, begann Elektra kaum hörbar. »Ich lebe mit einer Frau zusammen. Obwohl … tue ich das überhaupt?
Ist es nicht eher der Wunsch danach?« Fragen, die sie sich selbst stellte und die sie sich mit einem ahnungslosen Schulterzucken beantwortete.
Silvana spürte deutlich, dass hier etwas von großer Bedeutung seinen Anfang nahm. Und sie wagte nicht, sich zu bewegen – zu empfindlich war der Moment.
Und sie wartete. Stumm und reglos.
Anfänglich sehr zaghaft fuhr Elektra schließlich fort: »Man kann das mit Bella nicht verstehen, wenn man nicht …« Sie brach ab und nickte schließlich ihren Gedanken zustimmend zu. »Ja, ich muss viel früher beginnen.« Und einen langen Moment kramte sie dann stumm ein weiteres Stück tiefer in ihren Erinnerungen, räusperte sich und begann zu erzählen. Von der Trennung von Raymond. Sie wusste damals nicht, warum sie die vollzogen hatte, vollziehen musste. »Alles stimmte zwischen uns, alles war unsagbar harmonisch. Und doch musste ich weg. Der Heiratsantrag … das war zu viel gewesen.
Aber ich wusste damals schon, dass Raymond das nicht verdient hatte«, sagte sie in einem Ton, der auch heute noch den Schmerz deutlich werden ließ, den sie damals wohl genau so empfunden und den sie durch ihre panikartige Flucht zusätzlich auch über ihren beinahe Verlobten gebracht hatte.
»Aber ich wusste damals noch nicht, was mir Frauen bedeuten. Wobei … In meinem Leben hat es bislang erst eine Frau gegeben. Doch die ist es und keine andere … meine Bella.« Ein verzagtes Lächeln umspielte ihr kurz den Mund, verschwand aber wieder hinter Erinnerungen, die voller Mühsal schienen.
»Doch vorher … Nach der Trennung von Raymond tobte ich mich erst einmal aus«, fuhr sie entrückt fort, »weil ich glaubte, dass es das war, was mich von ihm fortgejagt hatte. Mein schlechtes Gewissen trieb mich jahrelang um die Welt, von Event zu Event, von Einladung zu Einladung, von Ball zu Ball.
Und hier und da gab es auch immer wieder irgendeinen Kerl. Nie etwas Festes. Und immer war es einer dieser selbstverliebten Zyniker, die nur nehmen, rücksichtslos. Und … so schlimm es jetzt auch klingen mag, aber je rücksichtsloser sie waren, je weniger ich ihnen bedeutete, desto größer war der Kick, ja … der Kick. Gefühle waren nie im Spiel. Auch für mich nicht …« Elektra brach kurz ab und schien erneut ein paar Gedanken zu ordnen.
Was für eine traurige Seele, dachte Silvana und hätte fast geheult. Rasch nutzte sie die Stille, huschte drei Schritte zu einem Sessel, der außerhalb von Elektras Blickfeld stand, und setzte sich. Sie wollte die Gedanken der anderen Frau nicht unterbrechen, auch wollte sie nicht, dass Elektra ihr in die tränenverhangenen Augen sah.
Langsam, den Blick wieder starr nach innen gerichtet, fuhr Elektra dann fort: »All das änderte sich schlagartig, als ich von Raymonds Heirat erfuhr.
Dass der Adel im Gutshaus versammelt war und ich nicht dabei war, konnte ich verschmerzen, verstand ich sogar, dass Ray aber eine Bürgerliche geheiratet hatte, traf mich mitten ins Herz.«
Erschrocken wendete sie den Kopf und sah Silvana aufgeregt an. »Nein, bitte, Silvana, verstehen Sie mich nicht falsch, nicht die Tatsache, dass seine Frau … Ihre Freundin, eine Bürgerliche war, traf mich, viel mehr war es der Umstand, dass mir sofort klar war, dass er diese Frau abgöttisch lieben musste. Und dass damit seine Liebe zu mir … gänzlich erloschen war.
Diese Gewissheit traf mich damals beinahe wie … wie ein Todesstoß. Ja, wie ein Todesstoß.
Das mag übertrieben klingen, dennoch war es so: Ein Todesstoß … der auch tatsächlich etwas in mir beendete.«
Abermals brach Elektra ab, schloss die Augen und öffnete sie Sekunden später wieder. Und noch immer ruhte ihr Blick in der Vergangenheit. »Raymond hatte eine Frau an seiner Seite, die seine Familie gänzlich ablehnte, das wusste ich. Niemand musste mir das sagen. Ich kenne seine Familie zur Genüge.
Melissa Scholz. Er muss sie wirklich sehr geliebt haben«, sagte sie, wobei sie den Namen … Melissa Scholz … kaum vernehmbar auf der Zunge zergehen ließ.
Abrupt drehte sie den Kopf und richtete ihren Blick erneut, klar und fragend, auf Silvana. »Sein Vater war bestimmt der Einzige, der nicht über ihn und auch nicht über beide herfiel, als Raymond seine Melissa in die Familie einführte, denke ich mal. Aber der … Hat Raymond Ihnen je von ihm erzählt?«
Silvana schrak zusammen, sie hatte nicht mit einer Frage gerechnet, sie war mit ihren Gedanken gerade an einem ganz anderen Punkt. Sie hatte versucht, sich vorzustellen, welch Tortur all das für die Frau hier vor ihr wohl gewesen sein musste. Jahrelang vor sich selbst weglaufen, ein schlechtes Gewissen haben und dann auch noch die letzte Verbindung zu einem Leben, zu einer Liebe verlieren, die ihr offensichtlich einmal sehr kostbar gewesen war. Das muss schrecklich gewesen sein.
»Nein«, sagte Silvan schließlich mit verwirrter Stimme, räusperte sich und fuhr fort: »Er hat noch nie von ihm, von seinem Vater erzählt. Auch Mel … Melissa hat mir nie etwas … doch, halt, einmal, am Telefon … von dem Unfall.«
»Aber Sie haben ihn doch kennengelernt? Auf der Hochzeit?«
Silvana zucke die Achseln. »Ich habe ihn gesehen. Aber kein Wort mit ihm gewechselt. Obwohl … wenn ich es recht bedenke … mehr als einmal hat er mich an den zwei Tagen, die ich dort war, beobachtend angesehen. Beinahe so, als wollte er nicht glauben, dass es mich gibt. Wer weiß, was Mel ihm von mir erzählt hat. Aber am Ende irre ich mich vielleicht auch.
Es ist zu lange her. Doch weiß ich ziemlich sicher, wir haben kein Wort … Nein … bestimmt nicht.«
»Das ist schade. Neben Raymond war er der einzig wirkliche Mensch in der Familie. Aber lassen Sie sich von ihm mehr erzählen. Es lohnt sich.«
Elektra wendete sich ab und ihr Blick verlor sich wieder irgendwo weit entfernt.
Und sie fuhr fort. Doch ihre Stimme hatte sich verändert, hörte sich jetzt gequält an. »Zwei, drei Monate nach der Hochzeit war ich zu einer Gala nach L. A. eingeladen worden. Gern hatte ich diese Einladung angenommen, zumal ich wusste, Henri-Severin, Raymonds Bruder, würde auch auf dieser Gala zu finden sein. Was auch stimmte.
Ich hoffte, er würde meine Traurigkeit … Ja, es gab da tatsächlich eine tiefe Traurigkeit, die Raymonds Heirat in mir ausgelöst hatte.
Jedenfalls hoffte ich, er würde nachempfinden können, was in mir vor sich ging, zumal er ja auch irgendwie anders gewesen war. In all seinen Lebensentscheidungen. Ich ersehnte am Ende sogar ein wenig familiäre Absolution. Ja, all das erhoffte ich tatsächlich.
Doch es kam ganz anders.
Eingangs schien es, als würde Henri-Severin mich verstehen. Er machte mir Mut, stellte Raymond dann aber bald schon als einen Versager hin, den ich fünf Jahre später sowieso verlassen hätte. ›Dann hättest du vielleicht die schönsten Jahre deines Lebens verschenkt‹, hatte er gesagt. Seine Worte waren schrecklich und furchtbar deprimierend, denn nun wusste ich, er hatte mich nicht verstanden. Gar nichts hatte er verstanden.«
Wieder stockte Elektra und presste schließlich die Lippen fest zusammen, so, als wollte sie sich verbieten, die nächsten Worte auszusprechen.
»Doch dann tat ich etwas«, fuhr sie endlich undeutlich flüsternd fort, »das ich glaubte, tun zu müssen, obwohl ich mich dafür vom ersten Moment an gehasst hatte … und auch heute noch schäme.
Viel weniger als Raymonds Andenken wollte ich Henri-Severins Zuspruch und Nähe in diesem Moment verlieren. Ich … ich fühlte mich so unsagbar allein und … einsam. Und er war da. Auch wenn er mich weniger und weniger verstand. Er war aber immer noch so eine Art Brücke zu Raymond. Und bald schon nickte ich nur noch zu all den Bösartigkeiten, die Henri-Severin über seinen Bruder, über seine Familie mit Ausnahme seines Vaters verlor.
Ich spürte, sollte ich ihm widersprechen, würde ich nicht nur seinen Zuspruch, den ich bitter nötig hatte, auch würde ich diese Brücke und am Ende sogar mich selbst verlieren.
Vielleicht klingt das jetzt irgendwie geschwollen, hochtrabend, gar pathetisch, aber so fühlte ich mich damals. Ich war dabei, mich zu verlieren. Und … ich hatte Angst vor der Konsequenz.« Wieder brach Elektra ab. Die Konsequenz, wie sie damals auch immer ausgesehen haben mag, hätte wohl erschreckende Ausmaße gehabt.
Silvana schloss die Augen. Von Frau zu Frau, hallte ihr plötzlich durch den Kopf.
Hatte sie so etwas erwartet? Nein, sicher nicht. Das, was hier vor sich ging, war viel mehr – es war ungeahnt erschreckend.
Und es sollte noch schlimmer kommen.
Nun gänzlich in sich versunken, fuhr Elektra fort: »Das Zusammensein mit Henri-Severin gab mir dennoch auch ein kleinwenig das Gefühl der Sicherheit. Bitterböse erkauft.
Aber dann, beim fünften Treffen, geschah das Entsetzliche … Ich verlor alles.
Zum ersten Mal war ich mit Henri-Severin in sein Appartement gegangen. Wir hatten uns vorher immer irgendwo zum Essen getroffen und dann dort noch lange miteinander gequatscht. Man konnte tatsächlich gut mit ihm quatschen, wenn es nicht um seine Familie ging.
Aber an diesem Abend, ich weiß es noch genau, da wollte ich mehr. Und ich spürte, auch Henri wollte mehr.«
Während sie sich völlig unbedarft in seiner Wohnung umgesehen hatte, spürbar enttäuscht von der Lieblosigkeit, die all die Dinge innehatten, die offensichtlich sein wahres Leben ausgemacht hatten, war er unversehens über sie hergefallen. »Ich wollte ihm noch sagen und zeigen, dass ich es auch wollte, aber es interessierte ihn nicht. Er wollte auch nicht mich, er wollte meinen Körper, schlimmer noch, er wollte meinen Schmerz.«
Wie ein Tier war er über sie gekommen. Böse, brutal und überstark. Sie hatte sich gewehrt, anfänglich, wollte dann nur noch rasch weg. »Aber das machte ihn noch mehr an. Er war einfach zu kräftig.« Ihr Widerstand war dann auch bald gebrochen. Am Ende hatte sie sogar geglaubt, sie hätte es verdient – diese »Strafe«.
Er hatte sie genommen, brutal, immer wieder und nur anal.
»›Ganz sicher hat dieser Schwächling sich nie getraut, dich so zu ficken, stimmt’s? Sag, dass es stimmt‹, hatte er wieder und wieder gebrüllt.« Worte, die Elektra heute kaum wagte zu wiederholen. Sie tat es aber, denn all diese Worte wollten endlich gesprochen und gehört werden.
»Auch schlug er mich dabei. Ich blutete. Im Gesicht. Unten. Überall. Es hat ihn nicht interessiert. Mir war es schließlich auch bald egal gewesen.«
Elektra stockte, und sie zitterte. Die Hände hatte sie in der Zwischenzeit unter ihren Oberschenkeln vergraben und ihr Oberkörper wippte vor und zurück, immer wieder vor und zurück. Und sie wagte nicht, Silvana anzusehen. Auch heute noch schien sie sich dafür zu schämen. Ihr war Leid angetan worden und sie schämte sich dafür. Was für eine grauenvolle und schrecklich verirrte Selbstverachtung.
Sie saßen jetzt beide auf der Couch, nur eine Handbreit voneinander entfernt, Silvana war vor Augenblicken von ihrem Sessel aufgesprungen und zu ihr geeilt, dennoch wusste sie nicht, was sie tun sollte. Eine ungeheuer schändliche Welt in Elektras Erinnerungen wollte jetzt vielleicht keine menschliche Nähe spüren, war sie doch durch die Nähe zu einem Menschen verursacht worden – sie wollte wohl nur ausgesprochen und vernommen werden.
Leise fuhr Elektra schließlich fort: »Ich hatte die ganze Zeit nur gebetet. Nicht um mein Leben, nein, … ›Lieber Gott, lass mich sterben. Jetzt, sofort‹, war mein Gebet gewesen.
Aber ich war nicht gestorben.«
Wieder stockte Elektra und schüttelte den Kopf. Nein, ich war nicht gestorben, schien sie sich zu sagen. Auch hatte es den Anschein, als hätte sie den tiefsten und dunkelsten Grund ihrer Beichte erreicht, denn mit veränderter, beinahe kraftvoller Stimme fuhr sie fort: »Nachdem er mich ein letztes Mal genommen, bestraft hatte, in der Zwischenzeit war es Morgen geworden, warf er mich aus seinem Appartement. ›Solltest du zur Polizei gehen, werde ich alles abstreiten‹, hatte er gesagt. ›Ich habe Freunde, einflussreiche Freunde, die beschwören werden, dass ich letzte Nacht gar nicht in L. A. war.‹
Wie lächerlich er war. Er hatte wirklich geglaubt, im Zweifelsfall damit durchkommen zu können.« Elektra schüttelte den Kopf. »Aber ich hatte nicht vor, zur Polizei zu gehen. Auch sah ich ihn nie wieder.
Doch schlimm ist, ab und an taucht er in einem schrecklichen Traum wieder auf. Ich werde ihn einfach nicht los.«
Vielleicht ja doch. Jetzt! Weil es endlich einmal ausgesprochen ist, dachte Silvana und wünschte es ihr von ganzem Herzen.
Als Elektra dann Monate später von seinem tödlichen Unfall erfahren hatte, hatte sie nichts empfunden. Weder Genugtuung noch Trauer.
»Um Raymonds Vater tut es mir heute noch sehr leid«, sagte Elektra mit wehmütiger Stimme, stand auf und ging zum Fenster. Sie blickte hinaus, die untergehende Sonne konnte sie nicht sehen, dennoch schien die Gewissheit sie innerlich zu beruhigen, auch dieser Tag würde nun bald seine Vollendung finden, wie jeder andere auch.
Schließlich drehte sie sich um und sah Silvana ängstlich an, wobei es eine andere Angst als noch vor Minuten war. Es war die Angst, sich offenbart und verwundbar gemacht zu haben, es war die Angst, für all das Gesagte ausgelacht oder gar weggeworfen werden zu können, es war die Angst vor dem Urteil eines fremden Menschen, dem Urteil, das bewerten, nein, mehr noch, sie hatte Angst vor dem Urteil, das sie abwerten könnte. Als Mensch.
Und schnell sagte sie: »Möchten Sie nicht lieber gehen, Silvana? Ich würde es Ihnen nicht verübeln.«
Was für eine Frage. Nach einer solchen Beichte. Aber vielleicht die einzig legitime Frage einer nackten Seele.
Silvana schüttelte den Kopf. Natürlich würde sie jetzt nicht gehen. Auch vernahm sie mehr und mehr einen bitteren Schmerz, ausgelöst durch all die schrecklichen Erlebnisse dieser Frau, der ihr direkt in die Seele drang. Von Frau zu Frau, nein, von Seele zu Seele schien jetzt angebrachter. Vor Minuten noch gänzlich unvorstellbar.
Obwohl Silvana nicht gehen wollte, auch nicht gehen konnte, wusste sie nicht, was sie tun sollte. Am liebsten wäre sie aufgesprungen und hätte die junge Frau, die noch immer verzagt, ängstlich und mit hängenden Schultern am Fenster stand, in den Arm genommen. Aber das schien ihr dann doch unangemessen.
Stattdessen sagte sie, auch weil sie spürte, dass Elektra mit all dem, was in ihr rumorte, wohl noch nicht gänzlich am Ende angelangt war: »Wollen wir nicht rausgehen, ein wenig durch die Stadt laufen und dann irgendwo einen Kaffee trinken? Im Laufen erzählt sich vieles sehr viel leichter. Zumindest ist das bei mir so.«
Elektra sah Silvana lange und aus tiefer Seele an, schüttelte nachdenklich den Kopf und hatte plötzlich Tränen in den Augen. Schließlich sagte sie: »Wer sind Sie, Silvana? Ein Engel?«
Silvana stand auf und lachte verlegen, eine Träne drückte augenblicklich und eine merkwürdige Frage huschte ihr dabei durch den Kopf. Sind Engel Heilige? Oder Heilige Engel?
Doch wusste sie, dass sie weder das eine noch das andere war. Gleichwohl fragte sie sich wieder einmal, wer sie eigentlich wirklich war. Und fand erneut keine Antwort.
*
Minuten später waren sie Teil der frühabendlichen Stadt. Menschen, die an ihnen vorbeigingen, hielten sie sicher für zwei Fremde, die nur zufällig den gleichen Weg hatten. Elektra irrte innerlich durch ihre dunkle Vergangenheit, öffnete hier und dort eine Tür, schloss sie wieder, bis sie schließlich die Tür fand, nach der sie wohl gesucht hatte. Silvana war sprachlos und wagte kaum über das Gehörte nachzudenken.
Nachdem sie so eine Weile stumm durch enge Gassen gelaufen waren, fanden sie bald schon wieder … fanden ihre Seelen wieder zueinander und Elektra erzählte schließlich weiter.
In den nächsten fünf Tage nach diesem »Zwischenfall« – sie sprach tatsächlich selbst von Zwischenfall!, genauso wie sie vorher in ruhigem Ton von Strafe gesprochen hatte – hatte sie sich in einem einfachen Hotel verkrochen.
»Ich begann zu ordnen. Meine Gedanken. Mein Leben. Nie wieder wollte ich einen Mann an mich heranlassen. Merkwürdigerweise war das ein Gedanke, der mir leichtfiel. Und auch unsagbar guttat.«
Und diesen Gedanken musste Gott wohl als Gebet erhört haben, denn einen Tag bevor sie zurückwollte – über New York nach Europa, wohin genau, hatte sie nicht gewusst, vielleicht zu Freunden nach Mailand –, war ihr Bella über den Weg gelaufen.
»Bella war Bedienung in einem Café. Ihre Augen waren zum Überlaufen angefüllt mit Traurigkeit. Das fiel mir sofort auf. In Amerika, besonders in L.A., achtet man mehr auf das Lächeln, auf die weißen Zähne, die dabei zum Vorschein kommen. Weniger auf die Augen. ›Geht es gut?‹, fragt man. Rhetorisch. Niemand möchte etwas anderes als ein ›Ja‹ hören. Wie es einem wirklich geht, interessiert keinen Menschen. Und auch echten Augenkontakt vermeidet man tunlichst. Das sind meine Erfahrungen.
Als Bella mitbekam, dass mir ihre Traurigkeit nicht verborgen geblieben war, lächelte sie kleinherzig. Es war das erste und einzig echte Lächeln, das sie, während sie bediente, von sich preisgab.
Und ihr ging es tatsächlich noch schlechter als mir, wie sie mir am gleichen Abend noch erzählte.
Zufällig … Nein, es gibt keine Zufälle«, sagte Elektra, schüttelte nachdrücklich den Kopf, als wollte sie der Zufälligkeit auf keinen Fall auch nur den geringsten Platz einräumen, und fuhr fort: »Jedenfalls hatten wir gleichzeitig das Café verlassen. Ich wollte zurück ins Hotel, packen, um den nächsten Flieger nach New York zu nehmen, und für Bella war die Arbeit an diesem Tag einfach nur beendet.
Als ich ihr noch einen schönen Abend wünschen wollte, sah ich wieder diese traurigen Augen. Und da konnte ich nicht anders: Ich nahm sie in den Arm. Und sie …? Was tat sie?« Aus großen Augen sah Elektra Silvana an. »Sie begann bitterlich zu weinen und ließ mich nicht mehr los.« Elektra schüttelte den Kopf, und augenblicklich verlor sie sich wieder in ihren Erinnerungen.
Silvana schwieg, hörte wieder nur einfach zu und dachte jetzt nicht darüber nach, wie merkwürdig all das, was hier passierte, doch war. Wie war eine solche Nähe, die man sicher schon als intim bezeichnen konnte, in so kurzer Zeit möglich?, war eine Frage, die immer wieder in ihr hochstieg und genauso schnell wieder zum Schweigen gebracht wurde. Für Antworten hatte Silvana jetzt keine Zeit – sie wollte und musste einfach nur zuhören.
»Ich nahm sie mit in mein Hotel«, fuhr Elektra fort. »Am Ende war es reiner Egoismus. Da gab es jemanden, dem es noch schlechter ging als mir. Und merkwürdig war, ihr zu helfen, sie wie ein kleines Mädchen im Arm zu halten, lenkte mich nicht nur von all meinen Problemen ab, es gab mir sogar Kraft. Es war irgendwie unwirklich.
Verstehst du das? Entschuldigung, verstehen Sie das, Silvana?«
Silvana lächelte. Aber nicht der Frage wegen, sondern weil ihr das Du dieser Frau beinahe vertrauter erschien als dieses fremde Sie.
»Sagen Sie ruhig Du.«
»Ja … Gern. Aber nur, wenn du es auch tust.«
Oh nein! Silvana spürte, wie sie innerlich kurz zuckte.
Aber warum eigentlich?
Offensichtlich gab es hier kein Oben und Unten, auch gab es kein Ablehnen mehr. Doch der erste Eindruck, vor Wochen geprägt, saß tief. Und das alles hier ging auch viel zu schnell. Menschen sind normalerweise nicht so. Obwohl … in ihrer Nähe war es oft anders. Also …
»Gut. Ich versuche es, Elektra.«
»Das freut mich. Und … da wäre noch etwas …« Verschämt ließ Elektra den Blick fallen. »Könntest du mich jetzt einmal … ganz kurz nur … in den Arm nehmen?«
Hastig zuckte Silvana äußerlich zurück, etwas, das Elektra nicht verborgen blieb. Doch verstand sie es falsch. Sie konnte ja nicht wissen, dass Silvana es schon längst gern getan hätte, doch hatte sie nicht gewusst … Und im Moment hatte sie die Frage nur überrascht.
»Nein, bitte, vergiss es wieder«, sagte Elektra. »Oh mein Gott, das könntest du jetzt tatsächlich falsch verstehen … Nein, es tut mir leid. Lassen wir das. Manchmal bin ich ziemlich unbeholfen, auch wenn viele das nicht wissen oder gar sehen. Entschuldige. Und …«
Weiter kam sie nicht mit ihrer stotternden Erklärung, die durchweg sinnlos war. Im nächsten Moment lag sie in Silvanas Umarmung. Und sie begann bitterlich zu weinen.
*
Ein paar Minuten später, nachdem sich Elektra wieder halbwegs beruhigt hatte, gingen sie weiter und saßen bald schon in einem Café.
Und Elektra fuhr dann mit all dem, was ihr heute noch auf der Seele brannte, fort: »Gern würde ich dir noch von Bella erzählen.
Ich weiß nicht warum, aber merkwürdigerweise fällt es mir nicht schwer, dir all das zu erzählen.
Über Rafi, über unsere Liebe, die gänzlich anders war, als viele Menschen auch heute noch glauben zu wissen, möchte ich jetzt nicht sprechen. Eines nur: Er war ein wundervoller Mann, völlig anders, als man ihn in der Presse oder gar im Internet dargestellt hat und es noch immer tut. Wie er wirklich war, hat nicht einmal seine engste Familie gewusst.«
Elektra trank einen Schluck Kaffee und erzählte dann weiter, von der ersten Nacht, als Bella in ihrem Arm gelegen und bitterlich über den Verlust ihrer Liebe, Gabrielle, eine junge Frau aus L. A., geweint hatte. Dass sie von einer lesbischen Liebe gesprochen hatte, hatte Elektra erst Stunden später begriffen.
»Ich war unsagbar naiv, was das betraf. Aber vielleicht war auch tief in mir etwas, das die Liebe zwischen zwei Frauen als völlig normal ansah und nur darauf gewartet hatte, endlich geweckt zu werden.
Und das tat Bella, durch Worte, durch Gesten und durch ihre unverkrampfte Offenheit. Aber nicht gleich.
Wirklich ernst wurde es erst zwei Wochen später. Bella hatte gespürt, dass es da in mir etwas gab … Sie hatte es einfach gefühlt, wie sie mir später erzählte.
Alles hatte mit einem Streicheln begonnen. Ihre Hände … es war wunderbar, sie zu spüren.«
Die Liebe zu Bella tat ihr gut, erschreckte sie aber auch. Sie begehrte eine Frau. Das war anfänglich, trotz dieser rasch verspürten Normalität, unsäglich befremdlich, dennoch schön, sehr schön … beinahe zu schön.
Und so war das gekommen, was kommen musste: »Nach weiteren zwei Wochen trennte ich mich von Bella. Obwohl … ich trennte mich nicht, ich rannte davon. Wieder einmal. Doch dieses Mal wusste ich, ich konnte nicht entkommen. Ich wusste, wenn ich überleben wollte, musste ich zurückkehren.
Findest du das übertrieben? Meine Worte? Meine Gedanken? … Mein Entzücken?«
Silvana lächelte, und sie schüttelte den Kopf. Liebe ist ein Wunder und wer findet für Wunder schon die passenden Worte. Und sie schwieg nur und hörte weiter zu.
»Und im Moment, als ich endlich wusste, dass ich zurückwollte, zu Bella zurückmusste, da geschah es. Es war auf dem Geburtstagsempfang eines Schauspielers, der Name ist so unwichtig wie dessen Schauspielkunst.
Ich weiß es noch wie heute, es war dort sterbenslangweilig. Ich wollte gerade gehen, zu Bella, ich wusste, ihre Schicht würde gleich enden, ich wollte ihr endlich … da lief mir Rafi über den Weg. Rafi, der Mann meines Lebens.
Eigentlich wollte ich nichts von ihm. Aber da war etwas … er war so ganz anders. Dennoch …
Noch in derselben Nacht hatte ich wieder mit Bella das Bett geteilt. Und obwohl ich Rafi bald schon heiratete, mit ihm und bei ihm lebte, gab es immer wieder auch Bella. Rafi wusste es.
Es war für uns drei eine schöne Zeit, aber wie gesagt, davon vielleicht irgendwann einmal mehr.«
Mit dem Tod ihres Mannes hatte sich dann alles geändert. Bella war mehr und mehr zum Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Auch hatte Elektra aus Kolumbien weggewollt. »Ich wollte endlich ›richtig‹ mit Bella zusammen sein. Das wäre auf Perdida nie gegangen.«
Aber dann war es geschehen. »Letztes Jahr. Es war der zweite Oktober. Ein Samstag. Ich werde es nie vergessen. Es war … es war schrecklich.«