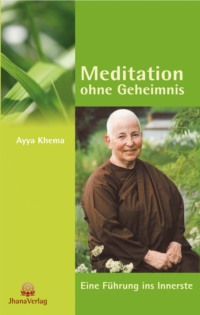Kitabı oku: «Meditation ohne Geheimnis», sayfa 2
II
Meditationsmethoden
Es gibt unendlich viele Meditationsmethoden, und wenn ihr genügend Zeit habt, könnt ihr sie alle ausprobieren; ein Menschenleben ist aber zu kurz dafür. Eine Methode ist nichts weiter als eine Methode, sie ist nicht die Meditation. Meditieren fängt an, wenn die Methoden aufhören. Aber irgendeine Methode braucht man, um zur Meditation zu kommen. Sie ist sozusagen der Haken, an den wir den Geist hängen können.
Ich beschränke mich auf die Methoden, die mir am günstigsten vorkommen. Das heißt keineswegs, es gebe nicht andere, die auch günstig sind. Man kann aber unmöglich in so kurzer Zeit eine Methode nach der anderen lehren und lernen; es käme nur noch mehr Verwirrung in den Geist.
Man bleibt also bei einigen Methoden und wählt solche, die einander ergänzen, wie zum Beispiel die Atem-Meditation und die Einsichts-Meditation, die Liebende-Güte-Meditation und die Geh-Meditation, die schon allein körperlich notwendig ist für diejenigen, die im Sitzen noch nicht so geübt sind. Hinzu kommt die Kontemplation.
Alle Methoden und Richtlinien sind bloß die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, nicht das vollendete Bauwerk. Jeder hat seinen eigenen Weg zu finden, welche er kombiniert, welches Werkzeug er bevorzugt. Es sollte das sein, mit dem man am schnellsten und einfachsten zur Konzentration kommt. Es hat keinen Sinn, sich lange damit abzugeben, Konzentration zu erlangen. Denn das Werkzeug ist nichts als der Schlüssel. Zunächst gilt es, die Tür mit dem Schlüsselloch zu finden.
1. Atem-Meditation
Am Anfang ist unser Meditationsobjekt der Atem.
Der Atem ist traditionell ein sehr günstiges Meditationsobjekt, weil ihn jeder sowieso bei sich hat, er Leben bedeutet und die einzige autonome und auch manipulierbare Körperfunktion ist. Wir können den Atem zwar nicht abstellen aber zum Beispiel anhalten oder verlängern. Atmen ist also eine Körperfunktion, die Möglichkeiten bietet, den Geist darin zu erkennen.
Wenn wir den Atem als Meditationsobjekt benutzen, haben wir verschiedene Arten der Betrachtung zur Auswahl.
Die erste ist, ihn nur an der Nasenspitze zu empfinden, an den Nasenlöchern oder direkt unter der Nase über der Oberlippe. Der Atem macht Wind, und der Wind verursacht auf der Haut ein Gefühl, das uns hilft, uns auf diese Stelle zu konzentrieren. Es ist ein ganz kleiner Punkt, der kleinste und feinste, sodass die Achtsamkeit einspitzig wird.
Sich auf den Atem konzentrieren heißt den Geist in den Atem fallen zu lassen. Versucht nicht, etwas Besonderes mit dem Atem zu machen, wie schnaufen oder ganz tief atmen.
Es kommt oft vor, dass Anfänger den Atem erst einmal gar nicht finden können. Sie sind es nicht gewöhnt, auf den Atem zu achten. In dem Fall sind ein oder zwei tiefe Atemzüge, zu Beginn der Meditationssitzung, angebracht.
Für den Anfänger kann es ferner hilfreich sein zu zählen: „eins“ beim Ein- und „eins“ beim Ausatmen; „zwei“ beim Ein-, „zwei“ beim Ausatmen; nicht weiter als bis „zehn“, dann wieder bei „eins“ beginnen.
Geht auch jedes Mal zu „eins“ zurück, wenn die Gedanken von der Meditation abgeschweift sind, und überlegt nicht, bei welcher Zahl ihr stehen geblieben seid. Das würde das Denken erst recht in Gang bringen. Da unser Geist nicht trainiert ist, kommt er leicht in eine Bahn, die ihn von außen berührt.
Als dritte Möglichkeit kann man den Atem so weit hinein- und herausverfolgen, wie man ihn erkennen kann, zum Beispiel bis zur Lunge oder bis zur Bauchdecke, wie sie sich hebt und senkt, oder im Hals, wo immer es sein mag, manchmal weit, manchmal weniger weit. Es ist zwar nicht einspitzig, aber hilfreich, weil es interessanter ist: Der Geist muss sich ein bisschen mehr engagieren, und da das seine Gewohnheit ist, bleibt er eher bei der Sache.
Wer gewohnt ist, das Auf und Ab der Bauchdecke zu beobachten, kann ruhig dabei bleiben. Ich lehre diese Methode nicht, weil ich die Bauchdecke als eine zu große Fläche empfinde. Für den Anfang ist sie insofern günstig, als man, wie beim Atem selber, genau die Details erkennen kann. Um die Achtsamkeit zu schärfen und die Unbeständigkeit klar zu erkennen, ist es nötig, Anfang, Mitte und Ende des Atems unterscheiden zu lernen. Im Alltag kümmert man sich ja nicht darum, ob der Atem am Anfang, in der Mitte oder am Ende ist. Auch an der Bauchdecke können wir erkennen, wie sie anfängt sich zu heben, sich in der Mitte vollkommen gehoben hat und dann wieder senkt. Je mehr Details man unterscheiden kann, desto achtsamer ist man.
Achtsamkeit bedeutet, etwas unter die Lupe zu nehmen und nicht alles so, wie es ist, als selbstverständlich anzusehen.
Obwohl wir im Prinzip alle gleich sind, haben wir doch unterschiedliche Tendenzen und auch unterschiedliche Stärken.
Mancher Menschen Geist ist mehr zur Ruhe geneigt, anderer mehr zum Nachdenken; der eine neigt zum Verbalisieren, der andere sieht die Welt in Bildern. Man sollte das, was erscheint, zum Erkennen benutzen, um es dann aber fallen zu lassen.
Für einen Geist, der viel verbalisiert, ist es günstig, mit bestimmten Worten zur Ruhe zu kommen, zum Beispiel einem Mantra. Man suche sich ein Wort aus und benutze es zusammen mit dem Atem, zum Beispiel „Frieden“ einatmen und „Frieden“ ausatmen oder „Frie-“ ein- und „-den“ ausatmen. Oder „Liebe“ einatmen und „Liebe“ ausatmen beziehungsweise „Lie-“ ein- und, „-be“ ausatmen.
Ein eher mathematischer Geist mag das bereits erwähnte Zählen hilfreich finden.
Einem Geist, der in Bildern wahrnimmt, verhilft vielleicht ein Bild zur Konzentration. Er kann zum Beispiel den Atem als eine Wolke wahrnehmen, die sich beim Ein- und Ausatmen vergrößert und verkleinert.
Ein Geist, der gewohnt ist, Geschichten zu erzählen, muss die Geschichte erkennen, fallen lassen und durch den Atem ersetzen.
Die Methoden sind individuell verschieden, nicht aber die Resultate; es gibt nur die beiden Richtungen, Ruhe und Einsicht/Klarblick.
Es ist nötig, einmal in sich selbst zu erkennen: Was ist meine Stärke, was kann ich wirklich? Kann ich den Geist ruhig halten und mich auf das Meditationsobjekt Atem konzentrieren? Oder brauche ich ein Wort oder Bild oder Zählen dazu? Oder muss ich erst einmal erkennen, was in mir vorgeht, und damit dann zur Ruhe kommen?
Alle aufgeführten Möglichkeiten sind gleich gut. Probiert aber nicht in einer einzigen Meditationssitzung alle nacheinander aus. Bleibt bei einer und gebt ihr erst einmal eine Chance. Bewährt sie sich nicht, ändert ihr in der nächsten Meditationssitzung die Methode.
Wenn wir ein Meditationsobjekt wie den Atem benutzen, müssen wir wissen, was wir mit der Atembetrachtung eigentlich bezwecken. Wir betrachten den Atem ja nicht, um den Atem zu betrachten, wie manche meinen. Wir betrachten den Atem, um zu Ruhe und/oder Einsicht zu kommen, aus keinem anderen Grund. Auf dem Atem bleiben bringt Ruhe. Den Atem als unbeständig zu erkennen bringt Einsicht. Wozu sonst sollte man den Atem betrachten? Er geht ja sowieso rein und raus. Indes zu sagen, „den Atem betrachten beim Atembetrachten“ ist sinnvoll, denn es bedeutet, dass man nur eines auf einmal tut.
Das Erste, was man mit der Atembetrachtung bezweckt, ist also zur Ruhe zu kommen, das heißt das Denken aufzugeben und nur zu erkennen, nur zu erleben. Den Atem erleben heißt: Wir können erleben, dass er ein- und ausströmt, ein Wind ist, und dort ein Gefühl verursacht, wo er die Nasenlöcher berührt. Wir können erleben, dass er manchmal länger und manchmal kürzer ist, ihn vielleicht bis zur Lunge, vielleicht bis zum Bauch, vielleicht auch nur bis zur Nase verfolgen. Wenn es uns gelingt, mit unserer Konzentration dabeizubleiben und nicht zu denken, kommt ein Gefühl der Problemlosigkeit, der Ruhe. Denn Probleme muss man denken, sonst hat man keine. Das Beste ist immer, nur den Moment zu erleben, und der ist Atmen. Wird man von der Atembetrachtung abgelenkt, ist das Einzige, was in diesem Moment außerdem existiert, das Sitzen. Der Geist kann also zu dem damit verbundenen Gefühl gehen: Hier sitzt eine Masse, die einen Druck von unten hat.
Störenfried: Ablenkende Gedanken
Wenn man nicht bei der Atembetrachtung bleiben kann, weil der Geist unruhig ist und abschweift, werden Gedanken kommen. Sie zu erkennen bringt Einsicht, so wie den Atem zu betrachten Ruhe bringt. Man muss von den Gedanken zurücktreten, statt sich mit ihnen zu identifizieren. Auf diese Weise lernt man kennen, von welcher Art sie waren: Zukunft oder Vergangenheit.
In beiden können wir nicht leben. Zukunft ist nichts als eine Hoffnung und ein Wunschtraum und ganz ungewiss. Die Vergangenheit ist ein- für allemal vorbei. Wir können nur den jeweils gegenwärtigen Augenblick benutzen; einen anderen haben wir nicht, er ist unser Leben.
Das ist etwas, was wir in der Meditation zu lernen haben. Der erste Schritt, mit den Gedanken etwas anzufangen, ist zu wissen, dass sie da sind, statt einfach zu denken. Ob wir gehen, stehen, sitzen, liegen, vom Aufwachen bis zum Einschlafen, denken wir. Automatisch und instinktiv spielen wir unsere Gedankenspiele. Das ist ermüdend, energieraubend und unproduktiv.
Der Geist denkt, weil das seine naturgegebene Funktion ist, so wie ein lebender Körper atmet. Denken hat so, wie es ist, keine Richtung. Es ist ein Film, der pausenlos abläuft, alle Varianten kommen vor: Stummfilm in Schwarzweiß, Stummfilm in Farbe, Farbfilm mit Text, Schwarzweißfilm mit Text oder auch nur Text ohne Bilder. Solange er ohne jede Unterbrechung läuft, wissen wir gar nicht, dass es ein Film ist und dass eine Leinwand da ist, auf die er projiziert wird. Diese Leinwand ist sauber, weiß und ruhig. Wenn wir das erkannt haben, erscheint es uns wünschenswert, öfter eine Pause zu machen in diesem unaufhörlichen Ablauf des Gedankenfilms, der vom Hundertsten ins Tausendste geht und immer nur den Wunsch des Geistes erfüllt, gefüttert zu werden.
Kehrt, sobald ihr gewahr werdet, dass der Film läuft, zu eurem Meditationsobjekt zurück.
Als Erstes haben wir also von diesem Denken einen Schritt zurückzutreten und als neutraler Beobachter zu registrieren, dass Gedanken gekommen sind. Wenn sie nicht sofort wieder verschwinden und ihr zum Meditationsobjekt Atem zurückkehren könnt, verseht jeden Gedanken mit einem Etikett, nennt das Kind beim Namen: „Zukunft“, „Vergangenheit“, „Erinnerung“, „Widerwille“, „Ablehnung“, „Hoffnung“, „Fantasie“, „Träumerei“, „Aufruhr“, „Wünsche“, „Selbstmitleid“ , „Unsinn“, „Flucht“, was immer, und kehrt zum Atem zurück. Gebt ihm den erstbesten Namen, der euch in den Sinn kommt, und versucht nicht den treffendsten zu finden. Das würde nur neues Denken bedeuten.
Oder sagt „denken, denken“, „nicht denken, nicht denken“ oder „wozu denn denken“ oder „schon wieder denken“ oder „hör auf zu denken!“
Dass die Gedanken bald wiederkommen, ist eine andere Sache. Deshalb praktizieren wir beide Richtungen: zur Ruhe kommen, um beim Meditationsobjekt Atem bleiben zu können und ohne zu denken und damit ohne Probleme zu sein, sowie das Denken einzuordnen, um zu wissen, was in unseren Gedankengängen eigentlich vor sich geht, im Alltag nicht anders als in der Meditation.
Ob wir in der Straßenbahn oder auf dem Meditationskissen sitzen, der Denkprozess ist immer derselbe. Wer in der Meditation erkennt, worum es sich beim Denken wirklich handelt, und es durch Atembetrachtung ersetzen kann, vermag auch im Alltag das ewige Denken einmal fallen zu lassen und durch etwas zu ersetzen, das heilsam ist: Gefühle der Liebe, des Mitgefühls, der Mitfreude und vor allem des Gleichmuts.
In der Meditation lernen wir also das Fallen lassen, das Loslassen der Gedanken durch Erkennen und Ersetzen. Wenn man das einige Male getan hat, erkennt der Geist von selbst, dass Denken in der Meditation keinerlei Zweck erfüllt und ganz nutzlos ist, weil das, was hochkommt, weder Anfang noch Ende hat, vollkommen unbeständig und bedeutungslos ist. Das ist eine sehr wichtige Einsicht, vielleicht die wichtigste zu Beginn der Meditationspraxis.
Es hat keinen Sinn, Meditation als eine nebulöse Fantasiegestalt anzusehen, als etwas, das mal glückt und mal nicht. Meditation ist ganz gezielte Nachhilfe für den Geist, sodass er sich daran gewöhnt, problemlos durchs Leben zu gehen. Es ist im Grunde ganz einfach, man muss nur wissen wie. Fallen lassen, loslassen! Das Festhalten an den Gedanken ist vollkommen unnötig.
Es ist auch nicht von Nutzen, sich zu wünschen, zu hoffen oder zu erwarten, dass die Gedanken verschwinden. Nutzbringend ist nur, sie zu beobachten und zu erkennen. Wenn man nämlich als neutraler Beobachter seiner Gedanken sieht, wie sie hin- und hersausen und keine Festigkeit haben, ist es einfacher, sie fallen zu lassen. Nur solange man sich in sie verspinnt und sich mit ihnen identifiziert, behält man sie.
Fallen lassen ist der Weg des Verzichts. Das spirituelle Leben ist ein Leben des Verzichts auf die weltlichen und in der Welt zu findenden Sinnesbefriedigungen, weil man eine ganz andere Befriedigung gefunden hat. Wenn wir also nicht einmal auf einen Gedanken verzichten können, wie dann eines Tages auf die Welt? Was wir ja am Ende unseres Lebens sowieso müssen.
Störenfried: Ablenkende Gefühle
Genauso störend wie Gedanken sind in der Meditation Gefühle. Es ist ganz natürlich, dass sich nach einiger Zeit des Stillsitzens, vor allem beim Anfänger, ein unangenehmes Körpergefühl bemerkbar macht, hervorgerufen durch die ungewohnte Sitzstellung. Diese Gefühle sind sehr wichtig, mit ihnen müssen wir arbeiten, statt unserer instinktiven Tendenz zu folgen, dem Schmerz auszuweichen, indem wir die Stellung wechseln. Unsere instinktive und immer wiederkehrende Haltung allen unangenehmen Gefühlen gegenüber ist nämlich Weglaufen, so schnell wie möglich, um sie loszuwerden. Aber wohin können wir überhaupt fliehen? Die Erde ist ja rund, wir kommen immer wieder zum Ausgangspunkt zurück: dem Impuls, vor dem unangenehmen Gefühl wegzulaufen.
In der Meditation werden wir gewahr, dass wir durch einen Berührungskontakt, nämlich das Sitzen auf der Meditations-matte, ein Gefühl bekommen haben. Jeder Sinneskontakt ruft Gefühle hervor, und jeder, auch ein Erleuchteter, hat Gefühle. Durch das Gefühl, das entweder angenehm, unangenehm oder neutral sein kann, kommt Mögen oder Nichtmögen. Als Erstes geben wir dem Gefühl einen Namen, zum Beispiel „Schmerz“. Dann fangen wir an nachzudenken. Das geschieht so automatisch, dass wir es gar nicht merken: „Loswerden!“ – und schon bewegt sich der Körper.
Das müssen wir einmal mit Zeitlupe betrachten: Berührungskontakt – Gefühl, entweder angenehm oder unangenehm oder neutral, in unserem Fall unangenehm – Wahrnehmung sagt „Schmerz“ – Gedanken sagen „Weg davon! Ich kann es nicht leiden“.
In dem Moment haben wir schlechtes Karma gemacht – Gedankenformationen sind Karmaformationen –, nicht nur weil es ein negativer Gedanke war, sondern weil wir unserem alten Muster gefolgt sind.
In der Meditation haben wir die Chance, aus dieser alten Gewohnheit herauszukommen und uns zu ändern. Wir können sehen: Es ist ein Gefühl, das ungerufen erschienen ist, andernfalls hätte ich es ja angenehm gemacht. Wieso nenne ich es also mein?
Wir können daraus den Schluss ziehen, dass Gefühle nur Gefühle sind und es uns freisteht, auf sie zu reagieren oder sie einfach fallen zu lassen. In der Meditation ersetzen wir sie durch das Meditationsobjekt, im Alltag durch Gleichmut.
Wem das auch nur für eine Minute gelungen ist, merkt sofort, dass sich der Grad des Unangenehmen um mindestens die Hälfte reduziert hat. Leid wird nämlich erst durch Widerstand stark. Gelingt es nicht, sich auf diese Weise von dem Gefühl abzusondern, kann man sich vollkommen darauf konzentrieren und so seine Veränderlichkeit kennen lernen. Es wird stärker oder schwächer, bewegt sich in sich, hat einen Anfang, eine Mitte – das heißt es bleibt eine Weile – und ein Ende. Wenn man sich ganz stark darauf konzentriert, verschwindet es oft von allein. Außerdem weiß man ja aus Erfahrung, dass es irgendwann sowieso wieder aufhört. Wozu also darauf reagieren?
Dieses unangenehme Gefühl kann ein sehr guter Lehrer sein und uns einmal ganz genau über unsere Reaktionen Klarheit gewinnen lassen. Wenn dann der Geist sagt, „jetzt reicht es aber, jetzt ist das Gefühl zu unangenehm, ich muss mich umsetzen“, gilt es zu erkennen, was der Geist gesagt hat, achtsam den Körper in eine andere Stellung zu bringen und zu akzeptieren, dass man sich von seinem eigenen dukkha hat besiegen lassen. Das ist völlig in Ordnung. Worauf es ankommt, ist das Erkennen – das Erkennen der Gefühle und unserer Reaktionen.
2. Einsichts-Meditation (Vipassanā-Meditation)
Der Name Vipassanā für diese Methode ist etwas unglücklich gewählt, weil vipassanā Einsicht oder Klarblick heißt und sie natürlich nicht die einzige Methode zum Klarblick ist. Jede Meditationsmethode, die wert ist praktiziert zu werden, muss Einsicht/Klarblick bringen.
Die Vipassanā genannte Methode hat als ihre Grundlage die Gefühle, man kann sie auch Achtsamkeit auf die Gefühle nennen: körperliche Gefühle und Emotionen. Im allgemeinen Sprachgebrauch benutzen wir für beide das Wort Gefühl, aber hier müssen wir sie auseinanderhalten, um zu wissen, wovon die Rede ist.
Achtsamkeit auf beide Arten von Gefühlen ist von äußerster Wichtigkeit, weil unsere Gefühle unser Leben bestimmen. Denken ist von den Gefühlen abhängig und deshalb oft so verworren, weil die Gefühle verworren sind. Die Formel dafür ist:
Läuterung der Gefühle bringt Klarheit des Denkens.
Um der Gefühle Herr zu werden, muss man sie kennen, erkennen und – nicht reagieren. Ganz leicht gesagt, aber schwer getan.
Die Vipassanā-Methode, von der ich jetzt spreche, heißt Stück-für-Stück, weil man mit ihr stückweise durch den Körper geht. Ich möchte zunächst erklären, wozu die Vipassanā-Meditationsmethode Stück-für-Stück besonders geeignet ist und was sie uns bringen kann.
a) Achtsamkeit auf die Gefühle
Das Erste ist, dass wir den Gefühlen nahekommen. Da wir anhand unserer Gefühle und nicht unseres Denkens leben, ist es absolut notwendig, sie zu erkennen, und seien sie noch so unangenehm. Viele Menschen nehmen ihre Gefühle effektiv nicht wahr – wie unser Freund in der folgenden Anekdote, die ich immer wieder gerne erzähle:
Ein Assistent am Internationalen Meditationszentrum Rangoon (Burma) war dank der Vipassanā-Meditation seine schwere Migräne losgeworden. Er lud daraufhin einen Freund, der auch an Migräne litt, ins Zentrum ein, um ihn diese hilfreiche Methode zu lehren. Der Freund kam auch, man setzte ihn in eine Meditationszelle und gab ihm die nötigen Anweisungen. Zwei Stunden später schaute der Assistent nach ihm. Er fand ihn, splitterfasernackt, mitten in der Zelle sitzend.
„Wie ist es dir denn in der Meditation ergangen?“
„Ich habe überhaupt nichts gefühlt.“
„Wieso bist du denn ganz nackt?“
„Ich habe derartig geschwitzt, ich musste meine Sachen ausziehen, die liegen klatschnass dort in der Ecke.“
„Aber gefühlt hast du nichts?“
„Nichts!“
Es hat keinen Sinn, nach besonderen Gefühlen zu suchen. Gefühle sind Gefühle. Die Konzentration ist der Grund, warum man sie wahrnimmt. Denn bei unseren alltäglichen Verrichtungen sind wir uns ihrer oft nicht bewusst. Da wir mit Hilfe unserer Gefühle viel über uns lernen können, ist es sehr nützlich, sich mit ihnen zu befassen.
Alle Emotionen, die wir je in unserem Leben hatten, manifestieren sich, das heißt, sie sind ebenso wenig unsichtbar wie unsere Gedanken, obwohl wir das annehmen. Sie setzen sich im Körper fest und erscheinen durch den Körper. Erst kommt die Emotion, zum Beispiel Angst, und dann ist es am Körper sichtbar: Uns stehen die Haare zu Berge.
Die meisten Menschen schenken nur solchen Gefühlen Beachtung, die ganz besonders angenehm oder ganz besonders unangenehm sind. Bei der Vipassanā-Methode ist die Achtsamkeit so geschärft, dass wir jedes kleinste Gefühl im Körper kennen – und zudem verstehen lernen, dass wir es nicht geschaffen haben. Gefühle haben also genauso ihr Eigenleben wie der Körper, dem wir leider auch nicht befehlen können, wie lange er jung und gesund zu sein hat, wir können allenfalls ein bisschen nachhelfen.
Da kommen zum Beispiel Gefühle an Körperstellen hoch, wo wir zuvor nie etwas gespürt haben, die uns fremd sind. Oder es kommen Emotionen hoch, die mit der Körperstelle nichts zu tun haben.
Gerade wegen ihrer starken Wirkung sollte die Vipassanā-Methode Stück-für-Stück am Anfang nicht auf eigene Faust, sondern nur unter kundiger Anleitung geübt werden.