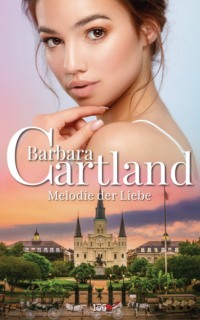Kitabı oku: «Melodie der Liebe», sayfa 2
Sie setzten sich und begannen zu plaudern. Es gab so viel zu berichten, so viele Fragen, so viele gemeinsame Erinnerungen. Und was für den Earl so typisch war - er akzeptierte Robertas Entscheidung, weil sie es so wollte, und machte ihr nicht mehr den Vorschlag, nach England zurückzukehren.
»Ist dir klar, daß du, wenn du bei mir bleibst, niemals bei Hof eingeführt wirst, wie es in unseren Kreisen üblich ist?« fragte er. »Man würde dich bestimmt nicht im Buckingham Palace empfangen.«
»Für mich ist nur wichtig, daß ich bei dir bleiben darf«, erwiderte sie. »Wenn ich bei Großmutter leben müßte, würde ich entweder vor Langeweile umkommen oder eine so fade, uninteressante Frau werden, daß mich sowieso kein Mann ansehen, geschweige denn heiraten würde.«
»Zuallererst mußt du einmal diese Kleider wegwerfen«, meinte der Earl geringschätzig. »In denen würde sogar Aphrodite unattraktiv wirken, was noch untertrieben ist.«
Roberta mußte plötzlich fürchterlich lachen, weil er das auf eine so komische Art gesagt hatte, und der Earl fiel mit ein. Sie fühlte sich, als hätte sie die ganze Zeit in einem finsteren Kerker gehockt und wäre nun hinaus in das strahlendste Paradies getreten.
Der Earl änderte seine Lebensweise nicht, jetzt, da Roberta bei ihm war, und das hatte sie auch nicht von ihm erwartet.
Abends war er immer in Gesellschaft von schönen Frauen, und manchmal durfte Roberta sie zum Mittagessen begleiten oder mit ihnen im Park ausreiten.
Meistens verbrachte er einen Teil des Tages mit Roberta und ließ sie abends allein. Er bestand darauf, daß sie eine Hauslehrerin bekam, um Französisch zu lernen, und eine Tanzlehrerin und eine Musiklehrerin, die ebenfalls zu ihnen ins Haus kamen.
Während sich der Earl auf seine Art amüsierte, sorgte er dafür, daß seine Tochter in die Oper oder ins Theater ging, wann immer dort ein Stück aufgeführt wurde, das er für angemessen hielt. Ihre Französischlehrerin nahm sie mit in die verschiedenen Museen und Kunstgalerien, und sie besichtigten Versailles, Fontainebleau und Notre-Dame.
Alles war anders als in England, wo sie immer gezwungen wurde, alles nur aus Büchern zu lernen, Klassiker mit Tante Emily zu lesen, oder sich im Beisein der alten Lehrerin mit Arithmetik-, Algebra- oder Geometrieaufgaben herumplagen mußte; und danach mußte sie täglich stundenlang Hausaufgaben machen, die meistens darin bestanden, Passagen aus einem Buch abzuschreiben. Was sie in Paris sah und unternahm, faszinierte sie und riß sie mit. Sie wußte, sie würde nicht nur in atemberaubendem Tempo lernen, sondern es würden sich auch tagtäglich vor ihr neue Horizonte auftun.
Eines Tages, als sie schon fließend Französisch sprechen konnte, verliebte sich ihr Vater in eine wunderschöne italienische Contessa. Und noch ehe sie recht begriff, daß sich ihr Leben veränderte, zogen sie auch schon nach Italien.
Sie lebten einige Monate in Venedig, dann in Rom, und schließlich zogen sie in den Süden, nach Neapel. Dort jedoch verblaßte die Liebe des Earls zur Contessa bald. Dafür trat eine neue, außergewöhnliche Frau in sein Leben. Ihr Name war Francine, und sie war zur Hälfte Französin, zur Hälfte Araberin.
Für Roberta war sie die attraktivste und exotischste Frau, die sie sich je hätte vorstellen können. Sie war geschmeidig wie eine Schlange, und in ihren großen, fast schwarzen Augen schienen sich all die Verlockungen und Geheimnisse des Orients widerzuspiegeln.
Den Earl bezauberte sie, und er willigte augenblicklich ein, als sie ihm vorschlug, ihm ihr Land zu zeigen, wie sie es nannte.
Francines Mutter, eine algerische Prinzessin, hatte ihren Vater, einen französischen Diplomaten, in Afrika kennengelernt. Als er dienstlich wieder nach Frankreich versetzt wurde, verließ er Francines Mutter und kehrte zu seiner französischen Frau zurück, die ihn erwartete.
Francine hatte eine ausgezeichnete französische Erziehung genossen, obwohl ihre Mutter Araberin war. Später hatte sie geheiratet, wodurch sie den Beschränkungen, die ihre Familie ihr auferlegte, entfloh. Ob sie dann ihren Gatten verlassen hatte oder er sie brachte Roberta niemals in Erfahrung.
Jetzt war sie jedenfalls frei, reich und auf der Suche nach Abenteuern wie der Earl. Sicherlich würden sie gemeinsam ein aufregendes Leben führen.
Roberta, die die beiden begleiten durfte, war begeistert von all ihren Unternehmungen und fand sie bedeutend lehrreicher, als es irgendeine Unterrichtsstunde je hätte sein können.
Nachdem sie in Frankreich Französisch und in Italien Italienisch gelernt hatte, begann sie nun, sich die arabische Sprache anzueignen. Francine brachte ihr die verschiedenen Dialekte der einzelnen Stämme bei und erklärte ihr auch die Geschichte, die Bräuche und Anschauungen der Araber, denen sie auf ihren Reisen durch Algerien, Marokko, bis hinunter in den Senegal begegneten.
Für Roberta war das alles ein einziges Abenteuer, selbst die Hitze, die unruhigen Kamele und die Probleme, denen sie sich immer wieder gegenüber sahen. Ihr Vater lachte über alles, was ihnen zustieß, als sei es ein einziger riesiger Spaß, und genauso empfand sie es.
Francine pflegte die Hände in die Luft zu werfen, laut zu protestieren und auf diejenigen zu schimpfen, die die Unannehmlichkeiten verursachten; doch auch sie lachte, ganz gleich, wie groß das Mißgeschick war. Als nächstes zog sie den Kopf des Earls zu sich herab und küßte ihn, und die beiden vergaßen alles um sich herum.
Roberta führte ein für ein junges Mädchen merkwürdiges Leben. Manchmal begegneten sie wochenlang nur Arabern, und sogar Francine und der Earl unterhielten sich oft stundenlang nicht mit ihr, weil sie einander so viel zu sagen hatten, daß sie sie vorübergehend vergaßen.
Doch Roberta nahm ihnen das nicht übel. Sie war überglücklich, bei ihrem Vater leben zu können, und war auch nicht eifersüchtig auf Francine. Gleichzeitig nahm sie mit Freude zur Kenntnis, daß Francine ihre Gegenwart in keiner Weise störte. Francine war vertraut mit dem Leben in einer französischen Familie wo alle zusammenhielten und -lebten, vom Kleinkind bis zum Urgroßvater, so daß sie es nur natürlich fand, daß sie zu dritt lebten. Sie akzeptierte Roberta auf eine Art, wie sie es bei keiner anderen Geliebten ihres Vaters erfahren hatte - sie nahm ihr nie etwas übel, machte sich keine Sorgen um sie, ja, dachte vielleicht überhaupt nie an sie. Roberta gehörte für sie einfach zu dem Glück, das sie mit dem Earl genoß.
Sie zogen über die Berge, waren zu Gast bei arabischen Stammesführern, kampierten in einer Oase neben einem Brunnen, schliefen während der heißesten Tageszeiten und setzten ihre Reise fort, wenn es etwas abkühlte.
Für Roberta war es wie ein Märchen, das sich vor ihren Augen auf tat; irgendetwas Neues, Aufregendes gab es immer zu entdecken.
Nun, da ihr Vater gestorben war, hatte all das ein Ende.
2
Nachdem sie sich jede Nacht in den Schlaf geweint hatte, war Roberta als sie Marseille erreichte sehr müde.
Ich sollte mich wirklich schämen, dachte sie; Papa wollte, daß ich ein Abenteuer aus meiner Reise nach Amerika mache, und was tue ich?
Ihr Vater war lange Zeit bewußtlos gewesen und erst kurz vor seinem Tode noch einmal zu sich gekommen. Er hatte die Augen geöffnet und sie angesehen, als blicke er in ein blendendes Licht.
Ganz leise hatte er gesagt: »Ich liebe dich mein Schatz!«
Dann hatte er aufgehört zu atmen.
Später überlegte sie, ob er wirklich sie gemeint oder mit ihrer Mutter gesprochen hatte. Auf jeden Fall waren seine Worte ein Trost für sie gewesen, und sie war überzeugt davon, daß seine Seele sie immer begleiten würde.
Als Hassan und die Kameltreiber ihn behutsam in sein Sandgrab vor der Oase betteten, sprach sie kein Gebet. In ihrem Herzen bat sie jedoch darum, daß er dort wo er jetzt war, glücklich sein und sie immer beschützen möge.
In den dunklen Augen der Araber, die um sie herumstanden, glaubte sie Trauer zu entdecken. Auf ihre Weise hatten sie den Earl gewiß auch geliebt. Die meisten von ihnen hatten ihn von Anfang an durch Afrika begleitet, bereit ihm, wo es ihn auch hinzog, zu folgen.
Wie der Earl vorausgesagt hatte, brachten sie Roberta ohne Widerspruch mit den Kamelen nach Algier zurück.
Hassan hatte ihnen mitgeteilt, daß sie ihre Bezahlung erst in Algier erhielten. Als sie in der geschäftigen Hafenstadt ankamen, verkaufte Hassan die Kamele und erzielte dafür einen ansehnlichen Preis. Für sich behielt er natürlich einen Teil davon, wie es in den arabischen Ländern üblich war, aber sie wußte, daß er sie nicht hinterging.
Bei der Entlohnung Hassans und der anderen Männer war sie großzügig, was sie sich auch leisten konnte, da das Konto ihres Vaters bei der Bank in Algier einen ansehnlichen Betrag aufwies. Von der Bank erhielt sie die Unterlagen, die er erwähnt hatte, darunter eine Abschrift seines Testamentes, in dem stand, daß er ihr seinen gesamten Besitz vermachte. Das allerdings war beschränkt auf sein Privatgeld; der Teil seines Vermögens, der zu seinem Titel gehörte, wie das Haus und der Grund, ging an den neuen Earl of Wentworth, den Sohn seines jüngeren Bruders, mit dem er sich nie gut verstanden hatte. Der neue Earl gehörte zu den Familienmitgliedern, die sich lauthals und bei jeder sich bietenden Gelegenheit über das angeblich so unverzeihliche Benehmen von Robertas Vater beklagten. Sich vorzustellen, daß er jetzt dort lebte, wo früher ihr Zuhause war, machte sie nur noch entschlossener, nicht nach England und zu ihrer Großmutter zurückzukehren, sondern, wie ihr Vater vorgeschlagen hatte, ihre Tante Margaret aufzusuchen.
Von nun an war sie ganz auf sich gestellt. Nach den fast drei Jahren, die sie mit ihrem Vater auf Reisen war, fiel es ihr schwer, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.
Ihr war lediglich bewußt - wie damals, als sie Gracie nach Paris mitgenommen hatte -, daß sie die Reise über den Atlantik nicht ohne eine Anstandsdame antreten durfte.
Gracie hatte der Earl damals wieder nach Hause geschickt, ihr jedoch vorher noch eine ansehnliche Summe zugesteckt, die sie mit leuchtenden Augen begutachtete, und ihr einen Brief an seine Anwälte mitgegeben, mit der Anweisung, ihr eines der Häuser in ihrem Geburtsort zu überlassen. Gracie war so überglücklich gewesen, daß sie dafür keine Worte fand.
»Seine Lordschaft ist wirklich wunderbar!« hatte sie zu Roberta gesagt. »Die können reden, was sie wollen - ich weiß, daß er im Himmel belohnt werden wird!«
»Das hoffe ich«, hatte Roberta erwidert und sich mühsam das Lachen verbissen.
»Geben Sie gut auf ihn acht, M’Lady!« hatte Gracie eindringlich gebeten. »Er braucht jemanden, jetzt, da Ihre Mutter nicht mehr lebt, Gott hab sie selig. Die Damen, die ihm nachlaufen und ihm schmeicheln, haben es ja doch nur auf sein Vermögen abgesehen!«
Als Gracie ab gereist war, hatte Roberta dem Earl berichtet, was sie gesagt hatte, und beide hatten herzlich darüber gelacht.
Roberta war im Gegensatz zu Gracie überzeugt davon, daß die Geliebten ihres Vaters nicht hinter seinem Vermögen her gewesen waren, selbst wenn dies noch so überraschte. Sie hatten ihn geliebt und waren, sobald jemand anderes seine Aufmerksamkeit zu sehr beanspruchte, entsetzlich eifersüchtig geworden, sogar auf seine Tochter. Keine habgierigen Kurtisanen also wie die, die während des Second Empire solches Aufsehen erregt hatten.
Die Frauen, die ihr Vater liebte, waren jede auf ihre Art Damen gewesen und hatten ihm gewissermaßen die Ehefrau ersetzt.
Francine hatte sich von allen anderen unterschieden. Obwohl sie sehr stolz auf ihre adelige Herkunft gewesen war, unterschied sie sich durch ihr spontanes Benehmen und die heftigen Temperamentsausbrüche von den anderen Damen der Gesellschaft. Gleichzeitig war sie umsichtig und hätte niemals etwas getan, was den Earl schockiert hätte.
Roberta hatte Francine sehr in ihr Herz geschlossen, und als sie starb, weinte sie bitterlich. Sie konnte es nicht fassen, daß jemand, der so erfüllt von Joie de vivre, wie es die Franzosen nannten, war, plötzlich nicht mehr da war und lediglich die Erinnerung an ihr Lachen zurückblieb.
Papa hätte ohne Francine ein sehr einsames Leben geführt, dachte Roberta.
Doch war es für sie selbst kein Trost, daß er nun auch nicht mehr bei ihr war und sie allein zurechtkommen mußte.
Sie buchte eine Passage auf einem französischen Schiff nach Europa, das weder besonders bequem noch sauber war, doch den größten Teil der Reise brachte sie ohnehin in ihrer Kabine zu.
Bei der Ankunft in Marseille ließ sie sich in das beste Hotel der Stadt bringen. Sie war sich darüber im Klaren, daß es Schwierigkeiten hätte geben können, ein Zimmer zu bekommen, da sie ohne Begleitung war, aber ihr Titel machte Eindruck.
Nachdem ihr Koffer in das Zimmer gebracht worden war, bestellte sie sich eine Kutsche, die sie zum Schiffahrtsbüro brachte.
Auf dem Wege dorthin überdachte sie ihre Lage, und ihr fiel ein, was Francine einmal zu ihr gesagt hatte: »Die Franzosen sind Wichtigtuer. In Frankreich benutze ich immer den Titel, den ich als Tochter meiner Mutter zu tragen berechtigt bin, ganz gleich, welche Fehltritte sich mein Vater zuschulden hat kommen lassen.«
Also bat Roberta den Leiter des Schiffahrtsbüros sprechen zu dürfen, und erkundigte sich bei ihm in ihrem vornehmsten Französisch nach dem nächsten Schiff, das nach Amerika auslaufen würde.
»Ich bin Lady Roberta Worth«, stellte sie sich vor. »Bedauerlicherweise muß ich allein reisen, da mein Vater, der Earl of Wentworth, kürzlich in Afrika verschieden ist. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mir sagten, ob sich unter den Passagieren ein ehrbares Ehepaar befindet, das mich freundlicherweise auf der Reise unter seine Fittiche nehmen würde. Selbstverständlich werde ich dafür bezahlen.«
Der Leiter des Schiffahrtsbüros, der es bei ihrem Eintritt etwas an Respekt hatte mangeln lassen, wurde augenblicklich zuvorkommend.
Er sah in seiner Liste nach und stellte fest, daß ein britischer Geistlicher, Reverend Canon Bridges, und dessen Frau eine Passage auf demselben Schiff gebucht hatten; und er war zuversichtlich, daß sie sich gern ihrer annehmen würden, wenn er ihnen die Umstände erklärte.
Roberta überließ es ihm, alles Notwendige in die Wege zu leiten, und kehrte in das Hotel zurück, nachdem sie erfahren hatte, daß das Schiff, einer der größten französischen Atlantikdampfer, in zwei Tagen aufbrach; sie hatte noch Einiges vorzubereiten.
Vom Konto ihres Vaters in Algier hatte sie eine ziemlich hohe Summe Geld abgehoben. Francine hatte sie gelehrt, Geld während einer Reise an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sie hatte ihr beigebracht, größere Banknoten in den Rocksaum einzunähen und sich ein leichtes Taillenband aus Batist anzufertigen, das unmittelbar auf der Haut getragen wurde und dazu diente, wertvolle Gegenstände und Geld zu verstecken.
»Vielleicht erscheint es dir seltsam«, hatte Francine gemeint, »aber in Afrika verschwindet alles, was herumliegt, auf mysteriöse Weise. Und ist es erst fort, so besteht keine Aussicht, es wiederzubekommen.«
Roberta hatte aufmerksam gelauscht, obgleich sie, da ihr Vater ihren Lebensunterhalt bezahlte, nie Geld bei sich hatte und also nichts verbergen mußte.
Nun jedoch, da sie auf sich selbst gestellt war, befolgte sie dankbar Francines Rat.
Bereits auf der Fahrt nach Marseille hatte sie einen Teil ihres Geldes im Rockbund verstaut; nun nähte sie die größeren Geldnoten in die Säume der Kleider.
Als sie frühmorgens bei dem Schiff ankam, erfuhr sie zu ihrer Beruhigung, daß Mr. und Mrs. Bridges sich gern ihrer annehmen wollten. Canon Bridges, ein älterer, herzlicher wenn auch etwas wichtigtuerischer Herr, hatte im Auftrag des Erzbischofs von Canterbury die protestantischen Kirchen Frankreichs besucht, und nun brachen er und seine Frau nach Amerika auf, um dort die Häupter der Episkopalkirche zu treffen. Beide freuten sich darauf.
»Nie hätte ich mir träumen lassen, daß wir uns jemals weiter von unserem Häuschen in Canterbury entfernen könnten als bis zur englischen Küste«, erzählte Mrs. Bridges Roberta. »Aber es ist Gottes Wille, daß wir so weit reisen, und ich werde das niemals vergessen!«
Sie war eine einfache, gütige Frau, die ihren Mann anhimmelte, und hatte einen so beschränkten Horizont, dass sie allem Französischen mit Mißtrauen begegnete, selbst den französischen Speisen.
Roberta, die inzwischen beste französische Küche gewöhnt war, schmeckten die Mahlzeiten an Bord. Sie waren einfallsreich und delikat zubereitet. Je näher sie jedoch New Orleans kamen, desto eintöniger erschien ihr das Essen, obwohl es immer noch den besonderen Reiz der französischen Gerichte hatte.
Auf der Fahrt durch die Bucht von Biscaya, bevor sie Cherbourg erreichten, war die See sehr rauh. Dort, in Cherbourg, legten sie kurz an und steuerten dann hinaus auf den Atlantik. Nach einigen Tagen erreichten sie ruhigere Gewässer. Roberta war froh, in Gesellschaft von Mr. und Mrs. Bridges zu sein, da sie eventuell mit einem der Franzosen an Bord Schwierigkeiten bekommen hatte, von denen die meisten aus Geschäftsgründen nach Amerika unterwegs waren.
Ihren Blicken entnahm sie, daß sie anziehend auf sie wirkte, und sie achtete darauf, daß sie sich nie allein an Deck befand. Abends, wenn getanzt wurde, erklärte sie jedem, der sie aufforderte, daß sie nicht tanzen könne, da sie in Trauer sei. Sie wußte, daß Mrs. Bridges ihr Benehmen guthieß, obgleich sie sich offensichtlich darüber wunderte, daß Roberta eine so lange Reise allein machte.
»Hoffentlich werden Sie in New Orleans erwartet, Lady Roberta«, meinte sie.
Roberta lächelte und erwiderte ausweichend: »Ja, das hoffe ich auch, denn meine Tante lebt in Kalifornien, und das ist ja ziemlich weit vom Mississippi entfernt.«
Sie hielt es für ratsamer, Mrs. Bridges nicht anzuvertrauen, daß überhaupt niemand von ihrer Reise informiert war.
»Ach ja? Ich weiß nämlich fast nichts von Amerika«, erwiderte Mrs. Bridges. »Mein Mann und ich sind sehr aufgeregt, weil wir nicht wissen, was uns dort erwartet - besonders da, wo es vielleicht noch gefährliche Indianer gibt!«
»Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen«, meinte Roberta tröstend. »Außerdem werden sich Ihre Gastgeber ja um Sie kümmern.«
Wenn sie doch nur dasselbe von sich hätte sagen können! Sie hatte ihrer Tante in einem Brief mitgeteilt, daß ihr Vater gestorben sei und sie sie besuchen wolle. Den Brief hatte sie in Marseille aufgegeben, doch sie war sich nicht sicher, ob er nicht vielleicht erst nach ihrer Ankunft eintraf oder, wie es der Zufall manchmal wollte, sogar erst mit diesem Schiff transportiert wurde.
Sollte Tante Margaret mir nicht helfen, überlegte sie, so muß ich nach England zurück. Aber die Vorstellung, dem Zorn ihrer Großmutter ausgesetzt zu sein und sich immer wieder die Attacken gegen ihren Vater anhören zu müssen, ließ die Idee in ihr aufkeimen, daß jedes andere Leben, auch ein noch so außergewöhnliches, dem in Essex vorzuziehen sei.
Weil sie sich noch nie sonderlich für Amerika interessiert hatte, wußte sie auch nicht viel darüber, und sie hatte keine Vorstellung davon, was sie in New Orleans erwarten würde.
Als das Schiff dort anlegte, war sie von der Stadt sofort fasziniert. Es war praktisch ein zweites Paris.
Für April herrschte eine ziemliche Hitze, doch nach den stürmischen, kühlen Nächten auf dem Atlantik war es, als wärmten die Sonne und die Trägheit der Stadt ihr Herz. Als erstes fiel ihr der Duft nach Kaffee auf, der in der schweren, drückenden Luft hing und vom Kai und den Röstereien herüberwehte.
Wie Paris, dachte sie, auch diese Häuschen mit ihren Fensterläden und Balkonen!
Vom Mississippi drangen seltsame Gerüche zu ihr nach Flußschiffen und Langusten, Zucker, Gewürzen, Bananen, Rum und Sägemehl. Alles in allem ein herrlicher Hintergrund zu den blumenübersäten Gärten, den Menschen, die an den Ufern schwitzten, den reichen, köstlichen Mahlzeiten mit viel Butter, Sahne und Wein, und dem melodischen Geräusch auf und abwogender Stimmen, weich, tief und volltönend.
Nach ihrem langen Aufenthalt in der kahlen Wüste bezauberte Roberta dieses Treiben um sie herum. Wieder und wieder blickte sie sich um, sog die Abwechslung, die Farben in sich auf - diese Szenen, die jeder Maler begeistert auf Leinwand festgehalten hätte.
Schade, daß Tante Margaret nicht in New Orleans lebt, dachte sie.
Sie hatte sich in diese Stadt, die ihr wie verzaubert schien, verliebt.
Das Essen im Hotel war ausgezeichnet, doch hätte sie viel lieber in einem der Restaurants in der Altstadt gespeist, in denen es, wie ihr der Ober anvertraute, mindestens ebenso exzellente Menüs gab wie in Paris. Als sie den Fischmarkt besuchte, glaubte sie seinen Worten. Die verschiedenen Stände waren beladen mit weichschaligen Krebsen, Langusten, schmackhaften kleinen Garnelen, die wie winzige rosa Blütenblätter aussahen, Hummern und Austern, frisch aus dem Meer.
Wenn Papa das doch nur sehen könnte! dachte sie. Das würde ihn begeistern!
Sie durfte sich jedoch nicht länger als notwendig in New Orleans aufhalten und mußte ihre Reise fortsetzen. Als Absender stand auf dem Brief ihrer Tante, den sie unter den Papieren bei der Bank in Algier gefunden hatte, »Blue River« - ein Dorf etwa fünfzig bis sechzig Kilometer südlich von San Francisco, wie sie der Landkarte entnahm.
Der lange Weg zwischen New Orleans und Kalifornien hatte sie anfangs geängstigt, aber später erfuhr sie, daß es mittlerweile in Amerika überall Eisenbahnen gab. Der Zahlmeister, der sehr hilfsbereit war, hatte sie darüber aufgeklärt, daß die Union-Pacific Railway sie von New Orleans, durch Louisiana, Texas, New Mexico und Arizona nach Kalifornien bringen würde.
»Die Reise ist angenehm, Lady Roberta, und Sie brauchen keine Angst zu haben.«
»Vor den Indianern, meinen Sie?« fragte sie und hoffte, ihre Stimme klang nicht so aufgeregt wie damals Mrs. Bridges’.
»Vor den Indianern und auch vor rivalisierenden Eisenbahnbanden, die sich früher oft wild bekämpften.«
»Das muß ja entsetzlich für die Reisenden gewesen sein!«
»Ja, da haben Sie recht« pflichtete der Zahlmeister bei, »doch jetzt ist das vorüber. Sie können in aller Ruhe reisen und schlafen, ohne einen Pistolenschuß zu hören.«
Er lachte, als wäre das nur ein Witz, und bot ihr dann an, ihr ein paar Bücher zu diesem Thema zu leihen.
Darin las sie über die großen Eisenbahngesellschaften und deren Besitzer wie Commodore Vanderbilt, David Drew und George Low und auch über die erbitterten Konkurrenzkämpfe, die oft so ausarteten, daß eine Anzahl von Leuten verwundet oder getötet wurde.
Während ihres Aufenthalts in New Orleans hatte Roberta bemerkt, daß einige Menschen sie ein wenig mißtrauisch ansahen, wohl weil sie allein unterwegs war. Hätten ihre Eltern sie so gesehen, hätten sie sie gewiß ermahnt, daß sie viel zu jung und zu hübsch war, um alleine irgendwohin zu reisen. Deshalb hatte sie sich beeilt, die lange Fahrt zu ihrer Tante nach Kalifornien anzutreten. Eines Tages komme ich wieder her, dachte sie zuversichtlich, als sie einen letzten Blick auf New Orleans und den Mississippi warf. Diese Stadt hatte etwas ganz Besonderes, Bezauberndes an sich.
Nachdem sie schon eine Weile in ihrem Abteil saß, stellte sie nach einem Blick auf die Landkarte fest, dass sie sich im Staate Louisiana befand. Bald darauf erreichten sie Texas.
Zwei Tage waren verstrichen, und noch immer saß sie im Zug und konnte die Landschaft lediglich durch das Fenster bewundern. Das Rucken und Rattern nahm sie kaum mehr wahr, und sie hatte das Gefühl, durch Niemandsland zu rollen, irgendwo unterwegs zwischen zwei Punkten auf der Landkarte. Sie aß, schlief und wurde bedient von einer Zugbegleiterin, die für sie sorgte wie für ein kleines Kind. Ab und zu plauderte sie mit anderen Reisenden, meist älteren Leuten, bei denen sie kein zu großes Interesse befürchten mußte.
Sie reiste in der ersten Klasse, worüber sie sehr froh war, da es vermutlich im anderen Teil des Zuges für sie unangenehm geworden wäre, denn, wenn sie an einem Bahnhof hielten, stiegen immer Passagiere aus, um sich die Beine zu vertreten, und viele von ihnen waren hochgewachsene, gutaussehende Männer mit Sombreros. An ihren Hüften hingen von mit Nieten besetzten Gürteln Pistolen, die verrieten, daß sie aus Texas stammten. Roberta war beeindruckt von ihnen; doch, wenn sie dann wieder in ihrem Erste-Klasse-Abteil weiter hinten im Zug saß, dachte sie erleichtert, daß ihr hier jedenfalls niemand zu nahe treten konnte.
Ein Mann fiel ihr an jeder Station besonders auf. Ob er Texaner war, wußte sie nicht. Er hatte, wie die anderen Männer, denen man ihre Herkunft ansah, eine gute Figur und war ziemlich groß. Außerdem fand Roberta ihn auffallend hübsch und vermutete hinter seinem guten Aussehen ein sehr sympathisches Wesen, und in gewisser Hinsicht schien er sich von all den anderen zu unterscheiden. Er hatte ein sonnengebräuntes Gesicht, trug lässige Kleidung und wirkte so anziehend, daß Roberta sogar, wenn der Zug fuhr, an ihn denken mußte. An jeder Station ging er allein auf und ab und war offensichtlich tief in Gedanken versunken.
Ob es ihn wohl überrascht, wenn ich ihn anspreche? überlegte sie sich und war im nächsten Moment über sich selbst erschrocken, weil sie auf eine so unerhörte, unschickliche Idee kam.
Schließlich, als Roberta schon das Gefühl hatte, seit mindestens einem Jahr unterwegs zu sein, erreichten sie Kalifornien.
In ihrem Buch über den Eisenbahnbau hatte sie gelesen, daß dieser große Staat ungefähr eintausendzweihundert Kilometer lang und vierhundert Kilometer breit war, und außerdem der größte Weinberg, Obstgarten und die größte Kornkammer der Welt. Ihr Buch berichtete ebenfalls über den »Großen Goldrausch« im Jahre 1849 und den Reichtum des Landes an Silber, Platin und Plutonium.
Wie klug von Tante Margaret, hierher zu kommen, dachte sie. Während der Reise hatte sie kaum einen Gedanken an ihre Tante verschwendet. Jetzt versuchte sie, sich an sie zu erinnern; doch das Einzige, was ihr einfiel, war, daß die Familienmitglieder ziemlich verächtlich von ihr gesprochen hatten.
Lady Margaret hatte sich, entgegen den Erwartungen der Familie, geweigert, irgendeinen der in Frage kommenden jungen Männer zu heiraten, die ihr nach ihrer Einführung in die Gesellschaft einen Antrag gemacht hatten. Reiten und Jagen war ihr Leben gewesen. Und ihr Vater, der Earl, der ein unbekümmertes Wesen hatte, wollte seine Tochter nicht zu einer Heirat zwingen, sondern ihr Zeit lassen, bis sie sich selbst dazu entschied. Deshalb ignorierte er die ständigen Einwände seiner Gattin, daß Margaret unbedingt verheiratet werden müsse. Er ließ sie das Leben daheim genießen und erfreute sich an ihrer Gesellschaft beim Jagen.
Seine Frau kam allmählich, nachdem ihre anderen Kinder erwachsen und vermählt waren, zu der Überzeugung, daß Margaret eine alte Jungfer würde, als sie sich plötzlich verliebte.
Einmal jährlich luden der Earl und seine Frau die Vikare und Pfarrer der Kirchen ein, deren Pfründeninhaber der Graf, als Patron der Pfründe, ernannte. Auf dieses Ereignis freute sich niemand, schon gar nicht die Gäste.
Die Countess klagte darüber, daß deren altmodische Abendkleidung nach Mottenkugeln roch, und der Earl meinte, die Ehefrauen seien so schüchtern und unbeholfen, daß man aus ihnen nicht ein Wort herausbekäme. Vor einem dieser Anlässe fragte der Vikar des Dorfes, ob er einen amerikanischen Prediger, der bei ihm zu Gast war, mitbringen dürfe. Die Countess willigte etwas widerstrebend ein; und so kam Clint Dulaine in ihr Haus. Die Tischordnung verfügte, daß er neben Lady Margaret saß. Und wenn ihr Vater und ihre Mutter und die anwesenden Geschwister später an diesen Abend zurückdachten, so erinnerten sie sich daran, daß Margaret mit einem Mal von einem Liebreiz und einer Lebhaftigkeit gewesen war wie nie zuvor.
Clint Dulaine blieb nicht, wie ursprünglich geplant, zwei Tage, sondern zwei Wochen. Und als er nach Amerika aufbrach, begleitete Margaret ihn.
Mit der typisch amerikanischen Unkompliziertheit machte er ihr vier Tage nach ihrem ersten Zusammentreffen einen Heiratsantrag.
Als Margaret ihrem Vater eröffnete, daß sie einen amerikanischen Prediger heiraten wolle, war er nicht nur bestürzt darüber, sondern verbot ihr kategorisch, ihn je wiederzusehen.
»Ich will keinen Pfaffen in meiner Familie, und schon gar keinen amerikanischen!« erklärte er. »Du wirst diesen Mann nie wiedersehen oder jemals wieder mit ihm sprechen! Sollte er versuchen, in unser Haus zu kommen, werden ihn die Diener hinauswerfen!«
Margaret schien auf ihren Vater zu hören, doch heimlich traf sie sich mit Clint im Wald. Und wie ihr Bruder einige Jahre später, so lief sie eines Tages davon und hinterließ nur einen kurzen Abschiedsbrief.
Am Abend vorher wünschte sie ihren Eltern auf die gewohnte artige Weise eine gute Nacht. Wären sie etwas aufmerksamer gewesen, so wäre ihnen das Leuchten in Margarets Augen und der strahlende Gesichtsausdruck aufgefallen. Sie merkten jedoch nichts. Erst als Margaret sie verlassen hatte und sie nicht wußten, wohin sie gegangen war, erinnerten sie sich, daß sie an diesem Abend »irgendwie anders« gewesen war.
Margaret und Clint heirateten im Standesamt, und sie schrieb ihrem Vater, als sie bereits nach Amerika unterwegs waren, und teilte ihm mit, daß sie überglücklich sei und sich auf ein neues Leben in einem anderen Teil der Welt freue.
Der Earl fand sich mit einem Achselzucken damit ab, daß sich nun nichts mehr ändern ließ, doch er vermißte die Gesellschaft seiner Tochter sehr.
Wenn Roberta sich ihre Kindheit ins Gedächtnis rief, so hörte sie im Geiste ihre Großmutter auf die gleiche verächtliche Weise von ihrer Tochter sprechen, wie sie es später von ihrem Sohn tat.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.