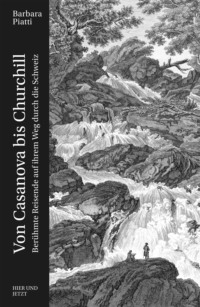Kitabı oku: «Von Casanova bis Churchill», sayfa 9
Auszüge aus James Fenimore Coopers «Streifzügen durch die Schweiz», 1836
Die Bergschlucht hatte anfangs eine Weite von drei- bis vierhundert Fuss; aber sie nahm an Enge immer mehr zu, bis die Felsen einander über dem unterhalb durchrauschenden Strom zu berühren schienen; doch gingen wir mehrere Meilen weit, bis diese Berührung wirklich eintraf. Ein wenig mehr diesseits der Stelle, wo die Felsen sich begegneten, wies der Führer nach einem kleinen Gebäude, das über dem Abhang schwebte, grade am gegenüberliegenden Rande der Schlucht. Man hatte sich dessen sonst bedient, allerlei Gegenstände in die Schlucht hinab und aus ihr heraus zu fördern. Hier stiegen wir schnell einen steilen Weg im Zickzack wohl mehrere hundert Fuss hinab. Auf dem Grunde der Schlucht gelangten wir in das berühmte Bad von Pfäfers.
Das ist vermutlich der ausserordentlichste Ort in seiner Art, den man in der Welt finden kann. Die Breite des Engtals misst unten nicht über zweihundert Fuss, und hoch oben ist es nicht viel breiter. Es richtet sich fast genau nach Osten und Westen, und an der Südseite kann die Felsenwand als ganz senkrecht betrachtet werden. Ich bin nicht gewiss, ob der Gipfel nicht über seinen Fuss hinausragt; an einzelnen Stellen ist es wirklich so. Gegen Norden ist der Abhang weniger steil, aber doch nicht weniger schroff. Ich glaube kaum, dass sich diese enge Schlucht bis auf dreihundert Fuss öffnet, wenn sie auch wirklich so weit ist. Ebel gibt die Höhe der südlichen Felsen zu sechshundertvierundsechzig Fuss an, französisches Mass, welches mit siebenhundertundfünfzehn Fuss englisch übereinstimmt. Die Weite des Engtals nimmt allmählig ab, bis sich die Öffnung ganz verliert, wie schon erwähnt, und es möglich macht, mittelst einer natürlichen Brücke hinüberzugehen. Mitten im Sommer sieht man in diesem Tale die Sonne erst um elf Uhr vormittags, und um drei Uhr verschwindet sie wieder.
Im Grunde dieser halb unterirdischen Welt steht ein mächtig grosses Gebäude, das im Notfall sechs- bis siebenhundert Gäste fassen kann. Die Bäder sind Eigentum der Abtei Pfäfers, eine geistliche Brüderschaft, welche in dem vorher erwähnten Klostergebäude wohnt. Die Badezeit war vorüber, und es waren wenig Fremde dort, die bloss der Neugierde halber dahin kamen. Das Gebäude ist von Stein und ruht auf Bogen und hat gewölbte Gemächer im Unterbau. Es steht am Fuss des nördlichen Abhangs, und zwischen ihm und dem südlichen Abhang rauscht die Tamina vorüber. In der Mitte ist eine Kapelle, wie es einem Mönchseigentum ziemt; die Küchen, die Bäder und Wirtschaftszimmer sind hinreichend düster, um klösterlich heissen zu können. Fast sollte man glauben, dieser Ort sei von der Natur recht eigentlich zum Vergnügungsort für Mönche bestimmt worden.
Ich trat in einen ungeheuern Bogengang ein, wo sechs oder acht roh aussehende Mannspersonen mit Kartenspielen beschäftigt waren, und ein Aufwärter empfing mich mit den gewöhnlichen Höflichkeiten der Oberwelt. Nachdem ich an diesen vorübergegangen war, wanderte ich tiefer in das Gebäude hinein und kam in ein anderes Gemach, wo der Wirt, ein Mönch und einige Hausgenossen auf dieselbe Weise beschäftigt waren. Ich kann Ihnen den ersten Eindruck nicht beschreiben, den das auf mich machte. Ich kam von den Bergen, aus der Bergluft, von den duftenden Fluren, aus dem Tag des Himmels in diese schauerliche Kluft hinab, in diese düstern, dumpfigen, gewölbten Gemächer, und musste grade Gruppen begegnen wie diesen hier; da dämmerten mir dunkle Erinnerungen aus den Kinderjahren auf, wo im Sinne der amerikanischen Rechtgläubigkeit Karten und Gottlosigkeit zusammengehörten und Mönche und Teufel einander für verbrüdert galten. Der Benediktiner hatte wirklich gehärtete und scharf ausgedrückte Züge, und die Einmischung des Mönchsgewandes in diesem Gemälde verleitete mich beinah, nach dem Pferdehuf unter dieser braunen schmutzigen Kutte zu spähen.
Nachdem wir unseren Reisepack aufgehoben, ein Zimmer in Beschlag genommen und einigen leiblichen Trost eingenommen, nahm ich einen Führer für den Badeort an und begab mich zur Quelle. Sie werden leicht einsehen, dass die natürliche Wildnis solchen merkwürdigen Orts und die Heilkraft seines berühmten Quellwassers nur eine zufällige Beziehung zueinander haben. Die Tamina, ein breiter, wasserreicher Bergstrom, der den Gletschern entspringt, hat sich durch eine grosse Felsenspalte einen Weg gebahnt; aus dieser quillt sie nur eine kurze Strecke von dem Badehause entfernt hervor, rauscht an diesem vorüber, um nachher ihre brausenden Wogen bald mit dem Rhein bei Ragaz zu vereinigen. Die heissen Quellen stehen mit diesem Strom in keiner Verbindung. Sie sprudeln aus den Felsen, welche die Seitenmauern des Stromes bekleiden, zischend hervor, und sie würden sich ganz in diesem verlieren, wenn man nicht durch künstlicheMittel einen Teil ihrer Wasser für die Badeanstalt zu verwenden gewusst hätte.
Wir verliessen das Gebäude mittelst eines engen Überbaues von Planken, der etwa dreissig Fuss über dem Strom angebracht ist und an dessen Seite das Wasser der Springquellen durch einen hölzernen Behälter zu den Bädern geleitet wird. Diese wankende Brücke führte bald über den Strom hinüber an die andere Seite des Engtals und folgte alsdann den Felsen, an welche sie mittelst der eisernen Klammern befestigt war, welche die kleine Wasserleitung stützen. Nachdem wir eine Weile auf diese Weise vorwärts gegangen waren, während die schroffen Abhänge sich allmählig über unsern Häuptern schlossen und der tobende Strom heftig von Fels zu Fels hinunterstrudelte, traten wir endlich in eine Höhle ein, in welcher die überragenden Berge uns das Tageslicht entzogen. An dieser Stelle kreuzt der Pfad der Oberwelt über das Engtal hin. Ein ungeheurer Felsenblock war ganz aus dem ursprünglichen Lager aufgestört und war, so schien es, dort hingerollt, wo er, in die Öffnung des Schlundes nicht einzudringen vermögend, dort Jahrtausende mochte hängengeblieben sein, gleich einem Keil, die Berge auseinanderzwängend. An dieser Stelle beträgt die Weite der Schlucht nur noch vierzig Fuss, während die Höhe beinah zweihundertundfünfzig ausmacht.
Unser Weg über diese kunstlose Brücke war eine Strecke von etwa einer viertel englischen Meile. Die Planken waren mitunter nass; bisweilen war nur eine Planke da; an manchen Stellen mussten wir uns bücken, um unsre Köpfe nicht an den überhängenden Klippen zu stossen, während uns andere Planken nach der Mitte der Schlucht geleiteten, so dass wir gleich Seiltänzern in der Luft schwebten. Das Überwältigende der staunenden Empfindung, die mich erfasste, und die beständige Anreizung, öfter um mich zu blicken, machten diesen Ausflug für mich nichts weniger als gefahrlos; der brausende Bergstrom, der immerfort unter meinen Blicken flimmerte, und das unaufhörliche Getöse, das schaurig zu mir hinaufbrauste, machten die betäubende Wirkung des Ganzen vollkommen. Für einen ausdauernden Kopf ist übrigens die Gefahr unbedeutend; aber wer zu Schwindel geneigt ist, darf sich nicht dahin wagen. Die einzige Vorsicht, die ich anzuwenden mich bewogen fühlte und die man nie vernachlässigen sollte, bestand darin, dass ich mich zuvor fest auf die Beine stellte, sobald ich nach den verschiedenen Gegenden, wo sich mir etwas zu schauen darbot, hinblicken wollte.
Dieser gähnende Spalt ist wunderlich genug gebildet, um die Aufmerksamkeit zu spannen, und die Brücke schien anfangs nicht aufhören zu wollen. Ist sie gleich weniger als halb so lang, dem Masse nach, als die Brücke von Rapperswil, so ist sie wohl viermal so lang rücksichtlich der Fülle von Eindrücken, die sie hervorbringt. Ich murmelte fast immer das Wort «unterweltlich» vor mich hin, und ich glaube, dies Beiwort bezeichnet diesen Ort am besten.
Diese Plankenbrücke hört grade da auf, wo die heissen Quellen aus den Felsen hervorsprudeln und woselbst sie zuvörderst in den hölzernen Behälter aufgenommen werden; doch sind daselbst mehrere Abflüsse, und man lässt einen bedeutenden Teil des Wassers in die Tamina fliessen. Der Führer aus dem Orte behauptete, man könne sechs französische Meilen weit in diese Schlucht eindringen! Es mag wirklich so sein, denn man darf nur bedenken, in welchem grossen Massstabe die Natur alle ihre Werke in der Schweiz angelegt hat. Die Wirkungen des Spiels der in diese Schlucht einfallenden Lichtschimmer sind nicht die geringsten von ihren schauerlichen Annehmlichkeiten. Da der Führer merkte, dass ich ziemlich fest mich auf den Beinen halten könne, so eilte er mir voran, und das Aussehen seiner durch die Luft hinschwebenden Gestalt, die bald beleuchtet, bald wieder in tiefem Schatten vor mir hingaukelte, diente wirklich dazu, diese Stelle einem Eintritt in die Unterwelt zu verähnlichen, wo gespenstige Schattenbilder durch die düstern Räume schwebten.
Die Bäder sind schon seit Jahrhunderten hier benutzt worden, und man kann deutlich die Spuren der Stellen erkennen, wo früher hin Kammern neben den Quellen selbst angebracht waren, um daselbst zu baden.
Ich habe Ihnen diesen merkwürdigen Ort auf die einfachste Weise beschrieben; doch keine Methode kann eine so deutliche Vorstellung von einem Ort hervorbringen, als wenn man sie einem Vergleichungsmassstabe nach Fussen und Zollen anpasst. Stellen Sie sich eine felsige Schlucht vor, in welcher der höchste Turm in Amerika hineingestellt werden kann, in der Breite von dreissig bis zu sechzig Fuss wechselnd, einen brausenden Strom dem Boden entlang, dazu die Dämpfe heissen Quellwassers, das Spiel von Licht und Schatten, und Menschen, die darin umherschwirren, als ob sie in den Lüften hingen, dann erhalten Sie einen notdürftigen, dem von dieser Szene hier bewirkten ziemlich ähnlichen Eindruck.
Als ich zurückkam, speiste ich, und weil ich kein besonderes Vergnügen an der unterweltlichen Gesellschaft empfand, die ich hier antraf, und zu welcher ein anderer ebenso wüst aussehender Benediktiner, oder gar ihrer zwei, noch hinzukamen, so schrieb ich mir das Nötige in mein Tagebuch und ging zeitig in meiner ziemlich wohnlichen Stube zu Bett. Dieses Schlafengehen wäre wahrscheinlich, wenn ich auf der Oberwelt gewesen wäre, noch ziemlich bei hellem Tage erfolgt; aber in dieser unterirdischen Dämmerung hätte ein Hahn nicht leicht Anstand gefunden, sich ebenfalls zur Ruhe zu begeben.
Während der Nacht fiel der Regen stromweise in die Schlucht hinab; ich ward fast schon in halb träumerische Vorstellungen von einem Besuch der Tamina zu den Fenstern herein befangen. Diese Fälle mögen alle schon erwogen worden sein; doch sollte es mich nicht wundern, wenn Wolkenbrüche oder ein zerstiebender Gletscher einst Brücke, Haus, Mönche, Karten, Wein, Schmer, Schmutz, dunkle Bogengänge, alles in einem Haufen, in grösster Eile nach Ragaz hinunterspülen sollten. Die grosse Festigkeit des Gebäudes hat vermutlich einige Beziehung zu der Besorgnis vor solchen plötzlichen Abkühlungen.
Quelle: James Fenimore Cooper:
Ausflüge in die Schweiz. Frankfurt a. M.:
Sauerländer 1836, S. Y.
1831
Felix
Mendelssohn
Bartholdy
Mailand —
Simplon —
Vevey —
Col de Jaman —
Interlaken —
Kleine Scheidegg —
Faulhorn —
Furkapass —
Flüelen —
Luzern —
Meiringen —
Jochpass —
Engelberg —
Rigi —
Einsiedeln —
Lindau

Dorf und Kloster Engelberg. Aquarell von Felix Mendelssohn Bartholdy (1831).
Die Spannörter sind unglaubliche Zacken u. der runde mit Schnee belastete Titlis, der den Fuss in den Wiesen hat, u. die Urner Felsen aus der Ferne sind auch nicht übel. Jetzt ist noch dazu Vollmond; das Thal ist geschmückt.
Felix Mendelssohn Bartholdy (1831)
Vertieft man sich in Felix Mendelssohn Bartholdys Reisebriefe aus dem Jahr 1831, die so ausführlich und anschaulich von einer «Fussreise» durch die Schweiz berichten, fallen einem drei Dinge sofort auf.
Erstens: Mendelssohn hatte furchtbares Pech mit dem Wetter, es regnete, genauer: es goss eigentlich unentwegt, er reiste mitten in einer Unwetterperiode, wie sie schlimmer nicht hätte sein können – was ihm aber, wie man sehen wird, die gute Laune durchaus nicht verdarb. Im Gegenteil, seine Schilderungen sind voller Lob und Begeisterung: «Die Fussreise durch dieses Land ist wirklich, selbst bei ungünstigem Wetter, das Reizendste, was man sich nur denken kann; bei heiterem Himmel muss das Vergnügen gar nicht auszuhalten sein […]. Hegel sagt zwar, jeder menschliche Gedanke sei erhabener als die ganze Natur, aber hier finde ich das unbescheiden.»
Sogar am Ende dieser verregneten Reise hatte er seinen Humor nicht verloren und berichtete an die Familie, «wie ich quer durch Appenzell gelangt bin, aussehend wie Ägypten nach den sieben Plagen».
Zweitens: Niemand (von John Ruskin vielleicht einmal abgesehen, siehe das Kapitel über diesen, Seite 179–190) scheint die Schweiz so innig, so allumfassend zu lieben wie der junge Mendelssohn, was in Anbetracht des ersten Punktes umso mehr verwundert. «Es ist kein Land wie dieses», schreibt er an seinen Freund Eduard Devrient am 27. August 1831 aus Luzern. Und weiter: «Alle Träume und Bilder können Dir nicht eine Ahnung von dem geben, was dies für eine Schönheit ist. […] Jeder Mensch, der es könnte, müsste einmal in seinem Leben die Schweiz gesehen haben. […] Was grün heisst und Wiesen und Wasser und Quellen und Felsen, das weiss nur einer, der hier gewesen ist.» Auch an seine Schwestern sendet er ganz ähnliche Gedanken: «Von allen Ländern, die ich kenne, ist dies das schönste und das, wo ich am liebsten leben möchte, wenn ich recht alt würde.»
Drittens: Mendelssohn schaute und schwärmte nicht nur, er war auch ein trainierter Wanderer. Die Strecken, die er absolvierte, hatten und haben es in sich, zum Beispiel jene über den Jochpass von Meiringen ins Engelbergertal, das sind elf bis zwölf Stunden reine Wanderzeit, mindestens. Zu Recht untertitelt R. Larry Todd die Jahre 1830 bis 1832 in seiner grossen Biografie mit «Wanderlust» (von den 44 Seiten dieses Kapitels ist allerdings nicht einmal eine ganze Seite den Streifzügen durch die Schweiz gewidmet). «[…] das ganze Fussreisen so allein, frey und leicht ist etwas Neues und ein unbekannter Genuss für mich», berichtete Mendelssohn an seine Eltern.
Insgesamt viermal bereiste Mendelssohn die geliebte Schweiz: 1822 als dreizehnjähriger Junge mit seiner Familie (schon damals verfasst das Wunderkind einen aufschlussreichen Brief über das Jodeln!), als 22-jähriger junger Mann im Anschluss an seine Italienreise, 1842 als Familienvater und dann noch einmal 1847, kurz nach dem Tod seiner geliebten Schwester Fanny – die Reise als Form der Trauerbewältigung.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) auf einem Porträt von Wilhelm Hensel (um 1829/30).
Schon von der ersten Reise gibt es einige amüsante Details zu berichten, zum Beispiel, dass die Mendelssohns als richtige Karawane durch die Schweiz zogen. Sie setzte sich zusammen aus den Eltern, den vier Kindern im Alter von sechzehn (Fanny), dreizehn (Felix), elf (Rebecca) und neun Jahren (Paul), dem Hauslehrer Heyse, einem Dr. Neuburg sowie einigen Dienstboten. Man fuhr in zwei Wagen – was Felix beinahe zum Verhängnis wurde; bei der Abfahrt aus Berlin dachte jede der beiden Reisegruppen, der Junge fahre im anderen Wagen mit, mit dem Ergebnis, dass man ihn schlicht zu Hause vergass und sein Fehlen erst nach einer Stunde bemerkte. Die Einreise erfolgte via Schaffhausen, und auf dieser ersten Tour durch die Schweiz besuchte Felix bereits zahlreiche Orte und Sehenswürdigkeiten, die er im Lauf späterer Aufenthalte erneut besichtigte. Nach der Reise bemerkte Fanny, dass das schöne Kindergesicht verschwunden sei, «seine Gestalt hatte etwas männliches gewonnen».
Die zweite Begegnung mit Land und Leuten, von der hier hauptsächlich die Rede sein soll, ist eingebettet in eine viel grössere Reise, die sich über mehr als zwei Jahre erstreckt, von Mai 1830 bis Juni 1832. Von Berlin aus hat sie ihn durch halb Europa geführt, nach Weimar, München, Wien, Venedig, Florenz, Rom, Neapel, in die Schweiz, nach Paris und London und zurück nach Berlin. Diese Reise finanzierte der reiche Vater, ein jüdischer Bankier, sie ist deshalb in vielerlei Hinsicht mit einer klassischen «Grand Tour» zu vergleichen. Dank dem weitläufigen Kontaktnetz seiner Eltern kannte Felix eine Vielzahl bedeutender Menschen aus den Bereichen der Diplomatie, der Wissenschaft und aus allen Sparten der Künste, sodass er fast überall, auch im Ausland, sofortigen Anschluss an das gesellschaftliche Leben fand. Mendelssohns Dankbarkeit gegenüber den Eltern kommt immer wieder zum Ausdruck, etwa wenn er aus dem Tal von Chamonix schreibt: «Von Zeit zu Zeit muss ich Euch wohl einen Dankbrief für diese wunderbar schöne Reise schreiben, und wenn ich es je gethan habe, so muss ich es jetzt wieder thun, denn herrlichere Tage, als die auf dem ganzen Wege hieher und hier selbst, habe ich doch noch nie erlebt» (31. Juli 1831). An die Tour war aber auch ein ganz konkreter Auftrag geknüpft – der junge Komponist solle erkunden, wo er in Zukunft wirken wolle, und sich, seine Musik dort schon bekannt machen, seinem «späteren Wirken vorzuarbeiten», wie Mendelssohn es selber in Worte fasste.
Offenbar hatte er daneben grosse Lust auf ausgedehnte Wanderungen, wie er sie schon 1827 mit Freunden in Deutschland unternommen hatte, vom Harz nach Süddeutschland und zur Weinlese an den Rhein; oder 1829 im schottischen Hochland. Die Briefe, Berichte und Bilder ergeben ein ungemein lebendiges Bild dieser Reise (Mendelssohn war ein Multitalent, der Komponist schrieb ganz grossartig und war zu allem Überfluss auch noch ein sehr guter Zeichner – mit Skizzen, Federzeichnungen und Aquarellen ergänzt er seine Reiseschilderungen aufs Trefflichste). Was längst nicht allen gelingt: Der Leser, die Leserin hat das Gefühl, unmittelbar neben ihm zu wandern. An die geliebten Schwestern schrieb er, sie sollen seine Touren mit dem Finger auf der Karte verfolgen. Das schlechte Wetter, die Regengüsse, Überschwemmungen und Gewitter sind seine steten Begleiter auf dieser langen Reise durch die Schweiz. Die unaufhörlichen Niederschläge etwa verpackt Mendelssohn in lautmalerische Folgen: «Papapapapai! Elelelelelelnd! Heut ists noch toller. Hat die ganze Nacht durch gegossen, und giesst schon den ganzen Morgen», schreibt er am 6. August an Fanny.
In Interlaken arbeitete er unter anderem an einem unvollendeten Reiselied zu Versen von Ludwig Uhland, in denen es um einen Reisenden geht, «der in mond- und sternloser Nacht eine von wütenden Winden durchtoste Landschaft durchreitet» – eine Erlkönig-Stimmung. Die Schweizer Erlebnisse haben überhaupt mehrfach Niederschlag gefunden in Mendelssohns Musik: Im Trio des Scherzos seiner 9. Streichersinfonie, die er mit «La Suisse» überschrieb, zitierte Mendelssohn ein Jodellied. Und in der Streichersinfonie Nr. 11 verarbeitete er den Emmentaler Hochzeitstanz «Bin alben a wärti Tächter gsi».
Zwischen den monsunartigen Niederschlägen gab es auch ganz wundervolle Tage, etwa jenen, an dem er den Col de Jaman an der Seite der bildhübschen Winzerin Pauline überschritt. Ja, sie trug sogar sein Bündel in einer Weinkiepe über den Berg; ein weiterer Hinweis darauf, dass Mendelssohn dem Flirten mit Schweizer Mädchen durchaus nicht abgeneigt war. Schon bei anderer Gelegenheit hatte er für eine Förstertochter zwei, drei Walzer komponiert (dies scheint übrigens eine Art «Masche» des jungen Mendelssohn gewesen zu sein, überliefert ist auch, dass er zwei Jahre zuvor in Weimar für Ottilie von Goethe ein «zärtliches Andante in A-Dur» komponiert hatte). Ob es bei diesen Flirts blieb oder ob Mendelssohn die Schweizer Mädchen verführte (oder sie ihn), darüber schweigen die Briefe.
Auf dem Weg durchs Simmental schickte er sein Bündel mit der Post nach Interlaken und spazierte «mit Nachthemd in der Tasche, Bürste, Kamm und Zeichenbuch durch das Land». Als ihn der Regen einholte, wanderte er eben mit dem Schirm weiter: «Es kam mir zuweilen vor, als sei ich in der Mark Brandenburg, und das Simmental sah ganz flach aus. Mein Zeichenbuch musste ich unter die Weste knöpfen, denn der Regenschirm half bald nichts mehr.» Am 7. August 1831 brach eine Wetterkatastrophe über das Berner Oberland herein, es kam zu verheerenden Überschwemmungen – und mitten drin Mendelssohn, der durch Sümpfe watete und beherzt Wildbäche durchquerte.
Durch Mendelssohn ist zum Beispiel auch aus erster Hand zu erfahren, was es heisst, auf literarischen Spuren zu reisen, als Literaturtourist unterwegs zu sein. Sein Blick auf die Zentralschweiz war von vornherein eingefärbt – durch Friedrich Schillers Wilhelm Tell (1804). Das war schon der Fall auf seiner ersten Schweizer Reise, als der jugendliche Felix die Hohle Gasse besichtigt und dabei allerlei aufschlussreiche Beobachtungen zum Spannnungsfeld von Fiktion und Wirklichkeit macht: «Denselben Tag fuhren wir über den reizenden Zugersee, gingen von Immisen, wohin Gessler wollte, in die hohle Gasse, welche nicht so schrecklich ist, als Schiller sie sich wohl gedacht haben mag. Es ist ein schöner ziemlich breiter, mit schlanken Buchen besetzter Hohlweg, und gar schön steht die Kapelle mitten in dem frischen Grün. Die andern gingen nach Küssnacht, ich blieb aber auf dem classischen Boden und zeichnete diesen reizenden und zugleich schauerlichen Hohlweg.»
Literarisches Reisen bedeutet immer eine Wechselwirkung: Die Landschaft erscheint durch den Filter der Literatur noch prachtvoller, umgekehrt wird das literarische Werk durch das persönliche, sinnliche Erleben der «Originalschauplätze» mit Bedeutung aufgeladen. Auf der Reise 1831 hatte Mendelssohn seinen Tell nicht im Gepäck, er fand aber eine Ausgabe in der Klosterbibliothek von Engelberg. Schiller, so schreibt er, habe sich die ganze Schweiz selbst erschaffen. Und damit hatte er absolut recht, denn der grosse Dramatiker war selbst nie in der Schweiz, sondern hatte sich sämtliche Informationen zu Land und Leuten aus Büchern, Landkarten und grafischen Blättern zusammengestellt, mit denen er die Wände seiner Schreibmansarde in Weimar tapezierte. Witzigerweise sah Mendelssohn ausgerechnet in Luzern eine Wilhelm-Tell-Inszenierung – mit sehr reduziertem Ensemble und geringem künstlerischem Anspruch. An Goethe, der damals, 1804, in der Weimarer Uraufführung die Regie übernommen hatte, berichtete er belustigt: Das Stück sei auch so «nicht tot zu machen».
Seine Reise wird gekrönt von einem Ausflug auf die Rigi: «Wenn man so aus den Bergen kommt und dann nach ihnen vor dem Rigi steht, das ist, als käme am Ende der Oper die Ouvertüre und andere Stücke wieder. Alle die Stellen, wo man so Himmlisches sah, die Wengneralp, die Wetterhörner, das Engelbergertal sieht man hier noch einmal nebeneinander liegen und kann Abschied nehmen.» Der letzte «Schweizer Brief» schliesst mit den Worten: «Der schmutzige nasse Fussreisende nimmt Abschied und will als Städter mit Visitenkarte, reiner Wäsche und einem Frack wieder schreiben.»
Es sollte bis 1842 dauern, neun Jahre, bis Mendelssohn seine geliebte Schweiz wieder betrat, diesmal zusammen mit Frau und Kindern. Eine letzte Reise führte Mendelssohn 1847 in die Schweiz. In der Hoffnung, nach Fannys Tod in den vertrauten Landschaften sein seelisches Gleichgewicht wiederzufinden, reiste er mit seiner Familie, Gattin Cécile und den fünf Kindern, an den Rheinfall, nach Luzern, nach Thun und Interlaken. Ein letztes Mal entstehen wunderbare Aquarelle, Mendelssohn komponierte auch, aber von der übersprudelnden Freude, der Begeisterung auf den drei vorangegangenen Reisen ist auf dieser letzten nichts mehr zu spüren. Alles ist schwer geworden. Nur wenige Monate nach Fannys Tod starb auch Felix – am 4. November 1847, im Alter von nur gerade 38 Jahren. Vor diesem Hintergrund klingen Mendelssohns Worte aus seinem Rigi-Kulm-Brief am Ende seiner Schweiz-Reise von 1831 sehr wissend: «Ich konnte mich nicht von dem Anblick trennen, und blieb noch sechs Stunden fortwährend auf der Spitze, und sah den Bergen zu. Ich dachte mir, wenn wir uns einmal wiedersehen, so müsste doch manches anders geworden sein, und wollte mir gern den Anblick so recht fest einprägen.»
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.