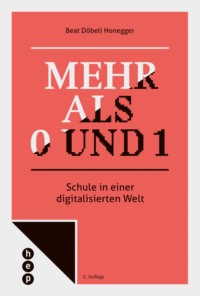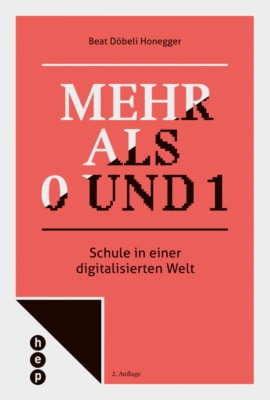Kitabı oku: «Mehr als 0 und 1 (E-Book)», sayfa 2
Angesichts solcher Entwicklungen halten verschiedene Stimmen die Privatsphäre für ein Auslaufmodell und rufen das Zeitalter der post privacy  w2424 aus. Insbesondere Chefs von großen Informatikfirmen haben sich mehrfach in diese Richtung geäußert, so zum Beispiel der ehemalige CEO von Sun Microsystems, Scott McNealy. Er meinte 1999: »Sie haben ohnehin null Privatsphäre. Kommen Sie damit klar!« Zehn Jahre später erklärte der damalige CEO von Google, Eric Schmidt, lapidar: »Wenn es etwas gibt, von dem man nicht möchte, dass es die Welt erfährt, dann sollte man es nicht tun.« Wird damit George Orwells Roman 1984
w2424 aus. Insbesondere Chefs von großen Informatikfirmen haben sich mehrfach in diese Richtung geäußert, so zum Beispiel der ehemalige CEO von Sun Microsystems, Scott McNealy. Er meinte 1999: »Sie haben ohnehin null Privatsphäre. Kommen Sie damit klar!« Zehn Jahre später erklärte der damalige CEO von Google, Eric Schmidt, lapidar: »Wenn es etwas gibt, von dem man nicht möchte, dass es die Welt erfährt, dann sollte man es nicht tun.« Wird damit George Orwells Roman 1984  b221 noch übertroffen und führt das Bewusstsein, wie in Benthams Panoptikum
b221 noch übertroffen und führt das Bewusstsein, wie in Benthams Panoptikum  w2016 dauernd beobachtet zu werden, dazu, dass Menschen sich selbst im Privaten nicht mehr trauen, gewisse Dinge zu tun, zu sagen oder gar zu denken?
w2016 dauernd beobachtet zu werden, dazu, dass Menschen sich selbst im Privaten nicht mehr trauen, gewisse Dinge zu tun, zu sagen oder gar zu denken?
Anders als in 1984 beschrieben, fürchten sich Staat und Unternehmen allerdings auch vor der neuen Macht einzelner Menschen. Hatte die Aufdeckung der Watergate-Affäre noch einen Fotokopierer und viel Handarbeit benötigt, um ein 44-bändiges Geheimdokument an die Öffentlichkeit zu bringen, genügen in der heutigen Zeit fingernagelgroße USB-Sticks oder das allgegenwärtige Internet, um Dokumente aus geschützten Armee- und Staatsumgebungen zu entwenden, die früher in Papierform mehrere Lastwagen gefüllt hätten. Wikileaks  w2216 und die von Edward Snowden
w2216 und die von Edward Snowden  p13594 aufgedeckten Geheimdienstaktivitäten
p13594 aufgedeckten Geheimdienstaktivitäten  b5666 sind dafür die bisher prominentesten Beispiele.
b5666 sind dafür die bisher prominentesten Beispiele.
Auch Unternehmen fürchten sich heutzutage vor einzelnen Kundinnen und Kunden. Einerseits war es für die Kundschaft noch nie so einfach, Preisvergleiche herzustellen, andererseits können unzufriedene Kunden dank Internet und Social Media viel einfacher Aufmerksamkeit erregen und mitunter mit einem Shitstorm  w2838 den Ruf eines Unternehmens beschädigen. So erreichte beispielsweise der Protestsong United breaks guitars eine solche Verbreitung, dass bei der Eingabe von »United« die Suchmaschine Google eine Zeit lang automatisch »breaks guitars« als Ergänzung vorschlug.
w2838 den Ruf eines Unternehmens beschädigen. So erreichte beispielsweise der Protestsong United breaks guitars eine solche Verbreitung, dass bei der Eingabe von »United« die Suchmaschine Google eine Zeit lang automatisch »breaks guitars« als Ergänzung vorschlug.
Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung beeinflussen auch das Verhältnis von Unternehmen und Staaten. So zeigen die von Edward Snowden veröffentlichten Dokumente, dass Geheimdienste auch handfeste Wirtschaftsspionage betreiben und damit den Unternehmen im eigenen Land auf Kosten ausländischer Unternehmen helfen. Unternehmen wiederum können sich dank der Globalisierung immer stärker staatlichen Regulierungen und insbesondere staatlichen Steuern entziehen  w2839. Immaterielle Güter wie Software oder Patente lassen sich an einem beliebigen Ort auf der Welt registrieren. Weltweit operierende Unternehmen gründen somit Briefkastenfirmen an Orten, an denen die staatlichen Regelungen bezüglich Steuerbelastung oder Datenschutz für sie besonders optimal sind, und verschieben ihre Unternehmensgewinne oder ihre Daten dorthin.
w2839. Immaterielle Güter wie Software oder Patente lassen sich an einem beliebigen Ort auf der Welt registrieren. Weltweit operierende Unternehmen gründen somit Briefkastenfirmen an Orten, an denen die staatlichen Regelungen bezüglich Steuerbelastung oder Datenschutz für sie besonders optimal sind, und verschieben ihre Unternehmensgewinne oder ihre Daten dorthin.
Einige dieser Entwicklungen des Internets, aber auch viele seiner Potenziale, sind auf dessen offene Grundarchitektur zurückzuführen. Verschiedene Experten befürchten jedoch, dass diese Offenheit von kurzer Dauer sein könnte  a1226. So weist beispielsweise Jonathan Zittrain in seinem Buch The Future of the Internet
a1226. So weist beispielsweise Jonathan Zittrain in seinem Buch The Future of the Internet  b3620 bereits im Jahr 2006 darauf hin, dass frühere Betriebssysteme das Installieren beliebiger Software erlaubt haben, aktuelle Geräte jedoch nur noch beschränkte Installationsmöglichkeiten bieten. Eine ähnliche Einschränkung findet im Internet statt, das offene World Wide Web droht, durch geschlossene soziale Netzwerke wie Facebook ersetzt zu werden. Somit könnten bald kommerzielle Unternehmen entscheiden, was im Internet wie leicht zu finden ist. Darum geht es unter anderem bei der aktuellen Diskussion um die Netzneutralität
b3620 bereits im Jahr 2006 darauf hin, dass frühere Betriebssysteme das Installieren beliebiger Software erlaubt haben, aktuelle Geräte jedoch nur noch beschränkte Installationsmöglichkeiten bieten. Eine ähnliche Einschränkung findet im Internet statt, das offene World Wide Web droht, durch geschlossene soziale Netzwerke wie Facebook ersetzt zu werden. Somit könnten bald kommerzielle Unternehmen entscheiden, was im Internet wie leicht zu finden ist. Darum geht es unter anderem bei der aktuellen Diskussion um die Netzneutralität  w2130. Damit wird die aktuelle, allerdings ungeschriebene Regel im Internet bezeichnet, dass alle Daten gleichberechtigt weitergeleitet werden. Derzeit kann niemand mit Geld erreichen, dass seine Daten schneller oder zuverlässiger ankommen. Tim Wu zeigt in seinem im Jahr 2010 erschienenen Buch The Master Switch
w2130. Damit wird die aktuelle, allerdings ungeschriebene Regel im Internet bezeichnet, dass alle Daten gleichberechtigt weitergeleitet werden. Derzeit kann niemand mit Geld erreichen, dass seine Daten schneller oder zuverlässiger ankommen. Tim Wu zeigt in seinem im Jahr 2010 erschienenen Buch The Master Switch  b5030, dass bereits frühere Medien mit einer Phase der Offenheit begonnen haben und nach einiger Zeit durch Marktentwicklungen und staatliche Eingriffe stark reguliert und eingeschränkt wurden.
b5030, dass bereits frühere Medien mit einer Phase der Offenheit begonnen haben und nach einiger Zeit durch Marktentwicklungen und staatliche Eingriffe stark reguliert und eingeschränkt wurden.
Werkzeuge prägen unser Denken
Die Digitalisierung verändert nicht nur die Arbeitswelt und führt zu einem allgemeinen Kontrollverlust. Der Leitmedienwechsel verändert auch unser Denken und Zusammenleben – das wird bereits klar, wenn man sich die Veränderungen in unserer Kommunikation und Terminplanung durch E-Mail und Mobiltelefon vor Augen führt. Unverbindlichkeit und Entscheidungen in letzter Sekunde haben stark zugenommen. Medientheoretiker wie Vilém Flusser  p210, Marshall McLuhan
p210, Marshall McLuhan  p332 oder Neil Postman
p332 oder Neil Postman  p132 haben bereits vor dem Aufkommen des Computers darauf aufmerksam gemacht, dass Werkzeuge schon immer unser Denken und Handeln beeinflusst haben
p132 haben bereits vor dem Aufkommen des Computers darauf aufmerksam gemacht, dass Werkzeuge schon immer unser Denken und Handeln beeinflusst haben  a113.
a113.
Exemplarisch für die Veränderungen unseres Denkens und Handelns durch digitale Werkzeuge und Medien soll an dieser Stelle nur die These vorgestellt werden, dass der Computer den Wunsch oder die Sucht, alles zu messen und zu dokumentieren, stark erhöht hat. Bei Individuen wird dieser Trend als quantified self  w2356 bezeichnet und kommt mit Fitnessarmbändern und Smartwatches vermutlich gerade erst auf – medizinische Daten dürften bald folgen. Noch stärker scheint die von Gunter Dueck Omnimetrie
w2356 bezeichnet und kommt mit Fitnessarmbändern und Smartwatches vermutlich gerade erst auf – medizinische Daten dürften bald folgen. Noch stärker scheint die von Gunter Dueck Omnimetrie  w1810 genannte Entwicklung bei Organisationen zu sein. Qualitätsmanagement, Zertifizierung, Akkreditierung sind die Stichworte dieser zunehmenden Bürokratisierung vieler Abläufe. Da nur gemessen und automatisiert werden kann, was formalisiert und standardisiert wurde
w1810 genannte Entwicklung bei Organisationen zu sein. Qualitätsmanagement, Zertifizierung, Akkreditierung sind die Stichworte dieser zunehmenden Bürokratisierung vieler Abläufe. Da nur gemessen und automatisiert werden kann, was formalisiert und standardisiert wurde  a830, führt dies oft auch zu einer Anpassung der Messkriterien und Abläufe. Es droht die Gefahr, dass nur noch das Messbare zählt.
a830, führt dies oft auch zu einer Anpassung der Messkriterien und Abläufe. Es droht die Gefahr, dass nur noch das Messbare zählt.
Es gäbe noch unzählige Veränderungen in allen Lebensbereichen zu schildern, die der Leitmedienwechsel mit sich bringt. Doch bereits mit dem bisher Aufgeführten wird deutlich, dass die Erfindung des Computers mit derjenigen des Buchdrucks vergleichbar ist. Es handelt sich um einen Leitmedienwechsel, der alle Aspekte des Lebens betrifft und für die Schule weit größere Herausforderungen mit sich bringt als die Frage, ob und wie Computer in der Schule genutzt werden sollen.
Doch wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren? Es fehlt diesbezüglich keineswegs an Vorschlägen und Rezepten. Das nächste Kapitel zeigt das ganze Spektrum, wie die Akteure an den Schulen auf den Leitmedienwechsel reagieren; vom Versuch, die Entwicklung zu ignorieren, bis hin zu Vorschlägen, die Schule zu revolutionieren oder in ihrer heutigen Form gar ganz abzuschaffen, sind die unterschiedlichsten Positionen zu beobachten.
Wer sich vertiefter mit dem Leitmedienwechsel beschäftigen möchte, dem sei einerseits die untenstehende Literatur empfohlen. Andererseits enthält der Anhang A »Gesetze des Digitalen« in Kurzform die wichtigsten ökonomischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge des Digitalzeitalters.
Kernaussagen
› Die Digitalisierung und die daraus entstehende Automatisierung und Vernetzung führen dazu, dass der vernetzte Computer das Buch zunehmend als Leitmedium ablöst.
› Wir befinden uns mitten in diesem Leitmedienwechsel, dessen Umfang, Ende und Konsequenzen nur schwer abzuschätzen sind.
› Die Auswirkungen des Leitmedienwechsels sind vergleichbar mit denjenigen bei der Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks und betreffen alle Bereiche unseres Lebens.
› Ökonomisch betrachtet drohen durch den aktuellen Leitmedienwechsel Arbeitslosigkeit und ein steigendes Wohlstandsgefälle.
› Auf der gesellschaftlichen Ebene führt der Leitmedienwechsel zu einem Kontrollverlust sowohl von Organisationen als auch von Einzelpersonen.
› Computer prägen das Denken und Handeln sowohl von Einzelnen als auch von Organisationen.
Weiterführende Literatur
› Pedro Domingos (2015): The Master Algorithm  b6040
b6040
› Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee (2014): The Second Machine Age  b5404
b5404
› Michael Seemann (2014): Das Neue Spiel – Strategien für die Welt nach dem digitalen Kontrollverlust  b5961
b5961
› Constanze Kurz und Frank Rieger (2013): Arbeitsfrei  b5378
b5378
› Mercedes Bunz (2012 ): Die stille Revolution  b5072
b5072
› Dirk Baecker (2007): Studien zur nächsten Gesellschaft  b4152
b4152
› David Weinberger (2007): Das Ende der Schublade. Die Macht der neuen digitalen Unordnung  b3258
b3258
› Michael Giesecke (2002): Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft  b2961
b2961
› Lev Manovich (2001): The Language of New Media  b3145
b3145
› Manuel Castells (1996): Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft  b4855
b4855
› Nicholas Negroponte (1995): Total Digital  b99
b99
› Klaus Haefner (1982): Die neue Bildungskrise  b127
b127
› Alvin Toffler (1970): Future Shock  b4466
b4466
Alle zitierten Quellen dieses Kapitels finden Sie unter  t16001.
t16001.
2 Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren?

Der durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung getriebene Leitmedienwechsel vom Buch zum Computer birgt große Herausforderungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Individuen. Wie soll die Schule damit umgehen  f154? Als Antwort auf diese Frage gibt es zahlreiche Empfehlungen, die sowohl in der Bildungspolitik als auch an Elternabenden und in Leserbriefspalten kontrovers diskutiert werden. Nicht nur bezüglich der Tragweite der Entwicklung scheiden sich die Geister. Auch die Bedeutung von Allgemeinbildung, Schule und Staat stehen zur Diskussion. Da bei dieser Frage Zukunftsprognosen, persönliche Werthaltungen und eigene Schulerfahrungen zusammenkommen, ist schwerlich mit Einigkeit zu rechnen.
f154? Als Antwort auf diese Frage gibt es zahlreiche Empfehlungen, die sowohl in der Bildungspolitik als auch an Elternabenden und in Leserbriefspalten kontrovers diskutiert werden. Nicht nur bezüglich der Tragweite der Entwicklung scheiden sich die Geister. Auch die Bedeutung von Allgemeinbildung, Schule und Staat stehen zur Diskussion. Da bei dieser Frage Zukunftsprognosen, persönliche Werthaltungen und eigene Schulerfahrungen zusammenkommen, ist schwerlich mit Einigkeit zu rechnen.
Bevor der Autor selbst Stellung bezieht, wird in diesem Kapitel zunächst das gesamte Spektrum aufgezeigt, welche Reaktionsweisen auf den Leitmedienwechsel an Schulen zu beobachten sind. Diese »Leitmedienwechsel-Reaktionsskala« erleichtert einerseits den Überblick über die Debatte. Die Skala kann aber auch ganz konkret in Diskussionen hilfreich sein, um verschiedene Gesprächsbeiträge und Standpunkte einordnen und die dahinterstehenden Positionen voneinander abgrenzen beziehungsweise überhaupt erkennen zu können.
Leitmedienwechsel-Reaktion 0: Ignorieren
Die einfachste Art, auf den Leitmedienwechsel zu reagieren, besteht darin, den Wandel auszublenden oder die Folgen für Schule und Bildung zu leugnen  a1180. Diese Haltung trifft man im bildungspolitischen Alltag häufig an. Mitunter ist es jedoch schwierig abzuschätzen, ob es sich beim Ignorieren des Themas um eine bewusste oder unbewusste Entscheidung handelt. Woran lässt sich das Ignorieren eines Themas überhaupt erkennen? Äußert es sich darin, dass ein Thema nicht angesprochen wird? Es gibt Dokumente, welche diese Ignoranz sichtbar werden lassen. Die derzeit wählerstärkste Schweizer Partei, die Schweizerische Volkspartei (SVP), hat 2010 einen Lehrplanentwurf für die gesamte Schweizer Volksschule vom Kindergarten bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit vorgelegt. In dem 94-seitigen Schriftstück kommt der Begriff »Computer« gerade zwei Mal und der Begriff »Internet« ein einziges Mal vor, jedoch nie im Zusammenhang mit der Frage, was Schülerinnen und Schüler künftig lernen sollen. Stattdessen wird die lähmende Verzettelung des heutigen Unterrichts kritisiert und eine Konzentration auf die basalen »Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen« gefordert. Dementsprechend findet Digitalisierung und Leitmedienwechsel bei der SVP nicht statt. Dass die Digitalisierung kein Thema ist, dürfte eine bewusste Konsequenz der Parteipolitik sein, die sich auch außerhalb der Bildung auf Altbewährtes fokussiert.
a1180. Diese Haltung trifft man im bildungspolitischen Alltag häufig an. Mitunter ist es jedoch schwierig abzuschätzen, ob es sich beim Ignorieren des Themas um eine bewusste oder unbewusste Entscheidung handelt. Woran lässt sich das Ignorieren eines Themas überhaupt erkennen? Äußert es sich darin, dass ein Thema nicht angesprochen wird? Es gibt Dokumente, welche diese Ignoranz sichtbar werden lassen. Die derzeit wählerstärkste Schweizer Partei, die Schweizerische Volkspartei (SVP), hat 2010 einen Lehrplanentwurf für die gesamte Schweizer Volksschule vom Kindergarten bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit vorgelegt. In dem 94-seitigen Schriftstück kommt der Begriff »Computer« gerade zwei Mal und der Begriff »Internet« ein einziges Mal vor, jedoch nie im Zusammenhang mit der Frage, was Schülerinnen und Schüler künftig lernen sollen. Stattdessen wird die lähmende Verzettelung des heutigen Unterrichts kritisiert und eine Konzentration auf die basalen »Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen« gefordert. Dementsprechend findet Digitalisierung und Leitmedienwechsel bei der SVP nicht statt. Dass die Digitalisierung kein Thema ist, dürfte eine bewusste Konsequenz der Parteipolitik sein, die sich auch außerhalb der Bildung auf Altbewährtes fokussiert.
Weniger klar ist die Sache bei Bildungsexpertinnen und -experten. Einerseits existiert eine Fülle an spezifischer Literatur, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Konsequenzen die Digitalisierung für Lehrpläne, Unterrichtsgestaltung, Lehrerinnen- und Lehrerausbildung und Schulhausinfrastruktur haben sollten  f154. Andererseits scheint die allgemeine deutschsprachige bildungspolitische Literatur das Thema »Leitmedienwechsel« bisher weitgehend zu ignorieren. So zählen zwei neuere bildungspolitische Publikationen die Digitalisierung beziehungsweise den Leitmedienwechsel nicht zu den aktuellen Herausforderungen der Schule. Rolf Dubs liefert in seinem 2010 publizierten Buch Bildungspolitik und Schule – wohin
f154. Andererseits scheint die allgemeine deutschsprachige bildungspolitische Literatur das Thema »Leitmedienwechsel« bisher weitgehend zu ignorieren. So zählen zwei neuere bildungspolitische Publikationen die Digitalisierung beziehungsweise den Leitmedienwechsel nicht zu den aktuellen Herausforderungen der Schule. Rolf Dubs liefert in seinem 2010 publizierten Buch Bildungspolitik und Schule – wohin  b4790 kurze und leicht verständliche Entscheidungshilfen zu 38 wichtigen Schulthemen, Digitalisierung oder Leitmedienwechsel sucht man jedoch vergebens. Auch in den 18 Beiträgen des 2011 von Lucien Criblez, Barbara Müller und Jürgen Oelkers herausgegebenen Sammelbands Die Volksschule zwischen Innovationsdruck und Reformkritik
b4790 kurze und leicht verständliche Entscheidungshilfen zu 38 wichtigen Schulthemen, Digitalisierung oder Leitmedienwechsel sucht man jedoch vergebens. Auch in den 18 Beiträgen des 2011 von Lucien Criblez, Barbara Müller und Jürgen Oelkers herausgegebenen Sammelbands Die Volksschule zwischen Innovationsdruck und Reformkritik  b5210 ist der Leitmedienwechsel erstaunlicherweise kein Thema. Selbst im Beitrag zum Thema »Lehrmittel« wird die Digitalisierung nicht einmal im Abschnitt Künftige Entwicklungen erwähnt
b5210 ist der Leitmedienwechsel erstaunlicherweise kein Thema. Selbst im Beitrag zum Thema »Lehrmittel« wird die Digitalisierung nicht einmal im Abschnitt Künftige Entwicklungen erwähnt  t15326. Der Begriff »multimedial« fällt zwar mehrfach, aber digitalen Medien bleibt im Text knapp die Rolle der Ergänzung zum gedruckten Lehrmittel.
t15326. Der Begriff »multimedial« fällt zwar mehrfach, aber digitalen Medien bleibt im Text knapp die Rolle der Ergänzung zum gedruckten Lehrmittel.
Leitmedienwechsel-Reaktion -1: Gegensteuern!
Einfacher einzuordnen sind die Reaktionen derer, die in der Digitalisierung vor allem negative Folgen für Schule und Bildung sehen und entsprechend gegensteuern möchten. Oft wird ein idealisiertes Bild der bisherigen Schule dem Schreckensszenario einer vollständig digitalisierten Lebenswelt gegenübergestellt. Gemäß dieser Argumentation ist es die Aufgabe der Schule, eine möglichst von der Digitalisierung unberührte Umgebung zu erhalten  a1192. In der Schule sollen diejenigen Kompetenzen gefördert werden können, die durch die Digitalisierung bedroht werden. Vertreterinnen und Vertreter dieser Position sehen die gesunde Entwicklung von Kindern durch digitale Medien bedroht, dies insbesondere in der Schule. Häufig sind Aussagen der folgenden Art zu hören:
a1192. In der Schule sollen diejenigen Kompetenzen gefördert werden können, die durch die Digitalisierung bedroht werden. Vertreterinnen und Vertreter dieser Position sehen die gesunde Entwicklung von Kindern durch digitale Medien bedroht, dies insbesondere in der Schule. Häufig sind Aussagen der folgenden Art zu hören:
› Kinder benötigen Primärerfahrungen, computervermittelte, virtuelle Erfahrungen können diese nicht ersetzen und würden die Kinder nur verwirren und überfordern.  a295
a295
› Kinder benötigen Bewegung, und Computernutzung führt zu phlegmatischem Herumsitzen und damit zu Haltungsschäden und Übergewicht.
› Kinder benötigen eine geschützte Kindheit, die sie vor gewalthaltigen und pornografischen medialen Einflüssen der rohen Erwachsenenwelt abschirmt.
› Kinder müssen vor falschen Anreizen geschützt werden. Digitale Medien fördern Konsumismus und liefern zu leichte Erfolgserlebnisse, was die Anstrengungsbereitschaft und damit die Schulleistungen senkt.
› Kinder müssen selbst denken lernen und sollen dies weder dem Computer überlassen noch sich mit oberflächlichen Antworten aus dem Internet zufriedengeben.
Eine konstruktive Diskussion ist mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Position manchmal schwierig, vor allem dann, wenn eine absolute Entweder-oder-Position vertreten wird, die mitunter auch sektiererische Züge annehmen kann. Kapitel 7 beschäftigt sich intensiver mit der Frage, wie mit dieser destruktiven Pauschalkritik umgegangen werden kann.
Leitmedienwechsel-Reaktion 1: Integration in alle Fächer
Während dies die ersten beiden Reaktionsweisen verneinen, sind sich die Vertreter der nächsten Positionen darin einig, dass der Leitmedienwechsel ein Thema darstellt, das die Schule betrifft. Es gibt allerdings unterschiedliche Auffassungen darüber, wie stark sich die Schule vom Leitmedienwechsel beeinflussen lassen soll. Die derzeit verbreitetste Position geht davon aus, dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche betrifft und deshalb auch in alle Schulfächer integriert werden sollte  a1181. Die Digitalisierung wird als Thema der Allgemeinbildung gesehen. Dabei reichen die Begründungen von einem eher sanften »Es genügt, wenn sich alle Fächer etwas mit digitalen Themen beschäftigen« bis zum stärkeren »Da der Leitmedienwechsel überall stattfindet, müssen entsprechende Themen auch überall integriert werden!«. Die integrative Position ist bereits in vielen aktuellen Lehrplänen zu finden. Oft wird dabei in Lehrplanzusätzen definiert, was im Bereich der Digitalisierung zu vermitteln sei, ein eigenes Fach oder dafür reservierte Unterrichtsstunden sind dafür aber nicht vorgesehen. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zeigt sich diese Position darin, dass keine entsprechend expliziten Ausbildungsmodule mit digitalen Themen vorgesehen sind, sondern diese in andere Module integriert werden.
a1181. Die Digitalisierung wird als Thema der Allgemeinbildung gesehen. Dabei reichen die Begründungen von einem eher sanften »Es genügt, wenn sich alle Fächer etwas mit digitalen Themen beschäftigen« bis zum stärkeren »Da der Leitmedienwechsel überall stattfindet, müssen entsprechende Themen auch überall integriert werden!«. Die integrative Position ist bereits in vielen aktuellen Lehrplänen zu finden. Oft wird dabei in Lehrplanzusätzen definiert, was im Bereich der Digitalisierung zu vermitteln sei, ein eigenes Fach oder dafür reservierte Unterrichtsstunden sind dafür aber nicht vorgesehen. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zeigt sich diese Position darin, dass keine entsprechend expliziten Ausbildungsmodule mit digitalen Themen vorgesehen sind, sondern diese in andere Module integriert werden.
Leitmedienwechsel-Reaktion 2: Es braucht ein Fach
Ohne Zeitgefäß fehle dem Thema die notwendige Verbindlichkeit, monieren die Verfechterinnen und Verfechter eines eigenen Fachs. Im Vergleich zu den als Fächer strukturierten Bereichen würden überfachliche Aspekte auf mehreren Ebenen oft marginalisiert, wenn die Ressourcen fehlen. In der Schule würden sich Lehrkräfte daher eher auf Themen konzentrieren, für die Noten vergeben werden. In der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern werde das Gewicht stärker auf die Fächer als auf überfachliche Aspekte gelegt, sowohl was die Ausbildungszeit der Studierenden als auch was die Schaffung von entsprechenden Lehrstühlen betrifft. Schulbehörden und Schulleitungen würden Weiterbildungen eher als unumgänglich akzeptieren, wenn das Thema auf dem Stundenplan stehe, und Lehrmittelhersteller sähen eher einen Markt für Themen, die in der Schule als Fach definiert sind. Angesichts der Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre betrachten Kritiker die Integrationsvariante als gescheitert. Erst ein eigenes Fach mit Zeitgefäß und Noten sorge für die notwendige Verbindlichkeit  a1182.
a1182.
Leitmedienwechsel-Reaktion 3: Es braucht sowohl ein Fach als auch Fächerintegration
Die Wahl zwischen Integration und eigenem Fach sei ein falsches Dilemma, das in den letzten 30 Jahren oft die Bildungspolitik blockiert habe, entgegnen demgegenüber die Vertreter der Leitmedienwechsel-Reaktion 3: Während bei der Integration in alle Fächer die Verbindlichkeit fehlt, droht bei der Schaffung eines eigenen Fachs das Thema an eine Speziallehrkraft ausgelagert zu werden. Die übrigen Lehrerinnen und Lehrer fühlten sich damit nicht mehr verpflichtet, sich um Aspekte der Digitalisierung zu kümmern, denn dafür sei ja nun jemand anderes zuständig. Damit ist die Empfehlung zum Leitmedienwechsel bei dieser Position kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch: Es brauche sowohl ein Fach als auch eine Fächerintegration  a1183. Es zweifle schließlich auch niemand an einem Schulfach Deutsch, obwohl in allen anderen Schulfächern ebenfalls Deutsch gesprochen wird.
a1183. Es zweifle schließlich auch niemand an einem Schulfach Deutsch, obwohl in allen anderen Schulfächern ebenfalls Deutsch gesprochen wird.
Leitmedienwechsel-Reaktion 4: Schule muss neu gedacht werden
Die bisher beschriebenen Reaktionsweisen 1 bis 3 betrachten digitale Kompetenzen als zusätzlichen Aspekt, welcher die bisherigen Rahmenbedingungen von Schule (Lehrpläne, Fächer, Stundenplan, Prüfungsformen usw.) nicht infrage stellt. Für Vertreter der Leitmedienwechsel-Reaktion 4 hingegen ist Schule in der bisherigen Form veraltet und ungeeignet für die Herausforderungen der Zukunft. Der Grundgedanke dieser Position geht davon aus, dass in der heutigen globalisierten und vernetzten Welt die großen Probleme in interdisziplinären Teams angegangen werden müssen. Die heutige Schule sei auf die Bedürfnisse der Industriegesellschaft ausgerichtet  a1043 und sei deshalb selbst auch wie eine Fabrik organisiert
a1043 und sei deshalb selbst auch wie eine Fabrik organisiert  a1175: Kinder und Jugendliche würden entsprechend ihrem Alter in Schulzimmer gesteckt, in denen eine einzige Person in 45-Minuten-Portionen erkläre, was richtig und was falsch sei. Dieses auswendig gelernte Wissen werde dann in Einzelprüfungen wieder abgefragt, starre und straffe Strukturen also, in denen die Gleichschaltung aller Produkte und Menschen angestrebt würde. Aus dieser Kritik wird abgeleitet, dass die Fabrikschule von gestern nicht geeignet sei, Schülerinnen und Schüler auf die Welt von morgen vorzubereiten
a1175: Kinder und Jugendliche würden entsprechend ihrem Alter in Schulzimmer gesteckt, in denen eine einzige Person in 45-Minuten-Portionen erkläre, was richtig und was falsch sei. Dieses auswendig gelernte Wissen werde dann in Einzelprüfungen wieder abgefragt, starre und straffe Strukturen also, in denen die Gleichschaltung aller Produkte und Menschen angestrebt würde. Aus dieser Kritik wird abgeleitet, dass die Fabrikschule von gestern nicht geeignet sei, Schülerinnen und Schüler auf die Welt von morgen vorzubereiten  a1184. Schule müsse also grundlegend neu gestaltet werden, um den Erfordernissen im Leitmedienwechsel gerecht zu werden.
a1184. Schule müsse also grundlegend neu gestaltet werden, um den Erfordernissen im Leitmedienwechsel gerecht zu werden.
Das Video eines Vortrags von Sir Ken Robinson, welches diese Position mit einer sehenswerten, wenn nicht gar suggestiven Comic-Visualisierung begründet  t12665, wurde in den letzten vier Jahren über elf Millionen Mal angeklickt.
t12665, wurde in den letzten vier Jahren über elf Millionen Mal angeklickt.
Leitmedienwechsel-Reaktion 5: Wer redet noch von formaler Bildung?
Im Internet verfügbare Videos sind ein gutes Stichwort für die Argumentation der Leitmedien-Reaktion 5: Das Internet biete so viele Ressourcen, dass gar keine formale Bildung mehr notwendig sei. Interessierte Lernende finden im Internet sowohl massenhaft Inhalte, fertige Kurse als auch Gleichgesinnte, um sich auszutauschen. Die Schule verliere zunehmend ihr Informationsmonopol  a974, und das informelle Lernen sei der Ausweg aus einem hoffnungslos veralteten formalen Bildungssystem namens Schule
a974, und das informelle Lernen sei der Ausweg aus einem hoffnungslos veralteten formalen Bildungssystem namens Schule  a1185. Dass die Schule nicht zum Leitmedienwechsel passe, hat Lewis Perelman 1992 im Buch School’s out
a1185. Dass die Schule nicht zum Leitmedienwechsel passe, hat Lewis Perelman 1992 im Buch School’s out  b2138 sehr deutlich formuliert, als er meinte, Computer in die Schule zu integrieren sei etwa so sinnvoll wie Verbrennungsmotoren in Pferde einbauen zu wollen. Auch der Piaget-Schüler und LOGO-Erfinder Seymour Papert meinte bereits 1984, dass der Computer die Schule zum Verschwinden bringen werde – zumindest dann, wenn man Schule als einen Ort definiere, an dem Lernende nach Jahrgängen in Klassen eingeteilt sowie einheitliche Lehrpläne und Prüfungen durchführende Lehrkräfte existieren würden
b2138 sehr deutlich formuliert, als er meinte, Computer in die Schule zu integrieren sei etwa so sinnvoll wie Verbrennungsmotoren in Pferde einbauen zu wollen. Auch der Piaget-Schüler und LOGO-Erfinder Seymour Papert meinte bereits 1984, dass der Computer die Schule zum Verschwinden bringen werde – zumindest dann, wenn man Schule als einen Ort definiere, an dem Lernende nach Jahrgängen in Klassen eingeteilt sowie einheitliche Lehrpläne und Prüfungen durchführende Lehrkräfte existieren würden  t15231. Diese Einschränkung zeigt, dass die auf den ersten Blick klare Trennung zwischen Position 4 und 5 eher fließend verläuft. Es ist eine zunehmende Unzufriedenheit mit den derzeitigen Schulstrukturen, die in der Position 5 schließlich dazu führt, dass eine Reformation der Schule nicht für möglich gehalten und deshalb das Ende der formalen Bildung ausgerufen wird.
t15231. Diese Einschränkung zeigt, dass die auf den ersten Blick klare Trennung zwischen Position 4 und 5 eher fließend verläuft. Es ist eine zunehmende Unzufriedenheit mit den derzeitigen Schulstrukturen, die in der Position 5 schließlich dazu führt, dass eine Reformation der Schule nicht für möglich gehalten und deshalb das Ende der formalen Bildung ausgerufen wird.
Auch die Leitmedienwechsel-Reaktion 5 ist nicht erst in den letzten Jahren entstanden. Neil Selwyn nennt Ivan Illichs Deschooling Society  b5209 von 1971 und Perelmans School’s out von 1992 als prominente Vorreiter dieser Position
b5209 von 1971 und Perelmans School’s out von 1992 als prominente Vorreiter dieser Position  t15205. Während Selwyn bei Illich eher eine Kapitalismuskritik als Motivation sieht, ortet er heute auch neoliberale Überlegungen als Hintergrund des Rufs nach Abschaffung der Schule. Gemäß dieser Argumentation hat die Digitalisierung eine staatlich organisierte und finanzierte Schule überflüssig gemacht. Dank moderner Technologie könnten einerseits die Lernenden selbst Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und andererseits kommerzielle Unternehmen die benötigten Lerninfrastrukturen anbieten. Spätestens hier zeigt sich, dass die Frage nach der richtigen Leitmedienwechsel-Reaktion weit über didaktisch-pädagogische Aspekte hinausgeht.
t15205. Während Selwyn bei Illich eher eine Kapitalismuskritik als Motivation sieht, ortet er heute auch neoliberale Überlegungen als Hintergrund des Rufs nach Abschaffung der Schule. Gemäß dieser Argumentation hat die Digitalisierung eine staatlich organisierte und finanzierte Schule überflüssig gemacht. Dank moderner Technologie könnten einerseits die Lernenden selbst Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und andererseits kommerzielle Unternehmen die benötigten Lerninfrastrukturen anbieten. Spätestens hier zeigt sich, dass die Frage nach der richtigen Leitmedienwechsel-Reaktion weit über didaktisch-pädagogische Aspekte hinausgeht.
Leitmedienwechsel-Reaktion 6: Wer redet noch von Bildung?
Die radikalste Reaktionsstufe schließlich orientiert sich an der Singularitätstheorie, die unter anderem vom Informatiker und Futurologen Ray Kurzweil,  p691 prominent vertreten wird. Mit der Singularität
p691 prominent vertreten wird. Mit der Singularität  w2236 ist der Zeitpunkt gemeint, an dem die künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Kurzweil und andere prognostizieren die Singularität für die Zeit zwischen 2030 und 2040, da in dieser Zeit die reine Rechenkapazität eines Computers diejenige eines menschlichen Gehirns übertreffen wird, wenn das mooresche Gesetz (siehe Kapitel 1) bis dann weiter gültig bleibt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werde es nicht mehr darum gehen, die Bildung von Menschen zu optimieren, sondern das Zusammenleben von Menschen mit intelligenten Robotern zu organisieren und in letzter Konsequenz der künstlichen Intelligenz zu erklären, warum die menschliche Intelligenz überhaupt noch nützlich sei
w2236 ist der Zeitpunkt gemeint, an dem die künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Kurzweil und andere prognostizieren die Singularität für die Zeit zwischen 2030 und 2040, da in dieser Zeit die reine Rechenkapazität eines Computers diejenige eines menschlichen Gehirns übertreffen wird, wenn das mooresche Gesetz (siehe Kapitel 1) bis dann weiter gültig bleibt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werde es nicht mehr darum gehen, die Bildung von Menschen zu optimieren, sondern das Zusammenleben von Menschen mit intelligenten Robotern zu organisieren und in letzter Konsequenz der künstlichen Intelligenz zu erklären, warum die menschliche Intelligenz überhaupt noch nützlich sei  a1186. Der Posthumanismus benötigt keine Bildung.
a1186. Der Posthumanismus benötigt keine Bildung.

Abbildung 2.1: Mögliche Reaktionen der Schule auf den digitalen Leitmedienwechsel
Fazit
In der bildungspolitischen Diskussion findet sich eine große Bandbreite an Meinungen, was mit der Schule angesichts des Leitmedienwechsels geschehen sollte. Sie reicht von abwehrenden oder ignoranten Haltungen über gemäßigte Modernisierungsabsichten und revolutionäre Sichtweisen bis hin zur Forderung, die Schule oder gar die Bildung abzuschaffen (siehe Abbildung 2.1). Diese Positionen sind unvereinbar. In ihnen spiegelt sich weit mehr als die Frage nach der Bedeutung des Computers in der Schule wider. Die Leitmedienwechsel-Reaktionen repräsentieren ganze Welt- und Wertvorstellungen. Entsprechend schwierig sind Diskussionen zu diesem Thema. Die Leitmedienreaktions-Skala kann aber helfen, extremere Positionen in pragmatischen Diskussionen in ihre Schranken zu verweisen, entweder laut vernehmbar öffentlich oder leise für sich selbst.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.