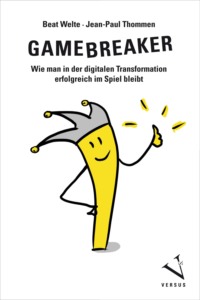Kitabı oku: «Gamebreaker», sayfa 2
Axiom 5: Cost-Cutting-Gone-Wrong: Zentralistisch geführte Unternehmen reagieren auf Probleme mit Kostensenkungsmaßnahmen – am völlig falschen Ort. Wenn die Geschäftszahlen schlecht ausfallen, haben Unternehmen mehrere Handlungsvarianten. Kosten zu sparen ist eine davon. Nur passiert das in hierarchisch geführten, prozessgesteuerten Großunternehmen häufig am falschen Ort: bei Mitarbeitenden, die in den Geschäftseinheiten und in Landesorganisation nahe bei den Kunden viel zur Wertschöpfung des Unternehmens beitragen. Im Prozessdenken geht diese einfache Erkenntnis häufig vergessen: Die Mitarbeitenden an der Kundenfront sind in der Wahrnehmung der Prozess-Steuerer relativ unwichtig. Sie «executen» bloß (und das ungenügend, sonst wären die Resultate nicht so schlecht!) und können leicht ersetzt werden. Außerdem ist der Abbau von hierarchisch weit entfernten Mitarbeitenden emotional weit weniger einschneidend als der Abbau im höheren oder mittleren Management.

Es ist offensichtlich, dass ein solches Verhalten gemäss diesen Axiomen und die daraus resultierende Unternehmenskultur keine adäquate Anpassungsleistung an sich verändernde Marktsituationen zu leisten imstande ist. Ganz im Gegenteil: Es führt zu einer geistigen Erstarrung, blinder Prozesserfüllung und mannigfachen individuellen Überlebensstrategien, die nichts mit dem Unternehmenserfolg zu tun haben, diesen sogar behindern. Nicht selten geben Mitarbeitende in solchen Unternehmen ihrer Verwunderung Ausdruck, dass das Unternehmen auf der Basis solch offensichtlicher Fehlleistungen überhaupt existieren könne. Die Antwort darauf ist einfach: Das Schwungrad von Großunternehmen, teilweise seit Jahrzehnten angetrieben, dreht sich auch dann noch, wenn niemand mehr wirklich Schub verleiht – zumindest für eine gewisse Zeit.
Lessons learned
■ Unternehmen mit einer zentralistischen Führung auf der Basis eines starren Prozessmanagements sind nicht in der Lage, sich auf eine immer dynamischere Markt- und Wettbewerbssituation einzustellen.
■ Das Prozessdenken führt zu einer Kultur der Prozesserfüllung und Systembefriedigung als Selbstzweck.
■ Auf die Bedrohung, disruptiert zu werden, reagieren viele Unternehmen mit «mehr desselben»: mit einem rigideren Prozesskorsett mit noch aufwendigeren Kontrollmechanismen.
■ Gamebreaking ist eine Geisteshaltung: Sich selbst, sein Geschäftsmodell und die dahinter liegenden Hypothesen sowie die eigene Leistung im Unternehmen immer wieder kritisch in Frage zu stellen – mit dem Ziel, bessere innovative Lösungen zu finden.
■ Jedes Unternehmen und jeder einzelne Mitarbeitende muss seine Gamebreaking-Fähigkeiten stärken, um langfristig eine (berufliche) Existenzberechtigung und Überlebenschance zu haben.
2 Der verlorene Kunde

Die Karriere des größten Gamebreakers, den die Schweiz wahrscheinlich je hervorgebracht hat, beginnt mit zwei Pleiten: 1923 wurde der Kolonialwarenhändler Sigg & Duttweiler liquidiert. Der eine der beiden Inhaber wanderte in der Folge nach Brasilien aus. Dieser setzte kurz darauf – nach einem weiteren Misserfolg, aber mit neuer Perspektive auf den Handel bereichert – zu einem beispiellosen Gamebreaking an. Seine «spielbrechende» Idee: Den Zwischenhandel eliminieren und eine Verkaufsorganisation aufbauen, die direkt vom Produzenten zum Konsumenten führt. Am 15. August 1925 gründete Gottlieb Duttweiler zu diesem Zweck die Migros. Die «Brücke» wurde dabei zum Symbol für diesen Brückenschlag (vom Produzenten zum Konsumenten) und zum Markenzeichen der Migros.
Damit machte Duttweiler etwas, was auch heutiges «modernes» Gamebreaking auszeichnet: Er eliminierte eine ganze Stufe in der Wertschöpfungskette und sah sich damit in die Lage versetzt, seinen Kunden die Produkte wesentlich günstiger anzubieten als die Konkurrenz. Nichts anderes, aber noch etwas radikaler, macht das heute der Online-Händler Zalando, der den traditionellen Detailhandel in Angst und Schrecken versetzt und stark wächst. Das ist echtes, auf den Kunden und den Kundennutzen ausgerichtetes Gamebreaking: Denn kein Kunde hat ein Interesse daran, mehrere unnötige Stufen in einer Wertschöpfungskette zu füttern, die das Endprodukt verteuern. Wem das offensichtlich und banal erscheint, der sei daran erinnert, dass auch heute noch sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle auf der Basis aufgeblähter und ziemlich nutzloser Wertschöpfungsketten basieren: 2012 starb einer der reichsten Schweizer, Walter Haefner, der einen Großteil seines Vermögens mit dem exklusiven Generalimport von Autos über die Firma Amag erzielt hat. Es ist also auch heute noch durchaus möglich, mit Zwischenhandel reich zu werden – bis früher oder später – wahrscheinlich eher früher! – auch hier irgendwann ein Gamebreaker kommt und den Schweizern billige Autos bringt. Erste Ansätze mit Direktimporteuren sind immerhin schon erkennbar.
Indes war Duttweiler noch in anderer Hinsicht ein Gamebreaker, der auch heute viele Nachahmer findet: Kunden wollen nämlich nicht nur kostengünstige Produkte, sie wollen diese Produkte auch bequem und mit möglichst kleinem Aufwand und Zeitverlust erwerben. Und auch hier erwies sich der Migros-Gründer als höchst einfallsreich. Wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, dann muss der Prophet eben zum Berg gehen, mag sich Duttweiler gesagt haben: Mit einem Startkapital von 100 000 Franken erwarb er fünf Ford-T-Lastwagen und bestückte diese mit sechs Basisartikeln (Kaffee, Reis, Zucker, Teigwaren, Kokosfett und Seife), die er zum Teil bis zu 40% günstiger als die Konkurrenz anbot – und dies direkt vor der Haustür. Auch dieser «spielbrechenden» Idee von Duttweiler wird heute in vielfachen Varianten nachgelebt: Die Pizza muss nicht mehr in der Pizzeria erworben werden, sondern wird ins Haus geliefert. Oder noch ein bisschen futuristischer, aber bereits Realität: Mit dem Tintenlieferservice von HP bekommt der Kunde die Tinte automatisch zugeschickt: Der Drucker erkennt den «Notstand» und löst automatisch eine Bestellung bei HP für neue Tinte aus.

Duttweiler war zeitlebens eine Figur, die stark über das schweizerische Mittelmaß herausragte und stark polarisierend wirkte. Neben der Migros gründete er auch seine eigene Zeitung sowie eine politische Partei und scheute sich auch in späteren Jahren nicht, seine Meinung sehr «handgreiflich» kundzutun: Weit über die Landesgrenzen hinaus sorgte ein Steinwurf von Duttweiler 1948 für großes Aufsehen: Der bekannte Unternehmer und Parlamentarier Duttweiler warf eine Fensterscheibe im Bundeshaus zu Bern ein aus Protest, dass sein Vorstoß zur wirtschaftlichen Landesverteidigung verschleppt wurde.
Gamebreaker, so lernen wir, sind häufig kontroverse, polarisierende, «unbequeme» Zeitgenossen. Unternehmen müssen das aushalten können, wollen sie den Nutzen aus Gamebreaking abschöpfen können. Das fällt nicht immer leicht: Noch heute findet man ältere Menschen, die niemals einen Migros-Laden betreten würden, weil ihnen die Migros mit ihren «radikalen» Ideen immer noch suspekt erscheint. Umso erstaunlicher ist es, dass die Migros zum größten und erfolgreichsten Detailhändler aufsteigen konnte, und dies, obwohl Duttweiler neben seiner polarisierenden Gamebreaker-Persönlichkeit noch einen anderen Wettbewerbsnachteil hatte: Er bot aus Überzeugung keinen Alkohol und Tabak an.
Die radikale Kundenorientierung von Duttweiler steht in scharfem Kontrast zur Art und Weise, wie die heutigen Unternehmen operieren. Wie wir im vorherigen Kapitel gelernt haben, sind prozessorientierte Großunternehmen heute vor allem mit sich selbst beschäftigt, und radikale neue Ansätze wie derjenige von Duttweiler bleiben aus. Das mit sich selbst beschäftigte System wird aber dysfunktional, weil es seinen eigentlichen Existenzzweck völlig aus den Augen verliert: dem Kunden einen möglichst großen Mehrwert zu liefern.
Das hat jeder von uns schon in der einen oder anderen Form erlebt. Nämlich dann, wenn er ein Problem mit einem Produkt oder einer Dienstleistung eines großen Unternehmens hat. Kontaktiert man das Unternehmen, landet man unweigerlich in einem «Servicecenter», das im besten Fall im eigenen Land, wahrscheinlich aber weit weg und in nicht seltenen Fällen in Indien oder Nordafrika angesiedelt ist. Aus Sicht der Unternehmensorganisation liegen solche «Servicecenter» (und damit der Kunde mit seinem Problem) an der «Peripherie» des Unternehmens, und dessen Mitarbeitende stehen oft schlecht bezahlt an der untersten Stelle in der Hierarchie. Sie sind mit keinerlei Kompetenzen, dafür mit einem Fragebogen ausgestattet, der die dreißig häufigsten Probleme abdeckt. Schlechte Telefonleitungen und mangelnde Sprachkenntnisse des Gegenübers erschweren es oft, sein Anliegen überhaupt anzubringen. Immerhin: Liegt man innerhalb der dreißig vom Prozess vorgesehenen «Standardanliegen», hat man zumindest eine Chance auf eine zufriedenstellende Antwort bzw. Lösung seines Problems. Liegt man aber außerhalb, dann nimmt das Unternehmen meistens in Kauf, dass der Kunde mit seinem ungelösten Anliegen unzufrieden zurückbleibt. Denn solche Großunternehmen bieten den Kunden niemals das Beste, sondern nur so viel wie nötig. Ganz im Sinne des Löwenbeispiels im ersten Kapitel: Ich muss nicht schneller als der Löwe sein, sondern nur schneller als der andere im Wettrennen.
In solchen Unternehmen geht der Kunde buchstäblich verloren – und er fühlt sich auch verloren: nämlich im undurchdringlichen organisatorischen Gewirr eines Unternehmens, das schlicht nicht dafür gemacht ist, ihm zu helfen. Statt dem Kunden zu helfen, schiebt das Unternehmen das Problem häufig zurück im Sinne von: selbst schuld.
Unternehmen lassen unzufriedene Kunden als Kollateralschaden zurück und vergeben genau dort ihre größte Chance: Denn wo Kunden unzufrieden sind, besteht das größte Potenzial, sich selbst in Frage zu stellen, etwas anders zu machen und das Kundenbedürfnis wirklich zu erfassen und zu erfüllen. Aber genau dies geschieht nicht, denn kein zentralistisch geführtes und prozessorientiertes Großunternehmen ist so aufgestellt, dass es sich von der Peripherie her und mit dem Input von hierarchisch tiefgestellten Mitarbeitenden neu erfinden könnte. Es ist deshalb nicht überraschend, dass sie disruptiert werden von Unternehmen, die den Fokus genau darauf legen: Wie kann ich einem Kunden mit möglichst geringem Aufwand einen möglichst großen Mehrwert erbringen und zwar genau dort, wo seine größte Unzufriedenheit ist. Wegen dieser Unzufriedenheit werden die Angriffsflächen der Großunternehmen immer größer. Und damit bieten sich für die Herausforderer vielfältige Chancen für ein erfolgreiches Gamebreaking.
| Aus der Praxis | Lidl – Gamebreaking mit Chatbots |
Das Disruptionspotenzial ist immer dort am höchsten, wo der Kundenschmerz am größten ist. Dies ist meistens an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden der Fall. Denn die meisten Unternehmen sind organisatorisch kozentrisch aufgebaut: Im Zentrum steht nicht etwa der Kunde, sondern die Geschäftsleitung, und darum herum gruppieren sich Geschäftseinheiten und Funktionen, in abnehmender Bedeutung gegen außen. An der «Peripherie» vollzieht sich der Kundenkontakt. Je weiter weg vom Zentrum, desto tiefer im Allgemeinen die Bezahlung, die Entscheidungskompetenz und – oft bedingt durch häufige Wechsel – auch das Wissen.
Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren dramatisch ändern mit Chatbots, textbasierten «intelligenten» Dialogsystemen: Nach vielen holprigen Versuchen – etwa der 2016 stillgelegte Chatbot Anna von Ikea – werden sich die digitalen Helfer in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich durchsetzen. Mussten frühere Chatbots mühsam und mit viel menschlichem Aufwand trainiert werden, lernen heutige Chatbots dank Künstlicher Intelligenz beziehungsweise Machine Learning selbständig dazu – sie werden mit jeder Kundenanfrage «gescheiter».
Hinzu kommen enorme Fortschritte in den Natural-Language-Processing-Fähigkeiten (maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache) und Sentiment Analytics (Stimmungserkennung): Kombiniert mit einem Avatar (einer virtuellen Figur) werden Chatbots bald in der Lage sein, sich mit Menschen natürlich zu unterhalten, sich dabei situationsbeziehungsweise stimmungsgerecht zu verhalten und dank unbeschränktem Zugang zu relevanten Wissensdatenbanken zu (fast) allem Auskunft zu geben – und das rund um die Uhr, ohne Urlaub oder krankheitsbedingte Ausfälle und «brain drain» (Wissensschwund) bei Kündigungen.
Die allerbesten Chatbots in den Labors sollen bereits heute so gut sein, dass es schwer ist, sie im Dialog von menschlichen Wesen zu unterscheiden. Ein durchschnittlicher Chatbot hingegen versteht heute erst etwa 60 bis 70 Prozent der gesprochenen Sprache. Verbreitet sind deshalb vor allem Chatbots auf der Basis von Text.
Lidl setzt – aufbauend auf Facebook Messenger – die Chatbot «Margot» ein, die den Konsumenten in England zum richtigen Wein verhilft. Auf die Frage «Welche Burgunder können Sie mir empfehlen?» folgt prompt die Antwort der «persönlichen Favoriten» mit einem Mâcon Villages für 6.99 Pfund an der Spitze. Eine Spielerei? Vielleicht. Aber gemäß einer Studie des Forschungsunternehmens Spiceworks sind 2018 rund 40% der Großunternehmen dabei, solche Chatbots aufzuschalten. Denn wer obenauf schwingt, wird seinen Kunden einen so hervorragenden Service bieten können, der mit «normalen» Mitteln kaum finanzierbar wäre. Und wer früh beginnt, hat gute Chance, zum Gamebreaker in seiner Branche zu werden.
Lessons learned
■ Gamebreaking ist nicht neu, sondern war schon zu Duttweilers Zeiten gefragt. Durch die stark erhöhte Veränderungsgeschwindigkeit und tiefgreifenden Veränderungen ist die Notwendigkeit für Gamebreaking indes stark gestiegen.
■ Echte Gamebreaker können ihre Idee wie Duttweiler in einen Satz fassen: «Ich senke die Preise durch Ausschalten des Zwischenhandels und bringe die Produkte vor die Haustüre des Kunden.»
■ Gamebreaker erfinden neue Geschäftsmodelle, indem sie oft unnötige Stufen in der Wertschöpfungskette ausradieren (Zwischenhandel) und dem Kunden auf diese Weise einen Mehrwert bringen.
■ Gamebreaker stellen die Dinge auf den Kopf und lösen sich von Dingen, die «schon immer so gemacht wurden»: Nicht der Kunde geht in das Geschäft zu den Produkten, sondern die Produkte kommen zum Kunden.
■ Gamebreaker im Sinne von Disruptoren sind oft stark polarisierende, politisch nicht immer korrekte Menschen: Ein Fenster im Bundeshaus einzuwerfen ist eigentlich ein No-Go – das sollte aber nicht von der Leistung des Gamebreakers ablenken.
■ Dort, wo der größte Kundenschmerz ist, befindet sich die Stelle mit dem größten Disruptionspotenzial.
3 Es muss nicht immer Disruption sein

Gottlieb Duttweiler war ein Gamebreaker, der nicht nur eine ganze Branche revolutioniert hat (den Detailhandel), sondern als Politiker mit einer neu gegründeten Partei (Landesring der Unabhängigen) und einer Zeitung («Die Tat») enorm tiefe und breite Spuren hinterlassen hat. Diese Spuren wären noch heute wesentlich deutlicher, wenn die Nachfolger von Duttweiler mehr von seinem Geist geerbt hätten, was aber nicht der Fall ist. Fairerweise muss man sagen: Duttweiler war eine Jahrhundertfigur. Kann eine solche, in ihrem Anspruch und ihrer Wirkung erdrückende Jahrhundertfigur wirklich das Vorbild für modernes Gamebreaking sein? Schließlich ist nicht jeder von uns ein Duttweiler – und es ist auch nach dem Lesen dieses Buches nicht wahrscheinlich, dass Duttweilers gleich hundertfach aus dem Boden schießen.
Die Antwort darauf liegt in einer Begriffsklärung von Gamebreaking und Disruption. Der Harvard-Professor Clayton M. Christensen gilt als Erfinder des Begriffs «Disruptive Innovation», oft auch einfach als «Disruption» bezeichnet. Allerdings wird dieser Begriff allzu oft falsch verwendet, wie Christensen zu bedenken gibt. Er schlägt vor, drei Formen der Innovation auseinanderzuhalten.
1. Effizienz-Innovation: Ein Unternehmen verbessert die Produktion oder den Verkaufsprozess und erreicht damit dieselben Resultate, aber mit geringerem Aufwand und geringeren Kosten. Ein Autohersteller gestaltet die Herstellung effizienter, beispielsweise durch Automatisierung bestimmter Arbeitsschritte. Er reduziert damit die Herstellungskosten, verändert das Produkt aber nicht.

2. Inkrementelle Innovation4: Ein Unternehmen hat ein gutes Produkt und macht dieses Produkt über die Jahre immer etwas besser. Alle paar Jahre bringt der Autohersteller verbesserte Autos in derselben Modellreihe hervor. Grundsätzlich funktionieren die aber noch gleich: zum Beispiel Verbrennungsmotor, vier Räder, Steuerrad mit darum herum organisierten Armaturen.
3. Disruptive Innovation oder einfach Disruption: Ein Unternehmen befriedigt ein Marktbedürfnis durch einen völlig neuen Ansatz, beispielsweise, indem es den Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor ersetzt und sich selbst weniger als Autobauer, sondern als Softwareunternehmen definiert, das bequeme und umweltfreundliche Mobilität ermöglicht.
Disruptive Unternehmen ersetzen (Dienstleistungs-)Produkte, die bis anhin sehr kompliziert oder teuer waren, durch ein anderes, häufig einfacheres, kostengünstigeres Produkt, das dann von den Kunden euphorisch aufgenommen wird. Christensen betont, dass nur mit dieser dritten Form ein starkes Marktwachstum stattfinden kann. Bei den beiden ersten Formen der Innovation kann das Unternehmen allenfalls seine Marge optimieren (Effizienz-Innovation) oder aber einen höheren Verkaufspreis erzielen (Inkremtentelle Innovation), weil das Produkt besser ist.
Interessanterweise betrachtet Christensen die beiden meistgenannten «disruptiven» Unternehmen, nämlich Airbnb und Uber, gerade nicht als wirkliche Disruptoren: Ihr Geschäftsmodell besteht darin, vorhandene Ressourcen (Wohnungen, Autos) besser zu nutzen – ein typisches Beispiel für eine inkrementelle Innovation.
Disruption geschieht in der Regel immer dann, wenn ein oft kleines, noch junges Unternehmen mit geringen Ressourcen ein erfolgreiches, bestehendes Geschäft mit einem völlig neuen Ansatz konkurrenziert. Die Chancen dafür sind im digitalen Zeitalter und auf der Basis neuer, flexibler und kostengünstiger IT-Bereitstellungsformen (siehe Praxisbeispiel Cloud auf Seite 30) besonders hoch. Traditionelle Unternehmen verstehen es oft schlecht, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen, und das hat einen sehr einfachen Grund: Die Manager eines Unternehmens sind primär nicht dafür bezahlt, ihr bestehendes Geschäftsmodell, mit dem sie bis anhin sehr erfolgreich waren, grundsätzlich in Frage zu stellen (auch wenn sie das eigentlich müssten). Sie sind in der Realität dafür bezahlt, es zu optimieren, und das mit einer oft sehr kurzfristigen Perspektive. Ihr ganzes Denken und Streben ist, wie bereits in Kapitel 1 dargelegt, ausschließlich darauf ausgelegt, den nächsten Business Review zu überstehen – indem sie die Zahlen liefern (oder übertreffen), die angesagt wurden. Es wäre völlig ausgeschlossen, dass ein Manager bei solchen Reviews sagen würde: «Ich bin zwar 20% unter Budget und werde nächstes Quartal sogar 30% unter Budget sein. Dafür habe ich einen revolutionären Ansatz gefunden, wie ich mittelfristig unsere Kunden begeistern, die Umsätze steigern und unsere Marge stark erhöhen kann.» Das wäre sein sicheres Ende.
Wie in der Automobilindustrie konzentrieren sich etablierte Unternehmen oft darauf, Produkte inkrementell besser zu machen und ihre Produkte und Dienstleistungen für jene Kundensegmente zu optimieren, welche die höchste Profitabilität versprechen. Dabei verpassen sie oft die großen disruptiven Veränderungen (z. B. das Elektroauto) und sind nicht in der Lage, sich selbst zu kannibalisieren. Gleichzeitig vernachlässigen sie andere, weniger margenträchtige Kundensegmente. Dies ist die Chance für die disruptiven Herausforderer: Sie bieten einfachere Produkte zu einem geringeren Preis an, oft zugeschnitten auf die vernachlässigten Kundensegmente. Mit der Zeit interessieren sich immer mehr Kunden für diese Produkte – und die alten Unternehmen werden «disruptiert». Einige disruptive Firmen greifen niemanden an, sondern schaffen neue Märkte: IBM hat am 12. August 1981 den ersten Personal Computer, den IBM-PC 5150, vorgestellt. Das war nicht nur ein neues Produkt – IBM hat damit auch einen neuen Markt lanciert.
| Aus der Praxis | Cloud lässt Eintrittsbarrieren fallen |
2003 schrieb ein kleines Unternehmen in Bristol (England) Geschichte. Als erstes Unternehmen stellte 422 South einen Animationsfilm mit Hilfe von Rechenkapazitäten aus der Cloud her. Das Rendering (die «Rasterung») von Animationsfilmen erfordert enorme Rechenkapazitäten und als Folge davon hohe Investitionen in den Aufbau eines eigenen Rechenzentrums. Ein eigenes Rechenzentrum aufzubauen ist nicht nur sehr kapitalintensiv und teuer im Unterhalt, sondern die Anlage ist über weite Strecken auch «arbeitslos», wenn nicht gerade ein Film gerendert wird. 422 South konnte zeigen, dass es auch anders geht und dass damit die Eintrittshürden für kreative Unternehmen der Filmbranche erheblich gesenkt werden können: 18 832 Frames für den Kurzfilm «The Painter» wurden dank Cloud-Power in damals rekordverdächtigen siebzehn Tagen gerendert. Im eigenen Rechenzentrum hätte die Fertigstellung drei Monate gedauert.
Die Bereitstellung von Rechenkapazität aus der Cloud nach Bedarf und die Bezahlung nach Verbrauch ist heute in der Filmindustrie und auch in anderen Branchen weit verbreitet und darf als ganz entscheidender Faktor für die fortschreitende Digitalisierung beziehungsweise Erhöhung der Veränderungsgeschwindigkeit gesehen werden.
Als unermüdlicher Fahnenträger dieser Idee und echter Gamebreaker machte sich Jeffrey Katzenberg, der CEO von Dreamworks, einen Namen: Er setzt völlig auf Cloud-Dienstleistungen bei der aufwendigen Produktion seiner animierten Filme.
Mit gestiegenen Ansprüchen an Animationsfilme ist der Cloud-Ansatz noch wichtiger: Im Film «Drachenzähmen leicht gemacht 2» von Dreamworks Animation wird jeder Grashalm, jede Rinde am Baum und jeder Gesichtsausdruck aufwendig gestaltet. Um die hohen Ansprüche des Publikums zu erfüllen, erfordert ein neunzigminütiger animierter Film vierundzwanzig Bilder pro Sekunde, also insgesamt 130 000 Einzelbilder. Das sind etwa 500 Millionen digitale Dateien und sagenhafte 250 Billionen Pixel pro Film. Dafür sind nicht nur enorme Rechen- und Speicherkapazitäten erforderlich, sondern auch eine hervorragende Vernetzung, denn die am Film beteiligten Künstler und Techniker arbeiten rund um den Globus.
Auch die rechtzeitige Auslieferung an die Kinos erfordert schnelle Datenverbindungen. Mittlerweile erscheint es als selbstverständlich und logisch, die enormen Rechenkapazitäten aus der Cloud zu beziehen und die an der Produktion Beteiligten zu vernetzen. Wenn man aber bedenkt, dass es fünf Jahre dauert, einen Animationsfilm herzustellen, und dass Antizipation (sind Drachen z. B. in fünf Jahren noch populär?), Geheimhaltung und Überraschungseffekt entscheidende Erfolgsfaktoren sind, ist der Mut zum Cloud-Ansatz bemerkenswert.
Ein Gamebreaker muss kein Duttweiler sein. In unserer Definition ist der Gamebreaker eine Person, die in einer der drei Innovationskategorien nach Christensen einen entscheidenden Beitrag leistet: Mit ihrem Geistesblitz kann sie die Effizienz erhöhen, einen Beitrag zur Steigerung der inkrementellen Innovation leisten oder aber den Anstoß zu einer disruptiven Innovation geben. Wer sich mental auf Gamebreaking einlässt, der wird allerdings einen erstaunlichen Effekt feststellen: Die Fähigkeit, die Dinge «anders» zu sehen, lässt sich trainieren – und diese Fähigkeit wird immer wichtiger und die Veränderung der Sichtweise immer radikaler.
Was ist damit gemeint? Lässt sich ein Manager oder Mitarbeitender erst einmal auf das Wagnis ein, das Bestehende in Frage zu stellen und eigene Vorstellungen darüber zu entwickeln, wie man etwas besser, schneller, anders machen könnte, dann wird er sehr schnell einen Beitrag zur Effizienz-Innovation liefern können: Die meisten Mitarbeitenden – insbesondere in Großunternehmen – können viele Beispiele nennen, wie das Unternehmen effizienter werden könnte – und sei es nur, indem sie vorschlagen, an bestimmten Sitzungen nicht mehr teilzunehmen, weil das für ihre Tätigkeit gar nicht notwendig ist. So können Kosten für Überstunden vermieden werden. Auch inkremementelle Innovationen, die dem Kunden ein verbessertes Produkt und einen einfacheren Prozess bringen, kennt jeder Mitarbeitende. Bewirbt man sich beispielsweise für eine Kreditkarte, dann wird man ein Formular mit seinen Personalien ausfüllen müssen, inklusive Namen, Vornamen und Geburtsdatum. Kann man Namen und Vornamen noch nachvollziehen (um das Formular eindeutig zuordnen zu können), macht das Geburtsdatum kaum mehr Sinn: Denn die Antragssteller müssen gleichzeitig eine Kopie ihres Passes oder ihrer Identitätskarte mitliefern, auf der das Geburtsdatum notwendigerweise aufgeführt ist. Mit anderen Worten: Die inkrementelle Innovation erleichtert dem Kunden den Bewerbungsprozess, was nicht zu unterschätzen ist, weil kaum jemand einen besonderen Reiz darin sieht, Antragsformulare auszufüllen. Hat ein Gamebreaker aber erst einmal gelernt, die Dinge in Frage zu stellen und nach besseren Möglichkeiten für das Unternehmen und den Kunden zu suchen, dann wird es ihm sehr viel leichter fallen, völlig «out-of-the-box» zu denken. Er wird nach Lösungen suchen, bei denen der Kunde überhaupt kein Antragsformular mehr ausfüllen, sondern nur noch die Passkopie schicken muss. Der verblüffend einfache Prozess des Fintech-Unternehmens Revolut macht das vor und lässt die Formularstapel traditioneller Banken alt aussehen. Dies wie auch die kinderleichte Kontoverwaltung in Echtzeit auf einer App ist disruptives Gamebreaking und bringt alle Mitbewerber in Zugzwang.
| Aus der Praxis | Cisco – Ohne Nebel ist die Wolke gar nichts |
Cloud-Computing war bis anhin das große Schlagwort in der digitalen Transformation – die Zukunft gehört aber ganz eindeutig dem Fog-Computing, also der Nebel-Rechnerei. Das hat mit dem Internet der Dinge (Internet of Things) zu tun, also mit der Tatsache, dass immer mehr «Dinge» – z.B. von der Smart Watch bis zum Turnschuh – Daten erfassen, gegenseitig austauschen und irgendwo speichern. Diese Datenflut übersteigt die Kapazitäten bestehender 4G-Netzwerke wie auch der Cloud-Rechenzentren bei weitem und führt zu Verzögerungen, die unter Umständen tödlich sein können.
Nehmen wir das nicht allzu ferne Beispiel der selbstfahrenden Autos. Gemäß dem Chip-Produzenten Intel werden diese einen wahren Tsunami an Daten generieren – rund 4000 Gigabyte pro Tag. Das ist etwa gleich viel, wie heute 3000 Bürger durchschnittlich in 24 Stunden erzeugen. Einige dieser Daten – etwa über den Benzinverbrauch – sind relativ zeitunkritisch und können bedenkenlos in irgendein Cloud-Center am andern Ende der Welt gesendet werden. Andere Daten, etwa aus dem Videostream und den Sensoren, sind dagegen höchst zeitkritisch: Denn diese Daten stellen sicher, dass wir nicht mit anderen sich schnell bewegenden Autos zusammenstoßen. Diese zeitkritischen Daten müssen deshalb vor Ort und in «Echtzeit» verarbeitet werden – später können sie bei Bedarf für eine bestimmte Zeit in einer Cloud gespeichert werden – z.B. um bei Unfällen zu rekonstruieren, was genau geschehen ist. Diese dezentrale Datenverarbeitung benötigt natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur, die uns, genau wie der Nebel, auf der Erde einhüllt: Sogenannte Fog-Nodes (Nebelknoten) werden in selbstfahrenden Autos selbst zu finden sein, aber auch am Straßenrand, in Lichtsignalen und andern Orten. Je schneller und je mehr sich das Konzept der selbstfahrenden Autos durchsetzt, desto schneller wird die dezentrale Netz- und Verarbeitungsinfrastruktur wachsen müssen. Wer wird diese nächste Stufe der digitalen Transformation als Gamebreaker dominieren? Eine Vorhersage ist schwierig, indes scheint der traditionelle Netzwerkgigant Cisco zur Zeit gute Karten zu haben.
Ein Gamebreaker wird sich in der Innovationshierarchie von unten nach oben durcharbeiten. Denn die Fähigkeit, die Dinge anders zu sehen, wird dem echten Gamebreakern über die Zeit zur zweiten Natur. Wesentlich ist dabei noch etwas anderes: Ein Gamebreaker verabscheut komplizierte Business-Pläne mit ausgeklügelten «Predict and control»-Mechanismen, wie das im Kapitel 1 beschrieben ist. Ein Gamebreaker ist ein König der kleinen Schritte: Er überlegt sich, wie etwas besser gemacht werden könnte, und legt unmittelbar mit der Umsetzung los. Denn ein echter Gamebreaker zieht seine Kraft nicht nur aus Geistesblitzen, sondern aus dem positiven Feedback, das er nach der Umsetzung seiner Idee vom Unternehmen oder – noch besser – direkt vom Kunden kriegt. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass moderne Managementinstrumente – wie zum Beispiel das Design Thinking – diesen Ansatz ihrem Denken zugrunde legen.5 Es ist diese Psychologie der kleinen Schritte, die den Gamebreaker immer weiter antreibt, nach neuen Lösungen zu suchen. «Das Bessere ist der Feind des Guten» gilt für Gamebreaker in ganz besonderem Maß. Deshalb werden Gamebreaker über die Dauer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei der disruptiven Innovation landen, weil diese dem Kunden die größte Verbesserung bringt.

Alle drei Formen der Innovation sind wertvoll, für das eigene Unternehmen wie auch für den individuellen Gamebreaker. Dieser wird allerdings sehr genau darauf achten wollen, welche Form der Innovation (falls überhaupt) in seinem Unternehmen den Vorrang hat. Denn er wird sich bewusst sein: Bleibt das Unternehmen als Ganzes bei den ersten beiden Formen stecken, dann ist es immer noch akut gefährdet, disruptiert zu werden. Das gilt insbesondere dann, wenn die Kundenzufriedenheit gering ist. Aber selbst hohe Kundenzufriedenheit ist kein Schutz vor Disruption, da die Kunden oft gar nicht wissen, dass sie ein noch besseres Produkt wollen beziehungsweise kriegen können. Mercedes-Kunden waren und sind im Allgemeinen sehr zufrieden mit dem Produkt und konnten sich bis vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht vorstellen, dass sie eigentlich ein umweltfreundlicheres und schneller beschleunigendes Auto von Tesla wollten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.