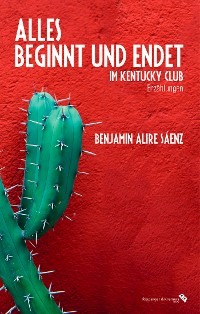Kitabı oku: «Alles beginnt und endet im Kentucky Club», sayfa 2
7
Am nächsten Sonntag stand er vor meiner Tür. Es war früh am Morgen. »Mein Onkel ist gestern Abend ins Krankenhaus gebracht worden.«
»Du siehst müde aus«, sagte ich. Und er sah wirklich müde aus. Müde und traurig, sein weißes Hemd zerknittert.
»Ich hab auf einem Stuhl in seinem Krankenzimmer geschlafen.«
Wir gingen die Treppe hoch zu meiner Wohnung.
»Ich mag deine Welt«, sagte er, während er das neue Bild ansah, an dem ich arbeitete. Dann bemerkte er die Worte auf meinem Computer. »Warst du gerade am Schreiben?«
»Ja.«
»Du schreibst am Sonntag?«
»Es ist wie zur Messe zu gehen.«
Er lächelte. »Das hier ist also das Abendmahl.«
»So ähnlich.«
»Was schreibst du?«
»Ein Gedicht.«
»Worüber?«
»Über das, was in Juárez passiert.«
»Warum ausgerechnet darüber?«
»Juárez lässt mich einfach nicht los.«
»Wieso?«
»Weil es ein Teil von mir ist.«
»Du lebst nicht dort.«
»Wir leben alle in einer Stadt, Javier.«
»Das ist Blödsinn, Carlos.« Ich mochte den Zorn, der in seiner Stimme mitschwang. »Spielt die verdammte Grenze für dich keine Rolle?«
Es gab so manches, was ich hätte sagen können, was ich gern gesagt hätte, aber die Grenze war nun einmal da und wir lebten auf verschiedenen Seiten davon. Was nützten schon utopische Ideologien über grenzenlose Welten von einem Verfasser politischer Gedichte? Was nützte ein Streit mit einem schönen Mann?
Er lächelte. »Ich bin nicht auf dich wütend.«
»Das weiß ich.«
»Schreib nicht über Juárez. Schreib über etwas Schönes.«
»Das ist nicht meine Arbeit, Javier.«
»Ich weiß. Deine Bücher werden immer trauriger.«
»Dafür gibt es eine Menge Gründe.«
»Das ist seltsam. Weil du kein trauriger Mensch bist.«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Aber warum nicht?«
»Früher war ich traurig. Jetzt geht es mir besser.«
»Also bist du glücklich?«
»Im Moment schon.«
»Du bist kompliziert.«
»Erst war ich interessant und jetzt kompliziert?«
Er lachte. Dann legte er den Kopf auf meine Schulter. Und begann zu weinen.
»Er stirbt«, flüsterte Javier. »Ich habe niemanden mehr.« Seine Tränen durchnässten mein Hemd. Ich wollte sie schmecken, in ihnen baden, von ihnen überschwemmt werden. »Er stirbt.« Das wiederholte er ein ums andere Mal.
Ich wusste nie, was ich sagen sollte, wenn jemand weinte. Besonders wenn es ein Mann war. Bevor mein Vater starb, hatte ich oft bei ihm gesessen und seinem Schluchzen gelauscht. Manchmal hatte ich dabei seine Hand gehalten. Ich liebte dieses Bild in meinem Kopf: wie ich die Hand meines Vaters hielt. Also tat ich genau das. Ich nahm Javiers Hand und hielt sie fest. Ich führte ihn zu meinem Schlafzimmer. »Du solltest schlafen«, sagte ich. »Du bist müde.«
Er legte sich aufs Bett. Ich zog ihm die Schuhe aus.
Er starrte auf das kleine Wandgemälde, das ich in einer Ecke begonnen hatte. »Sehr schön. Gefällt mir.«
»Ich bin noch nicht fertig.«
»Lass es so.«
»Es ist nur ein Himmel.«
»Es ist schön. Nur ein Himmel. Lass es so.« Er war müde und er flüsterte.
»Schlaf jetzt«, sagte ich.
Draußen war es kalt. Der Wind frischte auf und die Wolken ballten sich zusammen wie ein Schwarm lästiger Krähen. Ich hasste Krähen. Sie waren gemein und eigennützig und tanzten mit hämischer Freude herum, wenn sie eine Eidechse gefangen hatten. Ich trat auf den Balkon und atmete tief durch. Der Gedanke an eine Zigarette schoss mir durch den Kopf – aber ich wollte nicht zurück zu jenen Zeiten. Ich war nicht mehr der Jüngste. Ich hatte viele Fehler gemacht. Rauchen war der geringste davon. Kein Zurück.
Wieder drinnen beschloss ich, Kartoffelsuppe zu kochen. Ich schälte ein paar Kartoffeln, würfelte sie, würfelte auch ein paar Zwiebeln, warf alles in einen Topf, fügte Salz, Pfeffer, Knoblauch hinzu, hackte Koriander. Eine Armeleute-Suppe. Nicht dass ich arm war, aber die Suppe erinnerte mich an meine Mutter. Ich liebte sie. Und ihre Suppe.
Ich ging ins Schlafzimmer und betrachtete den schlafenden Javier. Er hatte einen schlechten Traum. Er zitterte und murmelte, aber ich konnte die Worte nicht verstehen. Ich setzte mich aufs Bett und legte ihm eine Hand auf die Brust. »Es ist nur ein Traum«, flüsterte ich. Er wachte auf, erschrocken. In seinen Augen sah ich einen Ausdruck von Angst. Und dann einen ganz anderen Ausdruck, den des Loslassens.
»Es ist okay«, sagte ich.
Ich legte mich zu ihm ins Bett. Er schmiegte sich an mich. Es wurde dunkel. So sehr ich den Winter mochte, war er mir auch verhasst. Ich fühlte Javiers Atem an meinem Hals, fühlte die Worte, die er flüsterte: »Erzähl mir etwas von dir, das ich noch nicht weiß.«
Also erzählte ich. Davon, dass meine beiden älteren Brüder bei einem Autounfall umgekommen waren, und dass sie zusammen sieben Kinder hinterlassen hatten. Sieben Kinder und zwei trauernde, untröstliche Frauen, die sie sehr geliebt hatten. Darüber, dass mein Vater jahrelang an Depressionen, hohem Blutdruck, Parkinson und Diabetes litt und dann einen Schlaganfall hatte, der zum Hirntod führte, und dass ich die Maschine abgestellt hatte, die ihn atmen ließ. Von der Frau, die ich geliebt, verletzt und verlassen hatte. Von dem Mann, der mich geliebt hatte und dessen Liebe zu erwidern ich nie mutig genug war. Von einer jungen Frau, der ich in London begegnet war und die so blaue Augen hatte wie der Sommerhimmel, und dass ich mich in diesen Augen verloren hatte, als ich mir einbildete, ein Mann zu sein, wo ich doch nichts weiter war als ein dummer Junge. Von meiner Zeit als Helfer bei der Zwiebelernte, lange bevor ich alt genug war für einen richtigen Job, und wie ich davon geträumt hatte, mehr im Leben zu sein als ein Arbeiter mit krummem Buckel. Von der Narbe auf meiner Brust, wo mir, dem unbekümmerten Jungen, der ich war, der Stacheldraht die Haut aufgerissen hatte, als wäre sie nichts weiter als ein Fetzen Papier.
Ich merkte nicht einmal, dass ich weinte.
Aber ich spürte seine Hand auf meinem Gesicht. »Tränen schmecken wie das Meer. Wusstest du das?«
»Manchmal glaube ich, dass das Meer aus Tränen gemacht ist.«
Er legte mir einen Finger auf die Lippen. »Dein Leben ist besser als das, was deine Romane beschreiben.«
Ich nahm seine Hand, drehte sie nach innen, betrachtete sie. Ich richtete mich auf. »Meine Romane sind voll von schönen Männern. Männern, wie ich nie einer sein werde.«
»Du bist nicht traurig. Nur verletzt.«
»Wir sind alle schon mal verletzt worden.«
Dann zogen wir einander aus. Er fuhr mit einem Finger über meine Narbe und küsste sie. Ich betrachtete seinen vollkommenen Körper. Doch am meisten war ich in sein Gesicht verliebt, seine Augen, den Ausdruck von Verlangen, der über die banalen Begierden des Körpers hinausging. Ich führte ihn zur Dusche. Ich wusch ihm den Rücken, das Haar, die Füße, die Beine. »Jetzt lass mich«, sagte er. Das fiel mir schwer – mich von ihm waschen zu lassen. Mich von ihm berühren zu lassen. Aber ich ließ es zu.
8
Zu den Klängen von Miles Davis aßen wir Kartoffelsuppe und tranken Wein. Ich fragte mich, ob es so für uns weitergehen könnte. Für mich und ihn. Javier und Juan Carlos. Ich sah ihm beim Essen zu. Und fragte mich, ob ein Mann wie ich jemals den Hunger stillen könnte, der in ihm steckte.
»Eine gute Suppe«, sagte er.
»Nichts Kompliziertes.«
»Es braucht ein Leben lang, um etwas richtig hinzukriegen, das so einfach ist.«
»Das stimmt. Aber nur fürs Essen.«
Er fuhr mit der Hand durch mein Haar.
Ich nahm seine Hand und küsste sie. »Was ist mit deiner Mutter passiert?«
»Woher weißt du, dass etwas mit ihr passiert ist?«
»Du hast gesagt, du hättest niemanden mehr.« Er wandte den Blick ab. »Sie wurde ermordet.«
»Wie?«
Javier goss sich noch ein Glas Wein ein. »Sie wurde ermordet. Ihre Leiche hat man nie gefunden. Sie war Sozialarbeiterin. Eine schöne Frau, meine Mutter. Hat mich mit siebzehn zur Welt gebracht. Eine junge, wilde Frau, unglaublich lebendig. Alle Männer haben sie angestarrt. Sie wurde politisch aktiv. Die Transvestiten haben sie dazu gebracht, glaube ich. Nicht dass ich es ihr übel genommen hätte, dass sie sich so engagiert hat. Und dann, eines Tages, ist sie nicht mehr nach Hause gekommen. Sie ist einfach verschwunden.«
Das war der Ausdruck, den er hatte, der Ausdruck in seinem Gesicht: die Überbleibsel alter Verletzungen, die emotionale Narbe, das Wissen, dass alles Lachen der Welt jeden Moment von einem launischen Wind hinweggefegt werden konnte. Und dass er nichts dagegen zu tun vermochte.
Seine Augen blieben trocken. »Ich hab sie gesucht und gesucht und gesucht. Die Polizei unternahm nichts. Niemand hat irgendetwas unternommen. Wer war sie auch schon? Bloß noch so eine Frau, die in der Wüste verschwand, ihr Fleisch vom gottverdammten Sand verschluckt.«
Dann kamen seine Tränen, genau so, wie Unwetter in der Wüste losbrechen, Donner, Blitze, wütender, ungeheurer Regen, der sich fast wie ein Geschosshagel anfühlt. Ich hielt ihn fest, während er weinte, und fragte mich, warum die Welt so grausam war und gute, schöne, anständige Menschen wie Javier so wenig zählten, wo sie doch so viel zählen müssten.
»Es ist nicht wahr«, flüsterte ich, »dass du niemanden mehr hast.« Ich nahm sein Gesicht zwischen meine Hände.
»Hörst du mich, Javier?«
Und dann nahm ich ihn, liebte ihn. Und dann nahm er mich, liebte mich.
Niemand hatte je meinen Namen so geflüstert, wie er es tat. Mit dem Klang meines Namens im Ohr schlief ich ein.
Als ich aufwachte, war er schon angezogen. Der Abend brach herein. »Ich muss ins Krankenhaus«, sagte er.
»Ich fahr dich hin.«
»Nein. Nicht für das kurze Stück.«
»Es ist kalt«, sagte ich. »Du hast keine Jacke dabei.« Ich stand auf und ging zum Wandschrank. »Hier. Zieh dir das über.«
Er machte keine Einwände. Er nahm die Jacke, zog sie an und küsste mich. Dann war er fort.
9
Ich hätte ihn gern angerufen, ließ es aber bleiben. Das musste ich ihm überlassen. Wenn sein Onkel im Sterben lag, würde er seine Cousins auffordern, zu kommen und sich um das Notwendige zu kümmern. Bisher hatte er das getan. Er war so jemand. Es gibt solche, die nehmen, und solche, die geben, und er gehörte zu letzteren. Ich dachte an ihn, ich stellte mir vor, wie er am Bett seines Onkels saß.
Am Dienstagabend rief er an. Es war spät, schon fast Mitternacht. »Kommst du?«
»Bin gleich da«, sagte ich. Ich brauchte nicht lange, um mich anzuziehen und aus der Tür zu laufen. Das Krankenhaus war ganz in der Nähe. Ich ging hoch in den vierten Stock und fand das Zimmer. Javier, am Bett sitzend, hielt die Hand seines Onkels. Ich ging zu ihm hin und legte meine Hand auf seinen Rücken.
»Sie sind nicht gekommen«, flüsterte er. »Seine Söhne. Sie sind nicht gekommen.«
»Du bist sein Sohn«, sagte ich.
Wir saßen da und hörten, wie sein Onkel um Luft rang. Die letzten Atemzüge Sterbender sind laut und quälend. Der Körper will bis zum letzten Moment leben, kämpft um jeden Atemzug – und schert sich nicht um die Schmerzen.
Ich wusste, dass Javier bleiben würde, bis sein Onkel den letzten Atemzug tat. Ich blieb bei ihm. Das war alles, was ich tun konnte.
Javier hielt Wache, bis zum Ende. Als es still wurde im Zimmer, keuchte er, als hätte man ihm einen Messerstich versetzt. Er zitterte am ganzen Körper. So war der Kummer – ein Erdbeben im Herzen. Aber der Kummer war auch ein grausamer Dieb, der einem die Kontrolle über den eigenen Körper stahl.
Ich küsste Javier auf die Schulter – obwohl ich bezweifle, dass er meine Anwesenheit überhaupt wahrnahm. Dann ging ich die Krankenschwester holen. Ich nahm mir Zeit. Javier hatte ihn mehr als verdient, diesen Moment allein mit seinem Onkel, den er so offensichtlich liebte.
Er verließ das Zimmer nicht ein einziges Mal, bis die Leute vom Beerdigungsinstitut kamen, um die Leiche abzuholen. Mittlerweile ging die Sonne auf.
Ich brachte ihn zum Haus seines Onkels. Während der Fahrt wechselten wir kaum ein Wort. Als wir ankamen, machte ich die Tür auf und setzte Javier auf einen Stuhl, Javier, der vor Kummer und Erschöpfung wie betrunken war.
»Hier hat sonst immer er gesessen«, sagte er. Ich nickte. »Ein guter Platz«, sagte ich.
Ich sah mich in der Küche um und kochte Kaffee.
Javier kam mir hinterher und setzte sich an den Küchentisch.
»Ich glaube, ich will jetzt keinen Kaffee«, sagte er. Ich nickte. »Du solltest ein bisschen schlafen.«
»Ich will nicht hier bleiben«, sagte er. »Es ist zu traurig.«
»Such dir ein paar Sachen zusammen«, sagte ich. Er nickte.
Die Fahrt zu meiner Wohnung dauerte keine fünf Minuten, aber Javier schlief, als wir ankamen. Ich half ihm die Treppe hoch, weil sein schlaffer und erschöpfter Körper ihn kaum mehr zu tragen vermochte. Er fiel ins Bett, ohne sich auszuziehen. Ich zog ihm die Schuhe aus und ließ ihn schlafen.
Ich legte mich auf die Couch. Als ich erwachte, saß Javier mir gegenüber in meinem Lesesessel.
Er lächelte mich an.
»Wie spät ist es?«
»Drei Uhr nachmittags.«
»Wie lange sitzt du da schon?«
»Ich bin gerade aufgestanden. Und hab Kaffee aufgesetzt.« Ich nickte. »Den kann ich jetzt gebrauchen.«
Er zog mich von der Couch hoch und hielt mich fest.
»Ich muss ins Beerdigungsinstitut«, sagte er.
»Ich fahr dich hin.«
»Nein.«
»Dann nimm mein Auto.« Er nickte.
Wir gingen zusammen unter die Dusche.
Ich sah ihm beim Rasieren zu. Ich sah ihm beim Anziehen zu. Er war anmutig und elegant. Selbst die Trauer in seinem Gesicht faszinierte mich. Ich wusste nicht, wie ich dazu gekommen war, mich in ihn zu verlieben. Ich war nicht der Typ, der sich leicht verliebte. Einige meiner Freunde hatten mir zu verstehen gegeben, ich sei erschreckend selbstgenügsam. So hatte ich das nie gesehen, aber vielleicht war ja etwas dran. Doch als ich Javier jetzt beobachtete, wollte ich ihn mit aller Macht. Er sollte die Luft sein, die ich atmete.
Als er sich die Schuhe anzog, küsste ich ihn. »Es tut mir leid«, sagte ich. »Dass du ihn verloren hast.«
Er nickte. »Er war sehr krank. Es ist gut so«, sagte er.
»Manchmal ist der Tod etwas Gutes.«
»Manchmal schon. Trotzdem schmerzt es.«
»Der Schmerz gehört dazu, Carlos.«
»Und manchmal auch die Liebe«, sagte ich.
Ich sah den Ausdruck auf seinem Gesicht. In diesem Moment begriff ich, dass er mich liebte. Es war mir egal, dass ich diese Liebe nicht verdient hatte, dass ich sie nicht wert war. Ich begriff, dass ich diese Liebe nehmen und so lange wie möglich festhalten würde. Und mir kam der Gedanke, dass wir zusammen sein – dass wir vielleicht glücklich sein würden.
10
Die Trauerfeier fand in der Kathedrale statt, wo sein Onkel fünfzig Jahre lang die Messe besucht hatte. Dort hatte er seine Frau geheiratet, seine Kinder taufen lassen, in diesem heiligen Haus hatte er seinem Leben Maß und Rhythmus gegeben. Es spielte keine Rolle, dass Javier und ich nicht gläubig waren. Wie sollten wir an eine Kirche glauben, die nicht an uns glaubte – ob wir nun allein oder zusammen waren? Trotzdem gehörten die Kirche und ihre Rituale zu uns, waren ein Teil von uns. Unsere Körper – unsere Herzen – waren vertraut mit den mittelalterlichen Gesängen. In ihnen lag ein sonderbarer, ganz eigener Trost.
Die Söhne seines Onkels saßen neben Javier in der ersten Reihe. Es waren gestandene, erfolgreiche Männer, die in anderen Städten lebten. Sie hatten etwas Strenges an sich, waren aber zivilisiert und respektvoll. »Sie sind wie meine Tante«, sagte er. »Selbst wenn sie lieben, sind sie lieblos.« Da musste ich lächeln.
Es waren nicht viele Leute gekommen. Die meisten Gäste waren eigentlich keine Trauernden, sondern Freunde von Javier. Sie umarmten und trösteten ihn, und man konnte deutlich sehen, dass sie ihn sehr mochten.
Am Grab schluchzte Javier wie ein kleiner Junge, ohne sich der Tränen zu schämen.
Ich fühlte mein Herz für ihn schlagen, so wie vielleicht das Herz eines Gläubigen im Angesicht Gottes schlägt.
11
Javier und ich richteten uns in einer Art Routine ein. Er kam jeden Freitagabend nach der Arbeit zu mir. Wir gingen aus, schauten einen Film, hielten Händchen im dunklen Kinosaal, wir gingen essen, und wenn wir nach Hause kamen, liebten wir uns. Nach und nach fanden wir in den gemächlichen, gefühlvollen Rhythmus eines beinahe normalen Lebens. Samstags werkelten wir am Haus seines Onkels herum. Er hatte es geerbt, ohne Einwände von seinen Cousins – die weder das Geld brauchten noch irgendeinen Wert auf die Hinterlassenschaften ihres Vaters legten. Wir arbeiteten beide gern mit unseren Händen. Beide gehörten wir zu dieser Sorte Mann.
Sonntagvormittag nahm ich mir Zeit zum Schreiben, während er las. Nachmittags lasen wir uns abwechselnd die Lieblingspassagen aus unseren Lieblingsbüchern vor. Javiers Ansichten waren immer sehr durchdacht, aber er brachte sie mit solcher Heftigkeit vor, dass ich regelmäßig lächeln musste. Mit der Zeit begriff er, was mein Lächeln bedeutete, obwohl er anfangs geglaubt hatte, ich sei einfach gönnerhaft.
»Was bedeutet dieses Lächeln?«
»Nichts. Ich lächle. Ich höre dir zu und lächle.«
»Weil meine Gedanken nicht intelligent genug sind? Weil du sie amüsant findest?« Seine Stimme klang gereizt.
»Das bedeutet mein Lächeln nun gerade nicht.«
»Dann erklär es mir.«
»Nein.«
Aus irgendeinem Grund akzeptierte er das. Wir versuchten, etwas übereinander zu lernen, ohne zu viel zu erklären.
Einer wurde des anderen Lieblingsbuch. Beide waren wir verrückt danach, den anderen zu lesen.
Der Winter verzog sich, allerdings nicht kampflos. Er schien bleiben zu wollen, ergab sich aber schließlich dem Unabänderlichen. Veränderungen gehen mit Widerständen einher, sogar bei Jahreszeiten. Im Frühling wurde ich allmählich besessen von dem Roman, an dem ich arbeitete. Javier bekam zu lesen, was ich geschrieben hatte. Es gab nur eine Regel: keine Diskussion über den Roman.
Eines Sonntagabends im Juli, mitten in der heißesten Zeit, waren wir beide beim Lesen. Ich las Bolaño, er Kurzgeschichten von J. G. Ballard. Ich saß in meinem Lesesessel, Javier lag auf der Couch.
Ich legte mein Buch hin.
»Willst du nicht hierher ziehen, Javier?«
»Hierher?«
»Zu mir.«
»Willst du damit sagen, wir leben nicht zusammen?«
»Du lebst in Juárez. Komm hierher.«
»Ich habe keine Papiere. Das weißt du.«
»Wir können doch den Antrag stellen. Ein Visum hast du ja schon.«
»Nur zu Besuchszwecken. Dein Land möchte nicht, dass ich bleibe.«
»Werd nicht spitzfindig. Und was spielt es schon für eine Rolle, was dieses Land möchte?«
»Länder sind bedeutender als Menschen.«
»Scheiß auf die Länder. Ich hasse sie alle. Du bist das einzige Land, das ich will.«
Er antwortete nicht. Aber dann huschte ein Lächeln über sein Gesicht. »Du hast heute Morgen Zeitung gelesen, oder, Carlos?«
»Es wird immer schlimmer mit den Morden.«
»Ich bin in Sicherheit.«
»In Sicherheit?«
»Für mich reicht sie.«
»Zieh hierher.«
Er richtete sich auf und legte sein Buch beiseite. »Ich kann nicht weg aus Juárez.«
»Warum denn nicht?«
»Du weißt warum.«
»Nein, das weiß ich nicht.«
»Was würde passieren, wenn alle gehen?«
»Dann würde die Stadt sterben.«
»Genau, Carlos.«
»Aber wenn du stirbst?«
»Du solltest aufhören, Zeitung zu lesen.«
»Das kann ich nicht, Javier.«
»Mir passiert schon nichts. Wir können ewig so weiterleben.«
»Dann ziehe ich nach Juárez.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Du gehörst hierher.«
»Ich gehöre zu dir.«
Er lächelte. »Das hast du noch nie gesagt.«
»Ich kann dir jeden Tag sagen, dass ich dich liebe. Jeden Tag meines Lebens. Und es ist wahr.«
»Du musst mir nichts sagen, was ich sowieso schon weiß.«
»Dann ziehe ich nach Juárez.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Was ist, wenn dir irgendwas passiert?«
»Was soll denn passieren?«
»Du weißt, wovon ich rede.«
»Und du weißt, wovon ich rede.«
Zu guter Letzt brüllten wir uns an. Er hatte mich noch nie angebrüllt. Ich ihn auch nicht. Das einzige Mittel, diesen Streit zu beenden, war Sex. Hinterher im Bett flüsterte er: »Ich kann nicht über meinen Schatten springen, Carlos. Ich bin nun mal so.«
Ich war nicht seine einzige Liebe und würde es auch nie sein. Vielleicht liebte er Juárez mehr als mich. Aber in Bezug auf mich hatte er recht gehabt. Ich war kein eifersüchtiger Typ. Er konnte sein Juárez lieben. Und er konnte auch mich lieben. So würde es sein.
»Wir können ewig so leben«, sagte ich. Dabei hatte ich so viel Glück gar nicht verdient.