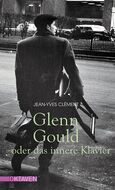Kitabı oku: «Spieltage», sayfa 2
Die Wohnung hatte drei Räume: das Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Nur das Bad ging zum Innenhof. Unter der Decke hatte es ein Fenster, das vermutlich allein dazu da war, bei Bedarf etwas Luft hereinzulassen, aber ich war groß genug, um auch hinaussehen zu können. Die Lichter der Wohnanlage strahlten in unregelmäßigen Quadraten. Am nächsten Morgen konnte ich dann die äußere Form dieser Muster erkennen. Die Gebäude waren alle identisch und in kräftigen, leicht unterschiedlichen Farben gestrichen; außerdem standen sie in einem seltsamen Winkel zueinander. An diesem Abend sah ich allerdings nur ein paar erleuchtete Fenster, und ich betrachtete sie mit dem guten Gefühl, an einem Ort angekommen zu sein, an dem andere Leute bereits (unerklärlicherweise) zu Hause waren.
Nach einer Weile verwandelte sich das Leuchten im nächstgelegenen Fenster zu verschwommenen Umrissen, und aus diesen Umrissen wurde ein Kopf, ein Arm, ein Kleid. Ich merkte, dass ich eine Frau mit langen Haaren betrachtete. Sie bürstete ihr Haar auf eine Art und Weise, die mich vermuten ließ – ich habe drei Schwestern –, hier eines der letzten stillen Rituale mitzuverfolgen, die ein Mädchen vor dem Zubettgehen praktiziert. Ich hatte geradezu Heimweh nach ihr, konnte mich nicht von ihr losreißen. Aber jemand oder etwas rief sie in ein anderes Zimmer, und ich starrte mit klopfendem Herzen weiter auf die leere Stelle, die sie zurückließ (nur eine von Vorhängen eingerahmte Wand), bis ich mit dem Gefühl einer erneuten Einsamkeit das Badezimmerlicht ausmachte und wieder ins Bett kroch.
4
Der Typ, der mich am Flughafen in Empfang genommen hatte, wollte im Auto wissen, warum ich «zum Basketballspielen so weit gereist» sei. Als ob er sich darüber auch schon den Kopf zerbrochen hätte. «War nur so ’ne Schnapsidee», sagte ich, und so kam es mir an diesem windigen, sonnigen Morgen beim Aufwachen auch tatsächlich vor. Es war schon so warm, dass ich auf dem Weg zur Halle ins Schwitzen geriet. Ich ging unter der stillgelegten Brücke durch und sah auf der anderen Seite ein paar Geschäfte, einen Zeitungskiosk, eine Bäckerei und eine kleine Kneipe namens Einhorn. Ein Mann im Overall stand an der Kellerluke und rollte Bierfässer nach unten. Die Dunkelheit der Kneipe war mit grünen Staubflecken durchsetzt; eine Frau mit Schürze nahm die umgedrehten Stühle von den Tischen. Anständige Arbeit, dachte ich, und ging weiter Richtung Fluss.
Er führte, wenn man ihm weit genug folgte, in südwestlicher Richtung nach München, die Stadt, die meine Vorfahren vor fast hundert Jahren verlassen hatten. Das Sportzentrum befand sich auf der anderen Seite, ein flacher, überdimensionierter Funktionsbau, wie ihn Stadtverwaltungen errichten. Zwei große Säulen flankierten den Haupteingang. Sonst deutete nichts auf die Erhabenheit der Wettkämpfe hin, die im Inneren stattgefunden hatten. Aufgeregt war ich nicht zuletzt (und darauf will ich hier hinaus), weil ich gleich herausfinden würde, ob ich auch wirklich gut genug war. Basketball ist natürlich ein Mannschaftssport, aber letztendlich beruht er auf dem einsamen Kampf, durch den man ihn erlernt hat: allein, auf dem Court meines Vaters, in heftigem Regen oder der noch heftigeren Hitze von eintausend texanischen Nachmittagen. Es kam mir vor, als müsste ich jetzt das Vorgestellte am wirklichen Leben messen.
Ein übergewichtiger junger Mann mit breiten Nasenlöchern wies mir den Weg zur Umkleide. Jeder, der schon mal in einer Mannschaft gespielt hat, kennt die Szenerie: dieser besondere Geruch, das kalte, intensive, schattenlose Licht, die Anti-Rutsch-Matten auf den Bodenfliesen und die abgenutzten Holzbänke. Es müffelt nach feuchtem Nylon und Fußpilz, man spürt so etwas wie Frontkameradschaft.
Der junge Darmstadt war schon umgezogen, als ich ankam, und suchte fieberhaft nach Basketbällen; er wollte, dass jemand mit ihm spielte. Aus einer Tasche am Boden quollen Trainingstrikots. Ich nahm eine kurze Hose und ein Oberteil und zog sie schweigend an: zum ersten Mal schlüpfte ich in die Rolle des Profisportlers. Olaf war auch schon da und sagte Darmstadt, er solle seinem eigenen Schweif nachjagen oder etwas in der Art – und ihn in Ruhe lassen. Manche von uns sind noch gar nicht richtig wach, sagte er und sah mich teilnahmsvoll an.
Ich ging los, um das Spielfeld zu suchen, und musste in den unbeleuchteten Gängen mehrmals kehrtmachen. Die Halle selbst war groß und schummrig und sah aus wie ein Flugzeug-Hangar. Der Boden war grün, Licht spiegelte sich ganz schwach darauf, was dem Platz eine beinahe unterirdische Düsterkeit verlieh. Jemand hatte die Basketbälle entdeckt, und das Echo des Aufpralls hallte von den hohen Aluminiumstreben zurück. Milo übte Jumpshots: werfen, einem Fehltreffer nachjagen, abrupt stehen bleiben, erneut werfen. Sein Atem war bereits deutlich zu hören.
«Young man», rief mir jemand zu, «young man.» Charlie wollte ein Eins-gegen-Eins; er warf mir den Ball außerhalb der Dreierlinie zu und nahm eine Verteidigungshaltung ein. «Dann lass mal sehen, was du draufhast», sagte er.
Ich fing entspannt an zu dribbeln, die ballabgewandte Seite zu ihm gedreht. Ich war nicht sicher, wie ernst ich das nehmen sollte, aber er bückte sich und grabschte nach dem Ball, doch seine Handflächen schlugen auf den Boden.
Charlie nahm mich als Rechtshänder, was mir im Grunde auch lieber ist. Die meisten rechtshändigen Spieler sind Linksfüßler – so halten sie beim Springen die Balance. Ich bin da eine Ausnahme. Nach der Schule hatte ich immer stundenlang geübt, an imaginären Gegenspielern vorbeizudribbeln und zu werfen. Ein innerer Kritiker beurteilte mich dabei: war ich schnell genug etc. Aber der eigentliche Punkt war, dass ich mir dabei die Ticks und Marotten eines Autodidakten zulegte. Außerdem noch die eine oder andere falsche Schreibweise, also das sportliche Äquivalent dazu. Jedenfalls ziehe ich gern mit links, deshalb wechselte ich vor ihm die Seite, hielt beim Hochspringen des Balls inne und ging an ihm vorbei.
«Mach das noch mal», sagte er, nachdem der Ball im Korb gelandet war. «Und noch mal», meinte er, als ich den Move wiederholt hatte. Diesmal drehte ich mich aber aus dem Dribbellauf und versenkte einen Fünfmeterwurf, während er noch versuchte, mich einzuholen. Schon ganz außer Atem, die Augen gegen den Schweiß zusammengekniffen, hörte ich mein Herz in den Ohren trommeln. Das war der Rhythmus zu einem stillen Refrain der Selbstbeglückwünschung: du kannst das, du kannst das. «Young man», sagte Charlie und rieb sich die Hände, «jetzt kommen wir langsam zur Sache» – aber Herr Henkel blies in seine Trillerpfeife und rief uns in die Mitte des Spielfelds.
Was folgte, waren eineinhalb Stunden Routine-Übungen. Henkel war ein technikorientierter Trainer. Die Session war bis auf die Minute genau auf einem Klemmbrett notiert, das er mit dem Handgelenk an die Hüfte presste. Nicht dass er etwas gegen eine Abwechslung gehabt hätte. Nach der Hälfte des Trainings ließ er uns bei einer Runde Freiwürfe verschnaufen, nur wurde er nach ein paar müden Airballs sauer und drohte dem gesamten Team für jeden weiteren Fehltreffer Suicides an. Ein Suicide ist wie ein Hundert-Meter-Sprint auf dem Gefängnishof, immer hin und her, deshalb war die Halle erfüllt vom Quietschen überdehnter Sneaker und dem Klatschen von Händen, die auf den Boden schlugen.
Ich warf meine beiden daneben. Das Blut in meinem Kopf hatte begonnen, meinen Blick einzufärben wie eine Quetschung. Charlie warf ebenfalls einen daneben. Er hatte eine merkwürdige Wurftechnik, eine Korkenzieherdrehung, die irgendwo hinter seinem Kopf begann. Zwischen den Grundlinien war er auch nicht gerade der Schnellste (diese Ehre gebührte Milo, der das sehr ernst nahm), und ich fragte mich, ob Charlie wirklich der Mannschaftskapitän war. Um Viertel vor elf öffnete Henkel die Türen, und ein paar beleibte Männer in Krawatten und Freizeithosen strömten lächelnd herein, in der Hand Fotoapparate oder Notizbücher. Mittlerweile konnte ich fast nicht mehr aufrecht stehen.
Der Trainer teilte uns in Fünfergruppen ein. Olaf und ich spielten zusammen mit Plotzke und Darmstadt. Plotzke war ein richtiges Vieh, mit dickem Bauch und den hochgezogenen Schultern eines Buckligen: seine Stimme hingegen war sanft, fast schon weinerlich. Er studiere BWL, pausiere derzeit aber für ein Jahr, erklärte er mir in einer kleinen Unterbrechung. Das hier sei nur eine Art Urlaub, sagte er und lächelte mit hochrotem Kopf. Charlie hatte Karl an der Seite, außerdem Milo und eine lange Bohnenstange mit Bürstenschnitt namens Michel Krahm, der sich wie ein Insekt bewegte und den ganzen Tag noch nichts gesagt hatte. Dabei hatten die meisten von uns etwas gefunden, über das sie sich beschweren konnten.
Gern würde ich sagen, dass wir ihnen halbwegs gewachsen waren. Nur verstand ich jetzt, was Charlie beim gestrigen Mittagessen demonstriert hatte: warum ihn jeder seine Sprüche klopfen ließ. Er dribbelte hoch und wütend (obwohl er der kleinste Spieler auf dem Feld war) und schlug den Ball wie einen Gerichtshammer zu Boden, während er sich über das Feld bewegte. Dabei hatte er die ganze Zeit den Mund auf, schrie herum und sagte den anderen, was sie tun sollten. «Backdoor, backdoor», rief er irgendwann. Milo sah ihn verständnislos an, und Charlie warf einen Pass, der ihn voll im Gesicht erwischte, zog Richtung Korb, griff sich den wegspringenden Ball und versenkte ihn. «Gutes Zuspiel», sagte er dann und rannte zurück in seine Hälfte.
Später, nach einem langen Rebound, schickte Olaf mich auf einen Fast Break. Nur Charlie war zurückgelaufen. Ich hatte ihn ganz für mich allein, direkt an der Freiwurflinie, und spulte den Seitenwechsel ab, mit dem ich ihn vorher ausgetrickst hatte. Nur schnappte er sich diesmal den Ball so schnell, dass ich mich noch in die Bewegung beugte, als er schon längst wieder weg war. «Schön wär’s», rief er mir über die Schulter zu. «Aber nicht mit mir …»
Die eigentliche Offenbarung dieses Trainings war jedoch Karl. Ich weiß nicht, ob er schneller oder stärker war als wir, oder woran es sonst lag. Er schien sich in einer komplett anderen Dimension zu bewegen. Einmal wollte ich ihm den Weg versperren und sah ihn schon einen Moment später, als ich mich noch fragte, wohin er verschwunden war, hinter mir am Rand des Korbs hängen. «Look at the Kid!», rief Charlie. «Look at the Kid!»
Charlies Art, seine Teamkollegen zu loben, hatte etwas Großkotziges, aber der Spitzname blieb haften. Sogar die Lokalzeitungen übernahmen ihn. (Die Deutschen haben eine merkwürdige Vorliebe für englische Bezeichnungen.) Irgendwie überdeckte der Spitzname jedoch die Tatsache, dass Karl tatsächlich noch ein Kid war, ein siebzehnjähriger Junge, der nervös in die Rolle schlüpfte, die ihm sein Talent auferlegt hatte. Er hatte die Angewohnheit, sich bei den Jumpshots nach hinten zu lehnen, geradezu lachhaft bei einem Zwei-Meter-noch-was-Mann; versuchte zu viele Dreier und traf oft nur den vorderen Korbrand; schlief in der Abwehr und fuchtelte dann wild mit den Armen, um den Boden wiedergutzumachen, den seine Füße nicht gewonnen hatten.
Genau deshalb konnten wir sie auch fast besiegen. Karl ließ mich bis an die Dreierlinie vor, und ich konnte die Augen scharf stellen und einen Zweier versenken, bevor er überhaupt reagierte. Beim nächsten Mal zog Charlie ihn von mir ab (gewaltsam, mit beiden Händen) und bedrängte mich, kaum dass ich die Mittellinie überquert hatte. Ich kämpfte mich bis zu den Blocks vor und ging dann wieder leicht zurück. Olaf deckte mich an der Freiwurflinie, und ich drehte mich raus, fing den Pass und ging hoch, um zu werfen. Ich bin fünfzehn Zentimeter größer als Charlie, und er wusste, dass er meine Wurfhand nicht erreichen konnte. Stattdessen boxte er mir den Handballen in den Bauch. Der Ball senkte sich weit vor dem Korb, während ich ein Foul reklamierte. Der Trainer saugte an seiner Pfeife, pfiff aber nicht, und Charlie rief mir augenzwinkernd zu: «Ich dachte, das hier ist ein Sport für Männer.» Karl jagte da bereits über den Flügel nach vorne, und Charlie bekam von hinten den Outlet. Er faltete den Ball aufs Handgelenk wie eine Teppichrolle und schickte einen weiten Bogenpass über das Spielfeld, der Karl mitten im Lauf erreichte. Er dunkte ihn, ohne auch nur abzubremsen, und ließ sich von der Wucht seines Sprints wieder zurücktragen.
Das Spiel war aus. Fotoapparate blitzten, und am nächsten Tag konnte ich in der Zeitung seinen Gesichtsausdruck sehen. Ein barbarischer Aufschrei, würde ich sagen – außer dass seine Augen, die weit aufgerissen waren, eher besorgt als glücklich wirkten. Ich betrachtete das Foto (es gab noch eines, auf das ich gleich zu sprechen komme) am nächsten Morgen mehrere Minuten lang, während ich mein müdes und so gut wie appetitloses Frühstück einnahm. «Riesenschritte» lautete die Bildunterschrift, mir kam jedoch eine ganz andere in den Sinn, die seine Miene viel besser beschrieb: Stilles Gebrüll. Er imitierte die Stars, die er aus dem Fernsehen kannte, die meisten davon schwarz, hatte allerdings noch nicht gelernt, die Wut oder Freude zu empfinden, die sie angesichts ihrer Fähigkeiten verspürten und im Spiel zum Ausdruck brachten. Karl jubelte, weil man das irgendwie von ihm erwartete.
Die Zeitung hieß Bayrisches Bauernblatt. Auflage: zwanzigtausend. Ich war früh aufgestanden, um mir einen Liter Milch zu kaufen, und hatte sie in dem Laden am Fuß des Hügels mit eingepackt. Die meisten Meldungen drehten sich ums Wetter, die Preise für Viehfutter, das Landwirtschaftsministerium etc. Sie wurde hier in der Stadt gedruckt, mit einer altmodischen Presse, direkt in der Redaktion. Diese befand sich im zweiten Stock eines Bürgerhauses aus dem neunzehnten Jahrhundert, das gegenüber dem Theater am anderen Flussufer stand. Im Stockwerk darunter war der hiesige Lokalsender angesiedelt, der sich eine Reihe von Mitarbeitern mit der Zeitung teilte. Die beiden Fotos zierten die Titelseite. Nach dem Frühstück schnitt ich das zweite aus, um es nach Hause zu meinen Eltern zu schicken. Sie bewahrten es auf, steckten es in einen Rahmen und gaben es mir wieder, als ich ein paar Jahre später danach fragte. Ich betrachte das Foto gerade.
Mein jüngeres Ich sieht mich an – auf dem billigen, dünnen Papier zu nichts als einem Umriss verblasst. Ein Tropfen Milch, auf irgendjemandes Schuhe gekleckert, hat sich über die Jahre in ein zartes Violett verwandelt. Es ist ein Mannschaftsbild, zweireihig arrangiert. Die vorderen knien: Charlie Gold, Willi Darmstadt (grinsend wie der Schulbub, der er war), Milo Moritz und Herr Henkel. Die größeren Spieler in der hinteren Reihe stehen Arm in Arm; Karl hat seine Hand auf meiner Schulter. In einem Anflug von Vermessenheit liegt meine Handfläche auf Charlies Kopf, auf dem, was von seiner Lockenpracht noch übrig ist. «Spieltage» lautet die Bildunterschrift.
Die Fotoapparate sorgten für Ausgelassenheit, daran erinnere ich mich. Ich meine damit nicht nur das Bild an sich, sondern die Gegenwart der Fotografen. (Die Presse tauchte nie wieder bei einem Training auf.) Sie verwandelten die düstere Halle am Rand einer bayrischen Kleinstadt in einen Ort mit Bedeutung; sie machten uns zu Basketballspielern. Nur ein paar Zeilen Text haben die Rahmung des Fotos überlebt. Herr Henkel, steht da, hat eine Reihe junger Talente ins Team geholt, um den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Er sagt, Charlie Gold, der Star der letzten Saison, sei genau der Richtige, um sie zu Höchstleistungen anzutreiben. Das einzige Fragezeichen ist Hadnots Knie; ob er sich vor Saisonbeginn von seiner Operation erholt. Für den Fall der Fälle wurde ein junger Amerikaner verpflichtet, der ihn ersetzen kann …
5
Die Yoghurts waren eine Abteilung des örtlichen Sportvereins, und bei Weitem nicht die wichtigste. Ein paar der Eishockeyspieler, hieß es, verdienten im sechsstelligen Bereich. Wir dagegen teilten uns die Halle mit einem Dutzend anderer Sportarten und Kurse. Am Mittwochabend etwa fand vor unserem Training Aerobic für Über-Fünfzigjährige statt. Wenn die Glocke bimmelte, ging eine Gruppe grauhaariger Frauen in Gymnastikanzügen vom Feld, um es uns zu überlassen. Oft mussten wir erst noch die Turnmatten aufräumen, bevor wir loslegen konnten.
Herr Henkel hatte große Pläne und war der Überzeugung, sie durch harte Arbeit realisieren zu können. Er wollte zwei Trainingseinheiten pro Tag und bekam sie auch: von zehn bis zwölf am Vormittag und dann abends noch mal von acht bis zehn. Es gab viele Klagen über diese Abendsessions. Man wusste nicht, wann man essen sollte, und wenn wir dann nach Hause kamen, total kaputt und verschwitzt, waren wir meist auch zu aufgedreht zum Schlafen. Außerdem musste ich bis elf warten, bis ich duschen konnte, sonst hätte ich gleich wieder zu schwitzen begonnen. In der Regel schob ich mir danach nur noch einen kleinen Happen rein, meist irgendwas Kaltes, das vom Nachmittag übrig war.
Morgens war es nicht viel anders. So um sieben stopfte ich mir etwas Toast und eine Schüssel Flockenzeug in den Mund und versuchte danach, noch einmal die Augen zuzumachen, bevor ich zur Halle ging. Am merkwürdigsten waren die langen, nutzlosen Nachmittage, die sich von zwölf bis acht erstreckten und nichts anderes zuließen, als dass man Hunger bekam. Ich nahm im ersten Monat fünf Kilo ab. Alles, was ich machen konnte, alles, was ich machen wollte, morgens, mittags oder wenn ich mit ausgedörrter Kehle mitten in der Nacht aufwachte, war trinken.
Andere Clubs trainierten oft nur drei Mal pro Woche. Sie hatten ein paar Vollzeitprofis; der Rest der Spieler organisierte andere Tätigkeiten um die Trainingseinheiten herum. Olaf war es, der mir eines Nachts in meiner Wohnung bei kaltem Brathuhn erzählte, dass Henkel für seine Mannschaft nicht viel hinlegen musste. Für sich selbst dagegen hatte er ein hohes Gehalt heraushandeln können, indem er dem Vereinspräsidenten klarmachte, er werde auch mit mittelmäßigen Spielern Erfolg haben. Olaf sah mich an, als wollte er sagen: Nimm mir das nicht krumm. Erst da verstand ich, was er meinte – ich war einer der Spieler, die billig eingekauft worden waren.
Wir saßen in meiner Küche, die keine Vorhänge hatte. Die dunkle Landschaft draußen ließ die einsame Lampe in den Fensterscheiben erstrahlen. Dicke Pferdebremsen aus den Ställen auf der anderen Straßenseite landeten auf dem Backblech; ab und an verscheuchten wir sie mit der Hand. Olaf war ein Nörgler – das fand ich charmant. Trotz seiner immensen Gemütsruhe; trotz seiner offenbar reichhaltigen körperlichen Vorzüge. Was mir gefiel, war seine Art, ohne viel Nachdruck mit der Welt unzufrieden zu sein. Er fand immer etwas, an dem er herummeckern konnte, ließ sich aber nie davon stressen.
«Ist mir egal, wenn sie knapp bei Kasse sind», sagte er, «aber Henkel sollte nicht damit angeben.» Henkel habe die Besitzerin, eine ältere Dame namens Frau Kolwitz, gefragt, was sie lieber wolle: einen teuren Trainer oder teure Spieler. «Sie antwortet nicht. Er erklärt ihr: ‹Es gibt nur einen Trainer, aber zwölf Spieler. Ich an Ihrer Stelle würde den teuren Trainer einkaufen.›»
«Woher weißt du das?», fragte ich. Es war schon fast Mitternacht, und Olaf hatte sich noch einen Stuhl geholt, um die Füße draufzulegen.
«Weil er es mir erzählt hat! Genau das meine ich ja: Er ist ein Angeber. Er kann einfach nicht anders. Zweimal hat er mir die Story schon erzählt. Mir ist das egal, ist nicht meine Sache, aber wer muss dafür bezahlen? Also unterm Strich? Wir – zweimal täglich, und das im August. In der zweiten Liga des Deutschen Basketballbunds. So was hab ich echt noch nie gehört. Ich sag’s dir, die anderen in der Liga lachen sich kaputt. Die sind jetzt irgendwo am Strand mit ihren Freundinnen: so bereiten sich andere Mannschaften vor. Da muss man Hadnot bewundern. Der macht das clever, verletzt sich immer rechtzeitig zum Saisonende und kann dann den Sommer über pausieren. Henkel ist natürlich sauer deswegen, aber machen kann er letztendlich nichts. Er denkt, dass er dieses Jahr auf ihn verzichten kann, wegen Karl, aber das ist ein Fehler. Karl ist zu jung; ein großes Talent, ja, aber einfach zu jung. Und egal, wie viel wir im August auch rennen, egal wie fit wir werden – wir sind trotzdem nur durchschnittliche, preisgünstige Basketballspieler. Und er ist auch nicht gerade ein Supercoach.»
Olaf hatte allerbeste Laune. So zu reden, baut einen trotz allem irgendwie auf. Was er sagte, war: Auch wenn du nicht besonders gut bist, und sie dich wie einen Köter dressieren, weißt du wenigstens, was Sache ist.
Wobei mir persönlich die Lauferei gar nichts ausmachte. Sie ermüdete die Einsamkeit, die ansonsten meine Tage ausgefüllt hätte. Ich tat nichts außer rumliegen, essen, trinken, duschen und Basketball spielen. Für anderes hatte ich keine Zeit, und obwohl jeder Nachmittag zur freien Verfügung stand, war es nicht nur mein Puls, der langsamer wurde. Ich erwartete von den Tagen etwas weniger als früher. Und am Ende des Monats konnte ich dem Bus nachrennen und für mein Ticket bezahlen, als hätte ich an der Haltestelle gestanden. Ich fing sogar an, anders zu gehen. Ich bin so fit wie noch nie, sagte ich eines Morgens vor dem Training zu Herrn Henkel, aber ich komm fast nicht aus dem Bett, ich kann fast nicht zur Halle gehen. Ja, erwiderte er (er hatte mich verstanden), aber du könntest in einer Minute zur Halle laufen – ist es das, was du meinst? Es ist wunderbar zu wissen, was der eigene Körper vermag. Speziell wenn man jung ist, bevor sich dann alles in Fett verwandelt.
Trotz der Dinge, die Olaf erzählt hatte, gefiel mir Henkel immer besser. Er war etwa so groß wie mein Vater, also rund einen Kopf kleiner als ich, und sein buschiger Schnurrbart erinnerte mich an meine Kindheit – an die Freunde meines Vaters, die am Beginn ihres Familienlebens standen. Ich sah sie immer beim Mitarbeiterpicknick, wo sie Frisbee spielten, oder auf dem Fußballplatz beim Sonntagskick der Jura-Fakultät. Sie rochen nach Aftershave und Schweiß.
Sie gehörten einer anderen Generation an. Ein Kollege meines Vaters, der zufällig auch in der gleichen Fraternity war, hatte ein Basketball-Stipendium an der Cornell University erhalten; in seinem dritten Jahr dort, 1958, erreichte er mit seinem Team das Halbfinale des National Invitation Tournament. Früher habe ich öfters mal gegen ihn gespielt: ein jüdischer Mittelschichts-Typ mit flinken Händen und scharfem Verstand. Jemand wie er würde es heute nicht einmal in ein Highschool-Team schaffen, und trotzdem waren es seine Erfolge, an denen ich mein eigenes Versagen maß, während mein Vater dem Mannschaftsbus durch Texas folgte, um mich auf der Bank sitzen zu sehen. Ich wollte, dass er mir jetzt zusah. Das konnte er natürlich nicht, aber Herr Henkel konnte es und tat es auch, noch dazu auf Profiniveau und mit Gleichgültigkeit auf persönlicher Ebene. Was ich mir von ihm erhoffte, war die Antwort auf die alte Frage: Was denken Sie? Bin ich gut genug?
Nach einer Woche teilte Henkel uns in zwei Mannschaften auf – für Technikdrills und Trainingsspiele. Team 1 und Team A nannte er uns, um seine Präferenz zu verschleiern, nur war die nicht sonderlich schwer zu erkennen. Team 1 bestand aus Karl, Charlie, Olaf, Plotzke und Milo und trug die blauen Trikots, die zu unserer offiziellen Uniform passten.
Milo, der dicklippige Kroate, war die Wahl, die mich schmerzte. In der ersten Woche hatte ich ein paar Mal mit Charlie und Karl gespielt, während Milo bei den Ersatzleuten auf der Drei agierte. Manchmal bewachten wir uns gegenseitig. Eines Abends ging Henkel mit uns die Offensivstrategien durch und Milo hatte den Basketball auf dem Flügel. Ich bedrängte ihn mit vorgestrecktem Bauch und drückte den Unterarm gegen seine Brust. Er hielt den Ball mit beiden Händen an der Hüfte und hob ihn ruckartig hoch, dann schwang er die Ellbogen nach oben und erwischte mich am Kinn.
«Ganz ruhig», sagte er, als ich blind nach hinten taumelte. Er sprach immer mit der entspannten, wachsamen Zuversicht eines Schlägers an der Straßenecke. «Der Coach hat uns nur die Positionen gezeigt. Lass mir ein bisschen Platz.»
Dann absolvierten wir den Spielzug, und Milo bekam innerhalb der Dreierlinie den Ball, stieg sofort hoch und traf. Henkel rief mich zu sich. «Wir proben hier für den Ernstfall», schnauzte er, «und du bist zu dämlich oder zu langsam, um in den Mann reinzugehen?»
Milo sagte nichts, und am nächsten Tag nahm Henkel ihn in die erste Mannschaft. Nach einer Weile gewöhnten wir uns an unsere Aufgaben; meine bestand darin, auf Karl aufzupassen. Henkel hielt sich selbst für einen Exzentriker, einen Innovator. Er wollte dem Kid, zwei Meter dreizehn groß und rund hundertzwanzig Kilo schwer, beibringen, wie man im Backcourt spielt, weshalb er in meiner Verantwortung lag. Karl hat Henkel eine Menge zu verdanken. Wenn er dazu beigetragen hat, die Rolle der Big Men im modernen Basketball zu verändern, dann war es Henkel, sein erster professioneller Trainer, der ihm dabei half, sie überhaupt zu definieren.
Karl war aber ein Problem, und das keineswegs nur für mich. Henkel wollte seine Spitzenspieler in ein und derselben Mannschaft, damit sie ein Gespür füreinander entwickelten, aber sie waren so viel besser als wir anderen, dass die Trainingsspiele kaum echten Wettkampfcharakter hatten. Manchmal gab er uns Karl oder Charlie für einen Abend und schickte dafür Darmstadt oder mich ins erste Team. Aber Darmstadt war noch ein Kind, ein richtiges Kind, ein Schüler mit seidigem Oberlippenflaum und Armen so dünn wie Spaghetti. Er konnte keinen Angriff laufen, was den Sinn der Übung zunichtemachte; und wenn Karl, gegen den niemand eine Chance hatte, die Seiten wechselte, brachte das zwar eine knappere Punktedifferenz, aber wenig Fortschritt. Die Wahrheit war – und Henkel begann sich das einzugestehen –, dass er für seine Spieler zu wenig ausgegeben hatte. Es ist die Aufgabe der Ersatzbankwärmer, der Nummern sieben, acht oder neun des Kaders, im Training Druck zu machen, auch wenn sie im Spiel dann gar nicht eingewechselt werden. Genau das war mein Job, nur erfüllte ich ihn nicht.
Das war nicht mein erster Kontakt mit dem Versagen, dennoch hat mich dieser erste Monat definitiv geprägt. Ich spüre das bis heute. Okay, wir alle ahnten, dass Karl eine andere Hausnummer war, dass er wohl früher oder später berühmt werden würde. Aber damals war er es noch nicht, und immer wenn er gegen mich einen Rebound ergatterte oder mir den Ball wegschnappte oder lässig einen Jumpshot über meine weit nach oben gestreckte Hand schickte, schien er für alle siebzehnjährigen Jungs der Welt zu stehen, die mich ebenfalls nass machen konnten. Es war reiner Zufall gewesen, dass ich in Karls Heimatstadt gelandet war. Aber, dachte ich, in Deutschland gab es vermutlich noch hundert andere Städte, in denen mich der Star des örtlichen Gymnasiums genauso abziehen würde.
Relativität ist einer der Negativaspekte in den unteren Ligen. Wenn du verlierst, ist es nicht nur der direkte Gegner, der dich schlägt, sondern dazu auch noch jede Mannschaft in den Ligen über dir.
Eines Tages führte uns Henkel nach dem Vormittagstraining hinaus auf den Fußballplatz, der von einer Sandbahn umgeben war. Nachts hatte es geregnet und der rote Sand blieb an unseren Schuhen kleben. Henkel teilte uns in Gruppen ein, und wir fingen an, Intervalle zu laufen, erst zwanzig Meter, dann immer mehr bis hin zu hundert, bevor die Distanzen wieder verkürzt wurden. Nachdem wir uns ein bisschen aufgewärmt hatten, schlug er vor, einen Wettkampf daraus zu machen, und stellte sich mit der Pfeife in der Hand ans Ende der Geraden.
Hundert Meter sind ganz schön weit; wie ein Sprint fühlen sie sich nur an, wenn man gewinnt. Ich wurde Fünfter: Karl, Charlie, Milo und Krahm, unser dürrer Ersatz-Power-Forward, hatten mindestens zehn Meter Vorsprung. Olaf hätte mich vermutlich auch geschlagen, wenn er nicht nach zwanzig Schritten schlappgemacht, sich an die Kniesehne gefasst und den Rest der Strecke mit einer grandiosen Darbietung von Schmerzen im Trab zurückgelegt hätte. Hinterher erklärte er mir, sie würden ihm nicht genug bezahlen, als dass er sich hier auf ein Pferderennen einlassen würde. Und genau wie ein Pferderennen fühlte es sich auch an. Basketball ist ein Mannschaftssport, und die feinen Nuancen des Spiels lassen einem genug Raum, die Schuld an dem, was passiert, auf andere zu schieben. Der Sprint bot diesen Raum nicht. Ich fühlte mich danach, als sei mein Körper gewogen und beurteilt worden. Wenn ich hoffte, mir in dieser Liga einen Namen zu machen, hätte ich dafür nur mindere Stärken zur Verfügung.
Aber es gab auch gute Tage, an denen meine Würfe ihr Ziel fanden und Karl zu faul war, mich anzugreifen und sie zu verhindern. Und ich hatte auch noch andere Dinge im Kopf. Manchmal ersparte ich mir das Jungs-Gefrotzel in der Kabine und duschte zu Hause, im Dunkeln den Kopf unter den Wasserstrahl gebeugt. Die Dunkelheit hielt die Blicke anderer Menschen von meinen Gedanken fern. Ich spürte, wie der Tag von mir abgespült wurde; ich schloss die Augen, um mich vor der aufsteigenden Hitze zu schützen. Danach schaute ich gern aus dem kleinen Fenster über dem Waschbecken, auf die Lichter der Wohnanlage – die Punkte in der Nacht bildeten und einem dieser raffinierten, ständig wechselnden Muster folgten, die sowohl menschlich als auch mathematisch zu sein scheinen. Aber in Wahrheit verbrachte ich die meiste Zeit damit, nur ein einziges Fenster zu beobachten. Das Fenster, in dem die langhaarige Frau gestanden hatte.
Immer gegen halb elf zeigte sie ihr Gesicht. Vermutlich war es ihr Schlafzimmerfenster, und sie sah vor dem Zubettgehen noch einmal kurz hinaus: auf den Pferdehof jenseits der Straße und die Felder, die hinter mir in die Dunkelheit der Landschaft abfielen. Vielleicht sah sie auch den einen oder anderen Stern. In Landshut wurde es nachts ziemlich dunkel. Die erleuchtete Quirligkeit Münchens reichte nicht bis hierher.