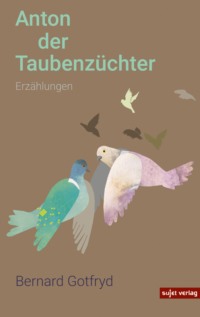Kitabı oku: «Anton der Taubenzüchter», sayfa 2
Ich wusste nicht, wo beginnen; ich hatte kaum erwartet, dass sie mich so etwas fragen würde. Tausend verschiedene Gedanken gingen mir durch den Sinn. Ich muss rot geworden sein; Annette bemerkte es, lächelte und wandte sich Onkel Herschel zu: „Dein Onkel erzählt mir, dass du dich immer noch von dem Hochzeitsbild her an uns erinnerst. Stimmt das? Erkennst du uns noch wieder? Sind wir noch dieselben Leute? Findest du, dass ich derselbe Mensch bin? Sag es mir, und sei ehrlich.“
„Ja“, sagte ich, „wenn du lächelst, bist du dieselbe.“ Meine Stimme zitterte, und ich war verlegen. Ich wollte sie nicht beleidigen, und ich war nicht sicher, es nicht doch getan zu haben. Mir wurde klar, dass ich nichts zu antworten wusste. Ich war nur ein Kind, das vom Lächeln einer Frau betört worden war und jetzt, elf Jahre später – mit der Realität konfrontiert –, zu kneifen versuchte. Ich fühlte mich schlecht. Die Realität wurde meiner Erinnerung nicht gerecht.
Sie begannen mir leid zu tun. Warum hatten sie sich scheiden lassen? Ohne darüber noch einmal nachzudenken, fragte ich: „Was hat es für einen Sinn, sich scheiden zu lassen? Ist es nicht einsam, ohne Gefährten – all diese Jahre?“ Sie waren verblüfft. Naturgemäß hatten sie von diesem jungen Mann nicht erwartet, dass er ihnen eine Predigt über Moral oder Unmoral einer Scheidung hielt, ganz zu schweigen davon, dass er ein Urteil über ihr Privatleben abgab. „Verzeiht mir“, sagte ich, „ich weiß, es ist nicht meine Angelegenheit, aber als ich euch so zusammen sah, da konnte ich nicht anders, weil ihr meine Verwandten seid und ich das Gefühl habe, euch fast mein ganzes Leben lang gekannt zu haben.“
Annette lachte. Ich konnte daraus erkennen, dass sie mein Reden nicht recht ernst nahm. „Du redest, als hättest du entsprechende Erfahrung als Mann, dabei kennst du doch das Verheiratet-Sein gar nicht. Ich nehme an, du weißt nicht, was es heißt, eine schlechte Ehe zu führen. Glücklich waren dein Onkel und ich nur am Anfang. Da hatten wir eine gute gemeinsame Zeit, abgesehen davon, dass wir es gar nicht richtig zu schätzen wussten. Ich muss zugeben, dass es zu viel Einmischung seitens einiger meiner Angehörigen gab. In dieser Hinsicht hatte dein Onkel triftige Gründe.“ Onkel Herschel saß da und nippte an seinem Getränk, ruhig, nachdenklich, seine Augen auf irgendetwas in weiter Ferne gerichtet.
Es war schon spät am Abend, und das Restaurant war fast leer; es wurde Zeit für uns zu gehen. Wir gingen also zurück, begleiteten Annette zu ihrem Haus. Sie wohnte bei ihrem alten, kranken Vater. Sie war in sehr guter Stimmung, und ich hatte das Gefühl, sie mochte mich. Unterwegs zeigten sie mir verschiedene Pariser Wahrzeichen; als wir die Champs Elysées überquerten, erblickte ich den Arc de Triomphe und weiter in der Ferne den Eiffelturm.
Es herrschte eine festliche Stimmung in der Stadt. Paris bereitete sich darauf vor, den Tag der Erstürmung der Bastille zu feiern, erklärte mir Annette. Ich hatte nur noch zwei weitere Tage, bevor ich wieder nach Deutschland fahren würde, in meine zeitweilige Heimat, wo ich für die US-Army arbeitete. So gingen wir lange nebeneinander her, und ich lauschte ihren Erinnerungen an die gute alte Zeit, die Zeit vor dem Krieg.
Als der Abend zu Ende ging, waren wir alle erschöpft. Als ich Annette den Abschiedskuss gab, dämmerte es mir, dass sie sich nicht so dramatisch verändert hatte, wie ich es zuerst glaubte. Ich sagte ihr, wie sehr es mir gefallen habe, sie wiederzusehen; und fragte sie, ob ich sie, falls sie keine Einwände habe, „Tante“ nennen dürfe? „Das fände ich sehr schön,“ antwortete sie. Ihr weiches, warmes Lächeln gab es tatsächlich immer noch.
Am nächsten Tag ging ich zu Onkel Herschel, um Abschied zu nehmen. In einem alten, staubigen Rahmen über der Anrichte in seiner Wohnung bemerkte ich einen Abzug des Hochzeitsbilds. Ich war sprachlos und starr vor Staunen. Das war es, was ich in Wirklichkeit wollte: das Bild. Ob mein Onkel mir auch einen Abzug davon besorgen könne, fragte ich. „Ich wüsste nicht, warum nicht,“ sagte er. „Ich verspreche dir, einen Abzug machen zu lassen und ihn dir zu schicken.“
Bald darauf emigrierte ich nach Amerika. Einige Jahre vergingen, doch das Bild kam nie, und es war mir peinlich, meinen Onkel daran zu erinnern. Ein paar Jahre später, in den frühen fünfziger Jahren, erhielt ich einen Brief von Onkel Herschel mit der Mitteilung, dass er und Annette wieder geheiratet hätten; im Umschlag fand ich ein neues Hochzeitsbild. Diesmal war das Bild ein bisschen kleiner, aber es war sepiagetönt wie das erste. Das Brautpaar sah ein wenig älter aus; zwar zeigte Onkel Herschels Gesicht immer noch seinen Blick in weite Ferne, aber Annettes Lächeln war nahezu identisch mit dem, an das ich mich von früheren Jahren her immer erinnert hatte.
Die Violine
Vor vielen Jahren – noch bevor ich sieben wurde – fand ich während eines Wochenendbesuchs bei meinem Großvater auf seinem Dachboden eine alte Violine. Sie lag in einem schön geformten hölzernen Kasten, der eine samtene Auskleidung besaß, die einmal grün gewesen sein musste, aber so verblichen war, dass sie fast farblos aussah. Neben der Violine lag, gehalten von zwei hölzernen Klammern, der Bogen. Etwas von seiner Bespannung war abgerissen, hing lose und bedeckte zum Teil den Violinenhals.
„Diese Violine wurde von Giuseppe Guarneri gefertigt“, erzählte mir mein Großvater, „dem besten italienischen Geigenbauer des achtzehnten Jahrhunderts. Es gibt sogar ein entsprechendes Zertifikat in der Violine. Sie ist nicht nur alt und selten, sondern auch sehr wertvoll,“ versicherte er mir. Mit gesenkter Stimme fügte er hinzu: „Wer auch immer in der Familie dereinst Geigenunterricht nimmt, soll die Guarneri eines Tages behalten dürfen.“
Ich war sehr in Versuchung. Großvater ließ mich sogar eine der Saiten des Instruments berühren, die einzige, die noch an ihrem Platz war. Die anderen drei waren gerissen. Die Saite gab einen traurigen Laut von sich, der anhielt, als rufe sie um Hilfe.
„Natürlich ist die Violine in schlechtem Zustand und muss repariert werden,“ sagte Großvater. „Eines Tages werde ich sie nach Warschau zu einem Spezialisten bringen, einem der besten, den ich kenne. Er wird sich ihrer annehmen, wie es ihr gebührt.“
Tagelang ging mir die Violine im Kopf herum; in meinen Träumen konnte ich manchmal den Klang ihrer einsamen Saite hören. Meine ältere Schwester hatte zwar ein paar Wochen lang Geigenstunden gehabt, aber es gefiel ihr nicht einmal ein kleines bisschen. Häufig beklagte sie sich über den Schmerz in ihren Handgelenken und über den steifen Hals, den sie bekam, weil man die Geige unterm Kinn hält. Schließlich gab sie die Stunden auf. Zu der Zeit entschied mein Vater, ich solle der nächste sein, der Geigenunterricht erhalte. Mit dem Versprechen meines Großvaters im Kopf stimmte ich bereitwillig zu. Ich fing den Unterricht auf einem Instrument halber Größe an und erkannte plötzlich zu meinem größten Missvergnügen, dass ich eine normalgroße Geige wie die Guarneri auf meines Großvaters Dachboden nicht beanspruchen konnte, solange ich nicht älter war und viel längere Arme hatte.
Mein Unterricht dauerte jahrelang. Immer wenn ich meinen Großvater besuchte, fragte ich nach der Reparatur der Guarneri und versicherte ihm, dass ich sehr bald die Eignung für ein Instrument in Normalgröße besäße. Es war schließlich mein sechstes Jahr Geigenunterricht. Manchmal brachte ich meine eigene Geige mit, um ihm zu zeigen, wie unannehmbar klein sie war. Er blieb dabei, mich zu vertrösten und mir die Guarneri für später zu versprechen.
Im Jahr 1938, ein Jahr bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, starb mein Großvater, und ein paar der Dinge von seinem Dachboden wurden mir übergeben – darunter die Violine. Da sie nun in meinem Besitz war, untersuchte ich sie genauer und betrachtete immer wieder ihr Signet. Ich war vierzehn und von der Guarneri magnetisch angezogen. Ich beschloss zu versuchen, sie selbst zu reparieren. Es gelang mir, die gerissenen Saiten zu ersetzen, ich brachte einen neuen Steg an, und ich rieb sie sogar mit Schellack ein, um ihren langverlorenen Glanz wiederherzustellen.
Als ich am Ende das schimmernde Instrument ausprobierte, entdeckte ich den reichsten, süßesten Ton, den ich je vernommen hatte. Ich war wie verzaubert von dem Klang; mir tat es nur leid, dass mein Großvater nicht mehr dabei sein konnte, um mich spielen zu hören.
Wir lebten unter der Nazibesatzung, und schon bald wurden verschiedene Dekrete erlassen, die besagten, dass private Musikinstrumente, Radios, aber auch etwa Pelzmäntel zu konfiszieren seien. Ich brachte es nicht übers Herz, den Nazis die Guarneri auszuliefern. Meinem Vater ging es genauso mit den Pelzmänteln der Familie, also packten wir zusammen mit meinem Onkel und einem vertrauenswürdigen polnischen Freund, Herrn Bolek, eine eiserne Truhe voll mit Pelzen, verstauten die Guarneri darunter, und es gelang uns, die Truhe im Hof hinter den verbretterten Kohlenverschlägen zu verstecken. In einer mondlosen Nacht wurde sie in einem Loch im Boden versenkt, das wir mit mehreren Lagen dicker Teerpappe ausgekleidet hatten. Es war Sperrstunde, und der Hof lag verlassen da, nur eine einzelne streunende Katze suchte nach einem Platz für die Nacht. Ich stand Schmiere und achtete auf jedes verdächtige Geräusch. Es war eine kalte, dunkle Nacht, und der dumpfe Klang der Erde, wie sie auf die Truhe aufschlug, erinnerte mich an die Beerdigung meines Großvaters. Mich fröstelte. Am nächsten Tag sprach ich mit Herrn Bolek über die Violine und gab mir Mühe, ihm einen Eindruck davon zu vermitteln, wieviel sie mir bedeutete. Er hörte einfach zu, und indem er mir den Arm um die Schultern legte, versicherte er mir: „Du wirst diese Violine eines Tages wieder spielen, glaub mir.“ Bald darauf musste ich den Nazibehörden meine eigene, plötzlich ebenfalls kostbare Geige übergeben. Ohne jedes Instrument hatte ich das Bedürfnis zu üben stärker als je zuvor. Das meiste von meiner Musik behielt ich im Gedächtnis und übte weiter durch Summen. Während meiner Zeit in den Nazilagern verlor ich die bewusste Erinnerung daran, jemals Geige gespielt zu haben, und dachte sehr selten an die Guarneri. Was mir im Sinn blieb, war der traurige Klang der einsamen Saite. Bisweilen stellte ich mir vor, irgendwo in meiner Vergangenheit, vor langer Zeit, eine Violine gehört zu haben. Erst nach dem Krieg hatte ich wieder die Gelegenheit, jemanden eine reale Violine spielen zu hören. Es erfüllte mich mit Sehnsucht und ließ mich an meine Guarneri in ihrem Grab denken.
Zwei Jahre nach Kriegsende emigrierte ich nach Amerika. Sogleich schrieb ich einen Brief an Herrn Bolek. Ein paar Monate später kam der Brief zurück, „Empfänger unbekannt“. Ich fürchtete, dass ihm etwas zugestoßen war, und schrieb einen zweiten Brief, diesmal an das polnische Rote Kreuz. Wieder kein Glück, sie konnten ihn nicht auffinden. Erst in den späten sechziger Jahren gelang es mir durch ein kleines Wunder, mit unserm alten Freund wieder Kontakt zu bekommen. Er teilte mir mit, dass er nach dem Krieg in eine andere Gegend Polens umgesiedelt worden sei und dass er beim Internationalen Roten Kreuz immer wieder nach uns gefragt habe, auch ohne Erfolg. Da er nun Rentner sei, habe es ihn wieder zurück in unsere Heimatstadt Radom gezogen. Überdies gab er mir zu verstehen, dass der Inhalt unserer Truhe gerettet, ja in seinem Besitz sei.
Ich gab ihm die Erlaubnis, Gebrauch von den Pelzen zu machen, bat ihn aber, wenn irgend möglich, den Versand der Violine nach den USA in die Wege zu leiten. Herr Bolek antwortete mir, dass die polnischen Behörden wegen des historischen Werts der Violine nicht gestatteten, sie aus dem Land zu lassen. Man habe sie als antik eingestuft, und wir benötigten daher im Grunde eine Ausnahmegenehmigung des Kultusministeriums, das eine solche aber verweigere. Er versuchte alles Mögliche, aber nichts hatte Erfolg. Ich besaß ja auch nichts, womit ich beweisen konnte, dass ich der rechtmäßige Eigentümer der Violine war; es gab keinerlei Papiere oder Kaufbelege. Das alles ärgerte mich unsäglich; meine Guarneri blieb eine Gefangene in Polen.
In Amerika kaufte ich mir eine gebrauchte Geige und fing für mich allein wieder zu üben an. Es war nicht dasselbe. Ich hatte die Fertigkeit verloren, die ich vor fünfundzwanzig Jahren einmal besaß, und das Instrument klang dürftig. Hinzu kamen der Verlust meines Koordinationsvermögens und der Umstand, dass mein linker Arm schnell taub wurde. Deshalb erwog ich, einen Auffrischungskurs zu besuchen, aber da ich mich als ziemlich fortgeschritten betrachtete und über vierzig war, war es mir doch peinlich, noch einmal ganz von vorn anzufangen. Wenn ich nur die Guarneri hätte, sagte ich mir ständig, dann würde sich mein Spiel bestimmt wieder verbessern. Vielleicht hatte mich auch die Enttäuschung darüber, dass ich sie verloren hatte, vergessen lassen, wie man Geige spielt, theoretisierte ich; und bald entschied ich mich, es ein für alle Mal aufzugeben. Die Guarneri blieb mir natürlich immer im Hinterkopf; ich glaubte daran, dass der Postbote sie mir eines Tages einfach zustellen werde.
Im Sommer 1983 wurde ich von dem Magazin, für das ich als Fotoreporter arbeitete, mit einem Auftrag nach Polen geschickt. Ich besuchte Radom und konnte Herrn Bolek ausfindig machen. Er war alt und es ging ihm nicht gut, er war fast blind und konnte mich kaum noch erkennen. Aber er hatte keine Schwierigkeiten, sich daran zu erinnern, was uns verband: die vergrabene Guarneri. Er legte seinen Arm um mich, und mit trauriger Stimme sagte er, wie leid es ihm tue, vom Schicksal meiner Eltern zu hören, und wie froh er sei, zu erfahren, dass die drei Kinder überlebt hatten.
Herrn Boleks Wohnung war klein und voller alter Möbel. Die Wände waren mit alten Fotografien, Bildern und Erinnerungen an ein vergangenes Zeitalter bedeckt. Neben seinem Stuhl stand ein kleiner Tisch mit einem Sortiment Medizinfläschchen und einer Untertasse voll Augentropfen.
„Es ist so schön, dich als Erwachsenen wiederzutreffen,“ sagte Herr Bolek. „Ich erinnere mich an dich, wie du noch ein kleiner Junge warst. Ich sah dich immer mit deinem Geigenkasten unterm Arm zur Musikstunde gehen. Deine Schule war ja von meiner Wohnung aus direkt um die Ecke. Aber die Schule ist nun weg, wie so viele andere Dinge auch.“
Für ein paar Sekunden schwieg Herr Bolek. „Viele Jahre lang waren dein Vater und ich gute Freunde,“ sagte er. „Wir hatten nie Streit und achteten einander immer. Jetzt ist es eine andere Welt; die Menschen sind anders, als wir früher waren. Aber was kann man da machen? – Lass mich dir nun etwas zeigen.“
Er ging hinüber zur Garderobe und zog den Geigenkasten hervor. Er stellte ihn auf den Tisch und machte sich feierlich daran, ihn zu öffnen. Die Violine war mit einem Schloss gesichert, was sie, wie ich wusste, vorher nicht war. Herr Bolek nahm sie heraus. Langsam und sorgfältig befreite er das Instrument von dem grünen Filzstoff, in den es eingepackt war. Ehrfürchtig sah ich ihm zu. Die Violine schimmerte wie ein auf Hochglanz polierter Edelstein. Alles war an seinem Platz; ich hätte kaum sagen können, dass dies dasselbe Instrument war. Herr Bolek hielt die Guarneri, wandte sich mir zu und berichtete mit zitternder Stimme: „All diese Jahre hindurch habe ich gespürt, du würdest eines Tages zurückkommen, um die Violine zu holen. Vor ein paar Jahren, nachdem ich in Rente gegangen war, beschloss ich zu lernen, wie man Geigen repariert; ich hatte den Plan, deine Guarneri zu reparieren. Ehe ich mich’s versah, war ich so davon erfüllt, dass ich anfing, auch die Geigen anderer Leute zu reparieren, bis meine Augen immer schwächer wurden und ich es aufgeben musste.“
Als er innehielt, zog er ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und wischte sich die Augen. Ich hatte den Eindruck, er weinte. „Ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen je lohnen kann, dass Sie die Violine für mich nicht nur gerettet, sondern auch noch repariert haben,“ platzte ich heraus, bewegt, wie ich war.
„Du schuldest mir überhaupt nichts, mein Freund,“ antwortete er. „Ich bin derjenige, der zu danken hat. Von dem Tag an, da ich diese Violine zum ersten Mal sah, hat sie mein Leben verändert. Sie gab mir ein Gefühl der Verantwortung, sie ließ mich Musik lieben, und sie gab mir den Anstoß, Geigenbauer zu werden. Sie wurde mir vertrauensvoll übergeben, und sie wurde ein wichtiges Bindeglied unserer Freundschaft. Es war fast so, wie für einen Menschen, einen Freund, zu sorgen. Ich wusste ja auch, wieviel sie dir, dem Musiker, bedeutete. Du siehst, für mich war sie auf vielerlei Weise von Nutzen. Nun musst du nur noch einen Weg finden, sie nach Amerika zu schaffen. Hier, sie ist deine,“ sagte er stolz lächelnd, als er mir die Guarneri aushändigte. Ich hielt sie an ihrem Hals und sah mein eigenes strahlendes Spiegelbild in ihrem polierten Korpus. Ich berührte die Saiten; die Violine ließ auch ungestimmt ihren klaren, schwingungsreichen Klang ertönen. Ich nahm den Bogen und fing an sie zu stimmen, obwohl ich nicht sicher war, ob ich mich noch erinnerte, wie es ging. Ich war sprachlos, meine Hände zitterten. Als ich fand, die Violine sei nun zufriedenstellend gestimmt, legte ich sie sacht wieder in den Kasten zurück. Gerührt von der Freundschaftsgeste, nahm ich Herrn Boleks Hand und schüttelte sie kräftig, bis ich auf seinem zerfurchten Gesicht einen gequälten Ausdruck bemerkte.
Es gebe keine Mittel und Wege – wurde mir mitgeteilt –, die Genehmigung des Kultusministers zur Ausfuhr der Violine zu erhalten; die Gesetze lauteten noch immer so. Ich entschied mich für das Risiko, meinen Schatz ungenehmigt mit außer Landes zu nehmen. Ich hatte zwar Halluzinationen, wegen Antiquitätenschmuggels verhaftet zu werden und nach so vielen Jahren in einem polnischen Gefängnis zu landen. Doch am nächsten Tag saß ich tatsächlich im Flugzeug nach Hause mit der Violine an meiner Seite. Niemand hatte irgendwelche Fragen; es war, als hätten sie den abgenutzten Kasten, den ich trug, überhaupt nicht bemerkt. Ich war in Hochstimmung. Nach zweiundvierzig Jahren war die Guarneri wieder frei.
Fast ein Jahr nachdem ich aus Polen mit meiner Guarneri zurück war, erhielt ich einen Brief von Herrn Bolek, geschrieben von seiner Tochter, Lucyna. Er wollte wissen, ob ich mit der Guarneri glücklich sei, und ob sie hoffentlich auch gut behandelt werde. Um nicht völlig ohne Geige zu sein, hatte er sich nun selber eine gebrauchte gekauft. „Seltsam“, schrieb Lucyna, „wie jemand so an einem Instrument hängen kann, als wäre es ein Mensch.“ Ihr Vater bewahre die Geige am selben Platz auf, an dem jahrelang die Guarneri ausgeharrt habe, in der Garderobe, und obwohl er sie nicht mehr erkennen könne, könne er sie noch halten und stimmen (wenn auch nicht sehr gut); manchmal versuche er, ein paar von den Liedern zu spielen, die er auf der Guarneri gespielt hatte. Gelegentlich beschwere er sich dann bei der Geige über ihren kümmerlichen Ton, den sie von sich gab; sein Kommentar sei dann immer, sie sei eben nicht mit der Guarneri zu vergleichen.
Der Füllfederhalter
Ich habe in meinem Leben schon alle Arten von Geschichten gehört, ein paar bizarre, ein paar traurige, ein paar voll zufälliger Zusammentreffen. Aber diejenige, die ich jetzt erzählen will, ist, wenn schon weder bizarr noch traurig, so doch ganz und gar unglaublich. Eine Geschichte um einen Füllfederhalter, so wahr je eine Geschichte gewesen ist.
Als ich acht Jahre alt war, in den frühen dreißiger Jahren, kam eines Abends Herr Ginzburg, ein Kindheitsfreund meines Vaters und glühender Zionist, zu uns zu Besuch, um vor seiner Auswanderung nach Palästina Abschied zu nehmen. Herr Ginzburg war vielleicht Ende dreißig, mittelgroß und hatte volles, dunkles und lockiges Haar. Er trug eine goldgeränderte Brille, die ihn sehr distinguiert aussehen ließ. Er war in Straßenanzug mit Krawatte gekleidet, und über seinem Arm hing ein Regenschirm. Er sah immer aus, als ob er gleich an Bord eines Schiffes gehen werde.
Herr Ginzburg saß mit meinen Eltern am Esszimmertisch, trank Tee und aß Apfelkuchen – eine vielgerühmte Spezialität meiner Mutter – und erzählte uns alles über Palästina. Der Hauptgrund, nach Palästina zu gehen, so erinnere ich mich ihn sagen zu hören, sei, dass man beim Aufbau des Landes helfen müsse, denn es gebe dort viel zu tun, vor allem Sümpfe trockenzulegen und das Land urbar zu machen. Ich konnte mir Herrn Ginzburg nicht vorstellen, wie er Sümpfe trockenlegte, weil er wie ein Geschäftsmann aussah, nicht wie ein Arbeiter. Wie dem auch sei, er redete eine Menge darüber, wie wichtig es sei, das Land zu bestellen, und darüber, dass Palästina eines Tages ein jüdischer Staat werde. Wir lauschten alle angestrengt und wagten nicht, ihn zu unterbrechen. Als er zum Ende gekommen war, sah er meinen Vater an und sagte: „Und wann hast du vor, Polen zu verlassen, Henoch?“
„Wenn die Kinder mit ihrer Schulausbildung fertig sind,“ antwortete mein Vater. Und damit war das Thema erledigt.
Als wir vom Tisch aufstanden, griff Herr Ginzburg in seine Brusttasche und zog einen goldverzierten schwarzen Füllfederhalter hervor. Indem er ihn meinem Vater reichte, sagte er: „Dieser Füller ist ein Geschenk für dich, Henoch, damit du nicht vergisst, mir zu schreiben.“ Ich bemerkte den erstaunten Blick meines Vaters. Er griff rasch in die Westentasche und zog eine alte Münze heraus, eine Nachbildung zwar, aber sie war sein Talisman, der an einer kurzen Schlüsselkette hing. „Und dies ist etwas, das dich an mich erinnern soll,“ erwiderte mein Vater sehr aufgewühlt. Herr Ginzburg nahm die Münze und studierte sie eingehend von Nahem. Dann sagte er: „Eine römische Münze. Wie symbolträchtig. Danke dir, Henoch, danke dir.“ Niemand von uns hätte gedacht, dass Vater sich je von seiner römischen Münze trennen würde.
Sie schüttelten sich die Hände und küssten sich auf beide Wangen. Es war komisch, erwachsene Männer sich gegenseitig küssen zu sehen. Herr Ginzburg muss ein sehr emotionaler Mensch gewesen sein, denn ich sah Tränen in seinen Augen. Er küsste die Hand meiner Mutter, und ich hörte ihn auf Hebräisch sagen: „L‘Shana Haba‘ah B‘Yerushalayim – nächstes Jahr in Jerusalem,“ und dann war er fort.
Sobald Herr Ginzburg gegangen war, zeigte Vater uns den Füller. „Seht euch diesen Füller an“, sagte er, „mit dieser Goldverzierung, und seht hier: HG, die Initialen von mir, Henoch Gotfryd, die ja die gleichen wie seine sind, Herschel Ginzburg. Welch ein Zufall. Und welche Großzügigkeit! Das ist doch was, oder? Es muss ein teures Stück sein. Ich hätte ihn nicht annehmen dürfen, aber wie hätte ich ablehnen können? Schließlich sind wir alte Freunde.“ Mein Vater stand am Tisch, hielt den Füller und bestaunte ihn immer noch. Ich durfte ihn berühren, aber das war auch schon alles, weder Ausprobieren noch gar Auseinandernehmen waren erlaubt. Es fehle darin ja noch Tinte, stellte Vater fest, aber die werde er so bald wie möglich besorgen. Er deponierte den Füller in der Schublade, in der er seine Papiere, Rechnungen und Rezepte aufbewahrte, sowie auch ein paar ausländische Münzen, die er schon gesammelt hatte, als er noch ein Kind war. Er schloss die Schublade ab und nahm den Schlüssel an sich. Gewöhnlich war die Schublade unverschlossen, es sei denn, etwas Wertvolles wurde hineingelegt.
Nach einer Weile vergaß jeder in der Familie den Füllfederhalter, nur ich nicht. Ich spürte, dass an ihm etwas Magisches war. Die bloße Tatsache, Tinte hineinfüllen und ihn auseinander- und wieder zusammenbauen zu können, faszinierte mich. Man konnte ihn nicht mit meinem Schulfüller vergleichen, einem Federhalter aus rohem Holz mit am Ende befestigter Metallfeder, auch nicht einmal mit dem sehr verbesserten meines älteren Bruders. Keiner war mit dem meines Vaters zu vergleichen. Allein schon die Goldprägung ließ ihn wie ein Kunstwerk aussehen.
Gelegentlich sah ich Vater zwar Briefe schreiben, doch nie benutzte er den Füller, nicht ein einziges Mal. Er nahm immer seinen alten, der ständig seine Finger färbte, den tropfenden mit dem altmodischen Tintenbehälter. „Vater, warum nimmst du nicht den Füller?“ fragte ich ihn einmal. „Er ist das Geschenk eines Freundes, und ich möchte ihn schonen. Leicht könnte man ihn beschädigen,“ antwortete er.
Eines Tages kaufte Vater die Tinte. Er zog die Pumpe aus dem Inneren des Füllers heraus, reinigte sie mit Wasser und Seife, spülte sie mehrmals wieder aus, spritzte das blau verfärbte Wasser in den Ausguss und befüllte sie am Ende mit der frischen grünen Tinte. Ich beobachtete, wie er den kleinen Hebel drückte, um die Luft herauszusaugen, damit die Pumpe die Tinte aufnehmen konnte. Mich nahm allein schon der Vorgang als solcher gefangen, wenn ich auch feststellte, wie einfach das Ganze war. „Jetzt“, sagte Vater, „ist der Füller voll mit Tinte.“ Er schlug sein Notizbuch auf, setzte die Füllfeder feierlich aufs Papier und schrieb in einer raschen Bewegung seinen Namen. Ich konnte das Quietschen der Spitze auf dem weichen Papier hören. Es zog mir bis in die Zähne.
Plötzlich drehte sich Vater zu mir um und sagte: „Gefällt es dir, wie er schreibt?“ „Natürlich gefällt es mir“, antwortete ich mit einer Grimasse, „kann ich es probieren?“ „Na klar“, sagte Vater, „sei aber sehr behutsam.“ Ich schrieb meinen Namen mehrere Male neben seinen. „Großartig“, rief ich begeistert, „ich wünschte, ich hätte so einen Füller.“
Vater sah mich an und sagte: „Derjenige von euch Brüdern, der eines Tages vielleicht aufs Gymnasium* geht, wird ihn bekommen.“ Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, wie viele Jahre das dauern würde. Ich war erst acht, und mein Bruder war schon fast vierzehn. Seine Chance, den Füller zu bekommen, war also viel größer als meine.
So wurde der Füller zum Gegenstand meiner Träume. Manchmal hielt ich auf meinem Nachhauseweg von der Schule am Schreibwarengeschäft an, um mir im Schaufenster Füller anzusehen, aber nie bekam ich einen wie den meines Vaters zu Gesicht. Als ich meinem Freund Saul vom Füller meines Vaters erzählte, hörte er zu, machte ein Gesicht wie immer, wenn ihm etwas nicht gefiel, und sagte: „Mein Vater besitzt auch einen, der ist ein Sammlerstück, und ich darf ihn soviel benutzen, wie ich will. Davon gibt es nur zehn auf der ganzen Welt.“
* Im amerikanischen Original bezeichnenderweise auf Deutsch erin-nerte Wörter und Passagen sind bei erstmaligem Erscheinen kursiv gesetzt (Anmerkung des Übersetzers).
Natürlich konnte ich damit nicht wetteifern, deshalb blieb ich stumm. Mir kamen jedoch Zweifel an Sauls Prahlerei. Ich hatte das Gefühl, er übertreibe etwas. Er besaß den Ruf, gewisse Dinge über die Maßen aufzublähen. Ich überlegte, wie ich meinen Vater womöglich überreden könnte, mir seinen Füller zum Gebrauch zu überlassen, damit ich mit Saul gleichzog. Ich beschloss, den richtigen Augenblick abzuwarten. Ich wartete und wartete, aber der richtige Moment kam nicht. Schließlich gab ich den ganzen Plan auf.
Einige Zeit später, als meine Eltern einmal für ein Wochenende fortfuhren, bemerkte ich, dass Vater vergessen hatte, die Schublade abzuschließen. Nachdem meine Geschwister schlafen gegangen waren, öffnete ich leise die Schublade und fand zu meiner Überraschung tatsächlich den Füller. Das Gefühl, ihn in meinen eigenen Händen zu halten, war unbeschreiblich; es war mehr, als ich aushalten konnte. Ich brach in Schweiß aus. Ich entnahm ihn der Schublade, schraubte die obere Hälfte ab, untersuchte den goldenen Bügel, die Goldverzierung und die Initialen HG zwischen zwei schmalen Ringen. Der Füller war geformt wie eine dünne Zigarre. Ja, ein Kunstwerk.
Aus meinem Notizbuch riss ich eine Seite heraus und fing an, meinen Namen zu schreiben, dann die Namen meiner Geschwister. Zuerst schien alles etwas unförmig, aber nach einer Weile trieb ich es so weit, zu versuchen, die Unterschrift meines Vaters nachzumachen, was ziemlich unleserlich und abstrus ausfiel. Wie ich so die Seite vollschrieb, stellte ich fest, dass die Art und Weise, wie der Füller funktionierte, nichts Ungewöhnliches an sich hatte. Vielleicht war die Federspitze weicher und biegsamer als die meines Schulfederhalters, und deshalb erzeugte sie eher so etwas wie eine kalligraphische Wirkung. Ich riss noch eine Seite heraus und übte mich in noch mehr Kalligraphie. Wie die aussehen sollte, davon hatte ich nur eine vage Vorstellung. Bald wurde ich müde und schläfrig. In der Hoffnung, Vater würde nichts herausbekommen, säuberte ich den Füller und deponierte ihn wieder in der Schublade, wie ich ihn vorgefunden hatte.
Es war fast Mitternacht und Vollmond. Außer dem Summen einer Fliege, die gegen die Fensterscheibe prallte, war es still im Haus. Durch das Schlafzimmerfenster konnte ich die angrenzenden Dächer sehen, mit einem Haufen seltsam anmutender schmaler Schornsteine, die von runden metallenen Helmen gekrönt waren, welche das Mondlicht schwach widerspiegelten.
Es hatte etwas Groteskes.
Ich fasste den Entschluss, die Seite mit meinen kalligraphischen Übungen aufzuheben, um sie meinem Freund Saul zu zeigen. Ich wollte mit ihm gerne quitt sein und ihm beweisen, dass auch ich meines Vaters Füller, wann ich nur wollte, benutzen durfte. Als ich ihm das Blatt brachte, war Saul mitnichten beeindruckt. „Das soll Schönschrift sein? Und mit einem Füller geschrieben?“ fragte er nach. „Es sieht aus, als hätte es ein Huhn hingekritzelt,“ sagte er.
Ich war gekränkt. Es hörte wohl nie auf: Sauls Bemühungen mussten immer erfolgreicher sein als meine, und ich konnte nicht verstehen, warum. Ich wünschte mir, mich an ihm auf die schlimmste Weise zu rächen und ihm zu beweisen, dass ich genauso gut war wie er.
Die Zeit verging, und die Gelegenheiten, den Füller zu benutzen, wurden weniger, besonders nachdem Vater es sich zur Gewohnheit machte, die Schublade doch immer abzuschließen. Ich durfte an das gute Stück einfach nicht mehr denken.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.