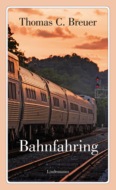Kitabı oku: «Die Tote in der Kraich»

Brigitte Springer
Die Tote
in der
Kraich
Ein Kraichgau-Krimi

Für meine Tochter Cornelia
und für Wolfgang Schönfeld
für seine unermüdliche Arbeit
über das Schicksal der Mitglieder der
jüdischen Gemeinde Flehingen.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen
sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Brigitte R. Springer, geboren 1969 in Bretten, aufgewachsen in Flehingen. Verheiratet, zwei Töchter. Beamtin. Sammelte Erfahrungen mit Wein und Weinbau in langjähriger Tätigkeit beim Weingut Lutz in Oberderdingen. 2008 erschien „Eine weihnachtliche Reise durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Südtirol“ (Möwig / Edel Verlag), 2010 Andrea Leuchtes erster Fall „Die Tote im Weinkeller“ (2. Auflage 2012) und 2011/12 Band 2 „Ein Mordsfest“. Der dritte Band erschien 2012 unter dem Titel „Eine Mordsjagd“.
Einige Akteure
Andrea Leuchte: Die schönen Künste haben es ihr seit geraumer Zeit angetan. Eigentlich möchten sie ja nur in aller Ruhe eine Vernissage veranstalten. Wäre da nicht ihr Talent, unbeabsichtigt in die Abgründe der Seelen ihrer Mitmenschen zu blicken. Ungewollt holt sie Vergangenes hervor.
Joachim Leuchte: Er darf wieder ganz offiziell buddeln (archäologische Ausgrabungen tätigen). Dabei macht er eine Entdeckung, die, sollte er sie publik machen, die Geschichte der Menschheit auf den Kopf stellen würde.
Komissar Blankenfels: Vorerst ist es einmal kein Mord, der ihn nach Flehingen führt. Ein Ort im schönen Kraichgau, der ihm, trotz der vielen Mordfälle in den letzten drei Jahren, ans Herz gewachsen ist. Hingebungsvoll gibt er sich auch dieses Mal den Genüssen, die Küche und Keller im Kraichgau zu bieten haben, hin. Doch dann holt ihn das Morden wieder ein.
Frau Braun: Andreas wissbegierige (neugierige) Nachbarin. Sie lässt sich auf ihre alten Tage noch auf das Wagnis einer neuen Liebe ein und beschließt ihren heiligen Witwenstand aufzugeben. Als Folge dessen, sieht sich Kommissar Blankenfels gezwungen, sich auch dienstlich für ihre neugewonnene Liebe zu hausgemachten Butterkeksen, die eine interessante pflanzliche Note haben, zu interessieren.
Herb Weingardner: Erbe jüdischer Emigranten aus Flehingen. Ein rätselhaftes Bild zwingt ihn, sich mit der Vergangenheit seiner Eltern auseinanderzusetzen.
Emma Fuchs: Andreas Freundin und die Gattin des Bürgermeisters. Eigentlich möchte sie nun nach der Geburt ihrer Tochter Clara ganz in der Mutterrolle aufgehen, wäre da nicht Andrea mit ihren Ermittlungen.
Thorsten Fuchs: Emmas frisch angetrauter Ehemann und Bürgermeister. Er hat es inzwischen akzeptiert, dass es Ereignisse in seinem Ort gibt, die er nicht versuchen sollte zu verstehen.
Erich: Seine Liebe zur Kunst, die in seinen Bildern weiterlebt und so manches tödliche Geheimnis mit sich bringt.
Schloss Flehingen: Schauplatz fast 700 Jahre wechselvoller Geschichte und Hüter so manchen Geheimnisses. Ohne ein (zu mindestens nicht bekanntes) Schlossgespenst.
Prolog
Langsam, aber unaufhaltsam züngelten sich die Flammen empor. Von einem Dunkelrot in ihrer Mitte bis zu einem giftigen, rauchigen Gelb an der Flammenspitze. Gierig, mit einem lauten Zischen, fraß sich das Feuer durch das bunte Treiben auf der Leinwand. Brannte schwarze Löcher in einen gemalten Traum aus Farben. Zerfraß Sehnsüchte und die damit verbundenen tiefen Gefühle. Die Arbeit. Die Kunst. Hinterließ ein schwarzes Häufchen Nichts, das der Wind als Spielball benutzte. Aufwirbelte und mit sich fortnahm.
1
Flehingen, Januar 1938. Zuerst rasch, dann wieder behutsam tänzelnd, einer Ballerina gleich, glitt der Pinsel über die Leinwand. Aus der Komposition aus Brauntönen entstand eine hügelige Wüstenlandschaft. Sanft umrahmt von schlanken, grünen Palmen. In der linken Ecke, eingerahmt von ockerfarbenen, golden in der Wüstensonne schimmernden Steinen, stand der über 2000 Jahre alte Grund für Freude, Frieden, aber auch für Krieg und Verfolgung.
„Glaubt ihr es ist wirklich eine gute Idee wenn Erich zusammen mit den anderen Zöglingen den Hintergrund für die Weihnachtskrippe in der St. Martins Kirche malt?“, fragte der Anstaltsaufseher Bausch beunruhigt.
„Wieso nicht? Der Junge hat Talent. Abgesehen davon ist es eine Auftragsarbeit an unsere Anstaltsmalerei“, erwiderte Direktor Tiedemann von der Anstalt für verwahrloste junge Männer in Flehingen. Er wusste, worauf sein Anstaltsaufseher Bausch hinaus wollte. Und das behagte ihm gar nicht.
„Das bringt uns aber bestimmt wieder Ärger mit der hiesigen Parteispitze einschließlich des Bürgermeister ein. Vielleicht wäre es besser, wenn er anstelle einer orientalischen Landschaft etwas anderes malen würde.“ Bausch steckte verlegen seine Hände in die Hosentaschen und blickte verlegen seinen Chef an.
Dieser schnaubte nur verächtlich: „Warum nennen sie es nicht beim Namen. Eine Bergszene mit blonden Hirten in einer Krachledernen, aus deren Hosentaschen am besten noch der arische Nachweis herausschaut.“ Tiedemann war kurz vorm Platzten.
„Sie wissen wie ich das meine“, versuchte Bausch zu beschwichtigen. Er hatte die NSDAP nicht gewählt. Doch leider hatten es andere getan und nun sah er kaum noch eine Möglichkeit, ihr Vordringen in den Alltag, in das Privatleben eines jeden Bürgers zu verhindern.
„Jesus war Jude. Daran können auch die Nazis nichts ändern. Bethlehem liegt nicht in Oberammergau. Wobei ich nichts gegen die Schnitzer dort sagen will, sie sind wahre Meister ihres Faches.“
Tiedemann holte tief Luft und stemmte dabei seine Hände in die Hüfte.
„Fakt ist, der Pfarrer will für die Krippe einen Hintergrund, der zur Kirche passt. Sie ist im Stil der Jerusalemer Grabkirche gebaut, also wird die Krippe orientalisch.“
Tiedemann betrachtet zufrieden das Bild, das immer realer wirkte. Die Landschaft begann vor seinem inneren Auge lebendig zu werden. Er spürte förmlich den heißen Wind, das Wogen der Palmen und das Blöken der Schafe nach Wasser.
„Ich möchte nur nicht, dass unser Bürgermeister Becker uns wieder anschwärzt. Wir wären unfähig, die Jungen im Sinne der Partei zu erziehen“, fing Bausch nochmals mit dem unliebsamen Thema an.
„Ich verstehe ihre Sorgen Bausch. Als Anstaltsleiter möchte ich mir auch nicht in meine Arbeit reinreden lassen. Erziehung ist Ansichtssache. Beim Sportfest nächste Woche kann er gerne die Fahne hissen und die Musikkapelle soll in Uniform antreten. Würde Sie das beruhigen? Am besten sie bestellen einen Fotografen, der alles festhält. Die Bilder werden wir dann brav nach Karlsruhe schicken.“
Tiedemann lächelte Bausch verschwörerisch an. Dieser atmete erleichtert auf. „Ansonsten bleibt alles beim Alten. Wenn dieser Becker meckert, dann erinnern Sie ihn an die gusseisernen Kerzenleuchter in der evangelischen Kirche, die wir anfertigen mussten. Sobald er die entfernt hat, darf er auch die Krippe entfernen“, erklärte Tiedemann stur.
Bausch schaute erst verdutzt, doch dann verstand er die Anspielung. „Und wenn ihn das nicht ruhigstellt, dann überlassen Sie ihn Schwester Salvatoris, sie wird ihm schon klar machen, dass sich die Partei aus solchen Dingen heraushalten soll.“ Damit war für Tiedemann die Unterhaltung beendet. Er wandte sich ganz dem Bild zu. Bausch nickte und dankte Gott still für die Erlenbader Schwestern hier in der Anstalt und ganz besonders für Schwester Salvatoris. Mit ihrer lieben, aber auch konsequenten Art schaffte sie es immer wieder, alles ins Lot zu bringen und den härtesten Jungen weich wie Butter werden zu lassen. Selbst Parteigenossen wie dieser braune Hund Becker hatten Manschetten vor ihr.
Derweilen malten die von Tiedemann für talentiert gehaltenen Jungen weiter. Für ihn war diese Tätigkeit neben harten Betten, das Arbeiten um das tägliche Brot in der Landwirtschaft, Sport und Musik ein wichtiger Eckstein in seiner Erziehungsmethode. Talent hatte seiner Meinung nach nichts mit Herkunft zu tun. Es war ein Gottesgeschenk, das es zu fördern galt. Väterlich legte er seine Hand auf die Schultern eines der Jungen. „Morgen fahre ich wieder nach Karlsruhe in die Kunsthalle, wenn du mit möchtest, Erich, nehme ich dich mit.“ Die Augen des Jugendlichen strahlten. Im Geiste sah Erich es schon vor sich. Die Gemälde, die Farben, die Formen. Den Duft nach Leinwand. Die Freiheit der Gedanken. Und vor allem die Möglichkeit, diese Gefühle durch die Malerei auch ausdrücken zu können.
2
Flehingen, 2. August 2016. Rinnsalen von Regenwasser gleich floss mir der Schweiß über die Stirn. Ich fühlte mit den jungen Männern, die hier vor mehr als hundert Jahren, mühsam Tag für Tag mit Hammer und Meißel die Kalksteine aus dem Steinbruch hatten hauen müssen. Und das, obwohl meine Werkzeuge im Vergleich zu Hammer und Meißel leicht wie eine Feder waren. Hochkonzentriert, vor meiner Feldstaffelei stehend, tauchte ich einen Pinsel in ein zartes Hellgrau. Rührte viel zu energisch mit den feinen Borsten des teuren Marderhaarpinsels in der Aquarellfarbe, klatschte ihn schwungvoll auf die Leinwand, um letztendlich schmerzlich aufzustöhnen.
„Das kann doch nicht so schwer sein“, seufzte ich und wischte mir den Schweiß von der Stirn. „Das kommt davon Andrea, wenn du dich auf ein Terrain begibst, auf dem du dich nicht auskennst“, beschimpfte ich mich selbst.
Doch aufgeben gab es für eine Andrea Leuchte nicht.
Umbarmherzig brannte die Augustsonne von einem strahlendblauen und wolkenlosen Himmel auf die kleine Gruppe von Menschen herab, die sich hinter ihren großen Staffeleien zu verbergen schienen. Ebenso verborgen lag in einer Kurve der alte Steinbruch an der ehemaligen Straße zwischen Flehingen und Gochsheim. Sträflingskurve nannte man die Biegung dieser Straße entlang des Kraichbaches, die am heutigen Tag zu einem Schauplatz künstlerischen Schaffens geworden war.
Skeptisch betrachtete ich mein neuestes Werk. Nun ja, dann ist es eben eine Komposition aus Grau mit verschiedenen Grüntönen unter einem knalligen Blau als Himmel. Expressionismus in Reinform. Es hat ja keiner gesagt, dass der Kraichgau nicht abstrakt dargestellt werden darf. Es lebe die Moderne. Niemand müsste erfahren, dass ich, Andrea Leuchte, bei dem Versuch die Landschaft 1 : 1 wiederzugeben gescheitert war. Sollte man mich negativ auf mein Werk ansprechen, würde ich demjenigen auf die Vielfalt der künstlerischen Arbeit hinweisen und dass gerade mir als Organisatorin „Unser Kraichgau im Bild“ es wichtig sei alle Aspekte des künstlerischen Schaffens darzustellen. Mit dieser Ausrede zufrieden, tauchte ich meinen allerfeinsten Marderhaarpinsel in ein dunkles Grau, biss mir konzentriert auf die Lippe – ging so nahe wie möglich an das Bild heran, um am unteren rechten Eck schwungvoll meine Signatur auf das Bild zu setzten.
„Nun bist du ein echter Leuchte“, sagte ich stolz zu meinem Werk. „Mal sehen, ob du wohl einmal etwas Wert sein wirst.“
Daraufhin setzte ich mich erst einmal sichtlich erschöpft in den Schatten der Apfelbäume, die vor der hohen Wand des ehemaligen Steinbruchs vor mehr als fünfzig Jahren gepflanzt worden waren. Inzwischen waren aus den zarten Stämmchen alte, knorrige Bäume geworden. Übervoll mit kleinen rotbackigen, süßen Äpfeln, die mich von frischem Apfelkuchen und Apfelsaft träumen ließen. Auf der linken Seite konnte man die terrassenförmige Anlage des Steinbruchs noch erahnen. Die Steinterrassen hatte man in der Zwischenzeit mit Erde aufgefüllt. Sie boten so nach den vielen Jahrzehnten eine wunderbare Lage für die dort gepflanzten Riesling-Reben. Eidechsen und Mauerbienen fanden zu Füßen der Reben ideale Bedingungen vor. Langsam glitt mein Blick über die anderen Teilnehmer der Gruppe. Da waren ein Bankangestellter, der sich ohne seine Krawatte, wie er behauptete, nackt fühle, und durch die Teilnahme aus seinem Berufstrott ausbrechen wolle. Mehrere Mütter, die sich freuten, einen Nachmittag ohne ihre Kinder verbringen zu dürfen, zwei Kunststudenten und eine Gruppe von Rentnern, die sich ebenfalls neu entdecken wollten.
Ich trank den von mir mitgebrachten Apfelsaft – selbstgepresst vom vorigen Jahr – und schloss die Augen. Fruchtig süß, mit einer angenehmen Säure und dem feinen Aroma, das an Muskatnuss erinnerte, rann mir der kühle Saft die Kehle hinunter.
Vor meinem geistigen Auge tauchte plötzlich eine alte Fotografie auf, die ich erst kürzlich entdeckt hatte. Junge Männer, eher noch Kinder, standen oder saßen in grauer, grober Leinenkleidung auf den zerhauenen Steinen. In ihren zerschundenen Händen hielten sie Meißel und schwere Hämmer. Als Schutz vor den Steinsplittern trugen sie Schutzbrillen. Es handelte sich um straffällig gewordene junge Männer – so galt die Bezeichnung. Schwererziehbar oder auffällig würde man heutzutage sagen, Problemkinder aus sozial schwachen Familien.
Mit ihrer Unterbringung in die Fürsorgeanstalt Schloss Flehingen hatte um 1900 der Staat versucht, sie aus ihrem Umfeld zu entreißen und sie zu vollwertigen Mitgliedern des Staates zu machen. Als Zöglinge, gleich einer Pflanze, die mit Hilfe einer Ranke in die richtige Richtung zu biegen waren. Wer nicht im Steinbruch arbeiten musste, war auf dem Feld, in den Ställen oder den Gärten rings um das Schloss tätig. Die badische Fürsorgeanstalt versorgte sich autark. Alles, vom Gemüse über das Fleisch, Saft ja selbst den Wein bis hin zum Feuerholz für die Küche (eine Heizung im Winter war undenkbar) musste selbst erwirtschaftet werden. Der Wein wurde ebenso wie die Schottersteine verkauft. Daraus bezog man das Geld wiederum für Kleidungsstoffe, Leder für die Schuhe, Saatgut und die Bezahlung für die Aufseher. An die 130 Jungen waren damals in dem, von den Herren von Metternichs abgekauften, heruntergekommenen und maroden Schloss untergebracht. Von wegen warmes, fließendes Wasser, eine heiße Dusche für die müden Knochen oder gar Fußbodenheizung im Bad. Schon eine Einzelhaft wäre ein Traum gewesen. Stattdessen waren sie zu dreißigst in einem Zimmer mit Vierer-Etagenbett untergebracht.
„Ob sich hier im Steinbruch tödliche Unfälle ereignet haben?“, fragte ich mich und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Immerhin war es ein gefährlicher Arbeitsplatz gewesen. Kaum zu glauben, denn nach nun mehr als zehn Jahrzehnten war hier alles mit wildem Wein und Moos überwuchert. Ich verglich es mit Schorf auf einer großen Wunde, die nur langsam verheilt.
Ich dachte an meine drei Kinder. Vor allem an die Älteste von ihnen, Louisa, die inzwischen in die fünfte Klasse ging. Der Jüngste auf der alten Fotografie dürfte in ihrem Alter gewesen sein. Der Staub, der auf ihren Gesichtern lag, und die schwere Arbeit ließen die Jungen bestimmt älter aussehen. Vielleicht sollte ich dieses Bild als Abschreckung zu Hause aufhängen, dachte ich schmunzelnd. Aber mit dem Hinweis, dass dies passiere, wenn man nicht gehorcht und vor allem das Zimmer nicht aufräumt. Ich nahm einen Schluck Apfelsaft und tadelte mich aufgrund meiner boshaften Gedanken selbst.
3
Schloss Flehingen, 3. August 2016. Beinahe wäre ich in das Loch, das sich vor mir urplötzlich auftat, gefallen. Wobei die Bezeichnung Loch völlig untertrieben ist. Der komplette Innenhof unseres Wasserschlosses, einem viereckigen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, der immerhin die Größe eines Tennisplatzes hatte, war aufgerissen und quasi um mindestens ein Stockwerk tiefergelegt. Und dort standen sie, die Herren vom Denkmalamt und mittendrin mein Mann. Er buddelte wieder! Dieses Mal mit Genehmigung von höchster Stelle – nämlich von mir! Durch den in der Ecke stehenden Bagger wirkte die Szenerie vergleichsweise wie ein überdimensionaler Sandkasten.
Wie werde ich mich heute Abend verhalten, wenn Joachim so dreckverschmiert nach Hause kommt, fragte ich mich. Wie die Mutter in der Fernsehwerbung, die lächelnd die schmutzige Wäsche in die Waschmaschine steckt, da sie natürlich mit dem richtigen Waschmittel wäscht? Oder wohl eher wie die verzweifelte Ehefrau, die weiß, dass bei diesem Dreck selbst der beste Wasserenthärter nicht verhindern kann, dass die Waschmaschine den Geist aufgibt.
Meine Mitstreiter des Malkurses sahen diese Szenerie wohl mit anderen Augen als ich: „Faszinierend“ , „Perfekt für Surrealismus“, „Nein, Expressionismus“, meinte ein anderer. „Kubismus“, ein Dritter. Die Kunststudenten empfanden den Bagger und die Sandsteine als „Eine Symmetrie von Moderne und Altem“. „Egal, wie auch immer, die perfekte Szene. Hier bleibe ich“, erklärte unser krawattenloser Bankmensch. „Genau das gibt mein Motiv heute. Der Mensch auf der Suche.“
„Auf der Suche nach was?“, fragte ich mich. Letztendlich erschien es mir, als ob ich wohl die Einzige war, die bei dieser Situation den Gedanken an Schmutzwäsche hatte. Deshalb klemmte ich meine Staffelei und die Leinwand unter den Arm, schnappte mir meinen Zeichenkoffer (ein Geschenk von Joachim zu Weihnachten) und ging nach draußen vor das Schloss.
Mein Blick fiel sofort auf einen großen alten Ginkgobaum rechts vom ehemaligen Schwesternhaus. Ein eigens für die Nonnen errichteter Jugendstilbau. Dies würde mein Motiv werden! Voller Realismus mit oder ohne Impressionismus oder sonst noch etwas, beschloss ich. Die Blätter des Ginkgobaumes vor der alten Schreinerei wogten sanft in der warmen Sommerbrise. Geradezu malerisch, dachte ich. Zusammen mit meinen Malutensilien steuerte ich auf die Schreinerei zu. Das helle Grün des Baumes hob sich wunderbar von dem Ocker des Sandsteinbaus ab. Während der Sandstein in der Sommerhitze zu flimmern schien, geradezu golden funkelte, wirkte das Grün wie eine kleine, kühle Oase.
Bedingt durch die Intensität der Sonnenstrahlen entschied ich mich für die Perspektive „Unter dem Baum, ein Blick durch das Laub.“ Ein holpriger Arbeitstitel, ich weiß, aber die Kursleiterin hatte am Anfang ausgiebig darüber referiert, dass ein Arbeitstitel unerlässlich wäre. Kurz gesagt, unter dem Baum war es angenehm schattig.
Doch kaum hatte ich meine gedanklichen Ergüsse zu Ende gedacht, die Staffelei aufgestellt und die Aquarellfarben ausgepackt, da schoss wie von allen guten Geistern verlassen ein Mann auf mich zu.
„Was machen Sie denn da?“, fuhr er mich an.
Das sieht man doch – malen, dachte ich.
„Verschwinden Sie aber rasch!“, befahl er mir. Packte mich am Oberarm und wollte mich wegzerren.
„Wie bitte?“, fragte ich in einem ruhigen, aber frostigen Ton. Griff nach seiner Hand und entfernte sie von meinem Arm.
„Denkmalamt. Sie stören!“, war seine knappe Antwort.
„Wobei, wenn ich fragen darf?“
Die Frage war wohl zu viel für ihn. Aufgebracht schnappte er nach Luft, lief rot an und drohte jeden Moment zu explodieren. Damit es dazu nicht kam – man stelle sich nur die Sauerei vor –, erklärte ich ihm rasch meine Situation und die daraus resultierende Motivwahl.
„Ich sitze hier zwar zugegeben unter einem Naturdenkmal, da es aber wohl nicht Gegenstand Ihrer Untersuchung sein dürfte, ist es mir nicht klar, inwiefern ich Sie störe. Außerdem haben wir vom Eigentümer die Genehmigung sowohl im Schloss als auf dem Schlossgelände zu malen. Wenn es Ihre Kollegen im Schlosshof nicht stört als Motiv des Tages missbraucht zu werden, dann frage ich mich, bei was ich Sie denn hier stören soll?“
Nun wurde er interessanterweise kreidebleich. Trat unruhig von einem auf den anderen Fuß, gestikulierte dabei wild mit den Händen durch die Luft, bis er schließlich meinte: „Aber aus der Schreinerei bleiben sie draußen!“
Ich nickte lächelnd und dachte bei mir: Das war ein Fehler. Verbiete niemals einer Frau etwas, wenn du sicher gehen willst, dass sie es nicht tut. Wir Frauen sind schließlich nicht neugierig, nein, es ist die pure Wissbegierde, die uns antreibt. Also werde ich selbstverständlich bei der erstbesten Chance, die sich mir bietet, meine Staffelei nehmen, um sie in der alten Schreinerei aufzustellen, um mir dann alles näher anzusehen.“
Mit einem süffisanten Lächeln und dem dazu passenden Augenaufschlag antwortete ich daher: „Selbstverständlich!“
Danach gehörte der Nachmittag unter dem Ginkgo mir. Zu sehr war ich mit meinem Werk beschäftig als dass ich noch an den Wunsch in die alte Schreinerei zu gehen dachte. Selbst mit meinem Werk war ich zufrieden. Ich fand, man spürte darauf die Kühle der Blätter, die Kraft der Sonnenstrahlen und die leichte Brise, die ich genossen hatte. Nachdem ich die Pinsel geputzt, die Staffelei zusammengeklappt hatte, klemmte ich mein Werk unter den Arm und ging zurück ins Schloss. Die meisten Kursteilnehmer saßen noch am Rand des Lichthofes. Bei einigen schienen die Gesichter vor Aufregung förmlich zu glühen. Was war geschehen? Irgendeiner der Ausgrabungsteilnehmer hatte es „geschafft“, mit dem Bagger in einen der Ecktürme zu fahren. Nun war dort ein großes Loch, das unter lautstarkem Geschrei der Männer mit Sprießen abgestützt wurde.
Mein Magen begann sich zusammenzukrampfen, meine Kehle wurde trocken ... Nein, Andrea ganz ruhig, sagte ich mir, Joachim gräbt unter Aufsicht des Denkmalamtes, es ist alles gut. Es passiert nichts. Niemand wird verletzt, keiner kommt um und es wird in diesem Jahr kein Mord passieren. Ich atmete tief durch zählte innerlich bis zehn und setzte mein strahlendes Lächeln auf. „Autosuggestion“ hatte ich in einem VHS-Kurs gelernt. Das sollte helfen. Alles ist gut.
In 14 Tagen fand die Ausstellung „Mein Lieblingsbild“ in der alten Turnhalle statt. Wer wolle, dürfe da sein Lieblingsbild, sei es ein Original oder ein Druck, zeigen. Die Idee hatte großen Anklang gefunden und es versprach interessant zu werden. Daher hatte auch Kommissar Blankenfels sich zum Besuch angemeldet. Ganz privat versteht sich, ohne, wie in den Jahren zuvor, einen Mord aufklären zu müssen, und dabei sollte es auch gefälligst bleiben.
Alles war gut!
4
Flehingen, 17. August 2016. „Ein Traum!“, hauchte Blankenfels. „Dieser Schwung, diese Rundungen, der gesamte Aufbau, die Feinheit der Linien.“
Emma sah mich irritiert an. „Von welchem Bild spricht er? Ich sehe hier kein Bild mit Rundungen.“ Verunsichert über ihre Kenntnisse, was die Malerei betraf, sah sie sich um. Nur schwer konnte ich mir ein Lachen verkneifen. Ahnte ich doch, welchem, beziehungsweise welchen Kunstwerken Blankenfels’ volle Aufmerksam galt.
„Diese Aromen“, schwärmte Blankenfels und zog den Duft der frischgebackenen Schneckennudeln, die auf großen Tellern vor ihm auf dem Tisch lagen, genüsslich ein. „Das nenne ich den perfekten Ausdruck von Heimat. Dazu noch in seiner ganzen Vielfalt.“
„Das hätte ich mir ja denken können“, brummte Emma beleidigt.
„Schneckennudeln mit und ohne Rosinen. Zimtschnecken, Nussschnecken, Puddingschnecken, Mohnschnecken und ... Was ist das?“ Abrupt hielt er in seiner Bewunderung inne, hob den Teller mit den noch warmen, goldgelben Schneckennudeln hoch. Schnupperte. „Apfel?“, fragte er hoffnungsvoll.
Noch ehe eine der anwesenden Landfrauern die Möglichkeit hatte, ihm eine Antwort zu geben, biss er berherzt in das Gebäck. Verdrehte entzückt die Augen und seufzte: „Ihr Flehinger bringt mir zwar seit drei Jahren meine Mordopfer-Statistik durcheinander, aber hierfür komme ich trotzdem doch immer wieder gerne.“
In der nächsten Viertelstunde war er damit beschäftigt, reihenweise Schneckennudeln zu eliminieren. Danach setzte er sich mit einer heißen Tasse Kaffee auf einen Stuhl und erklärte, sichtlich mit sich und der Welt zu frieden: „Also dafür könnte ich morden!“
„Heute Abend wird es noch besser“, versprach ich ihm.
„Noch besser?“, hakte Blankenfels nach, während er an seinem Kaffee nippte.
„Da wird zu den Klängen einer Dixie Band im Park hinter dem Schloss gepicknickt.
„Etwa auf dem Boden?“, fragte er wenig begeistert.
„Ja natürlich“, antwortete ich gereizt. Etwas mehr Begeisterung hatte ich schon erwartet. „Typisch Mann. Ohne eine Bierbank geht mal wieder nichts. – Abwarten, das wird klasse. Apfelmost oder, für den Mensch von Welt die französische Variante, Cidre, gibt es auch. Feine Häppchen, meinetwegen auch Pizzaschnecken und dazu die Live-Musik von der Dixie-Band.“
Sein skeptischer Blick zeigte mir deutlich, dass ihn selbst die Pizzaschnecken nicht überzeugt hatten. „Das Beste ist, glaube mir“, versuchte es Joachim, „du kannst dich dabei faul der Länge nach auf dem Gras ausstrecken und die Musik genießen.“
„Das ist ein Argument“, grinste Blankenfels. „In der Kunstgalerie in Karlsruhe habe ich in einer Ausstellung zum Thema Picknick übrigens ein sehr ansprechendes Gemälde gesehen. Es war nicht, wie man meinen könnte, von Monet, aber aus dieser Zeit. Das abgebildete Picknick war wirklich äußerst delikat.“
Spitzbübisch lächelnd griff er nach seiner Tasse und trank in wohliger Erinnerung.
„Nach Ihrem glasigen Blick zu urteilen, ist das Bild von Edouard Manet und zeigt zwei pikante Sonderzutaten eines Picknicks. Nämlich zwei nackte junge Damen neben einem völlig korrekt gekleideten Herren?“, fragte ich gezielt pikiert.
„Erraten.“ Blankenfels verneigte sich vor meinem Wissen. „Ich nehme aber an, dass es hier in Flehingen nicht zu solchen Ausschweifungen kommen wird.“
„Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Mordstatistik wieder steigt. Aber wer weiß schon, was so alles passieren kann, wenn manch einer zu viel Most im Hirn hat. Da ist alles möglich“, konterte Joachim mit einem geradezu herausfordernden Blick. Blankenfels sah ihn einen kurzen Moment erschrocken an. Beruhigte sich aber gleich wieder: „Keinen Mord, so will ich hoffen. Die Statistik ist, was diesen Ort betrifft, schon auf Jahre hinaus übererfüllt.“
Seit wir uns anlässlich des Mordes an einer Ortsschaftsrätin kennengelernt hatten und Joachim damals als Hauptverdächtiger galt, hatte sich in den zwei darauffolgenden Jahren nochmals vier Morde ereignet. Einer davon zwar jenseits der badisch-schwäbischen Landesgrenze, in Derdingen am Bernhardsweihersee, er stand aber mit den beiden anderen in Flehingen in Verbindung. Der vierte im letzten Jahr war allerdings an einem Auswärtigen verübt worden, ein Tourist sozusagen. Noch dazu ermordet von der Russenmafia. Dies geschah dekadent in einem Schwarzrieslingbad im Weingut. Die Russen verstehen nicht nur zu leben, sondern auch zu sterben.
Inzwischen war eine Freundschaft zwischen Blankenfels, Joachim, Emma und meiner Person entstanden.
„Ich möchte gar nicht wissen an was Sie gerade denken“, stichelte Blankenfels und beäugte mich kritisch.
„An die Morde natürlich“, gab ich zu, „ein Wunder, dass überhaupt noch jemand nach Flehingen zieht. Ehrlich gesagt, erschrecke ich inzwischen, wenn jemand nachts eines dieser nervigen Feuerwerke anlässlich von Hochzeiten oder Geburtstagen abfeuert. Im ersten Moment schießt es mir jedes Mal durch den Kopf, diesmal wird einer erschossen. Erst gestern hatte doch so eine Göre in der Nachbarschaft ihren achtzehnten Geburtstag gehabt. Ihrer Freundin war nichts Besseres eingefallen, als kurz nach Mitternacht gegenüber unseres Schlafzimmerfensters drei Böller abzuschießen. Ich dachte, mein Herz bleibt vor Schreck stehen“.
„Ganz furchtbar ist das mit dieser Unsitte geworden“, stimmte Emma mir empört zu. „Da bist du im Tiefschlaf und dann knallt so ein Idiot durch die Nacht. Vor vierzehn Tagen bin ich dermaßen erschrocken, dass es bei mir Wehen auslöste und Thorsten mich ins Krankenhaus fahren musste. Zum Glück ist mit dem Baby nichts passiert,“ zärtlich strich Emma über ihren inzwischen kugelrunden Bauch. „Den Idioten habe ich angezeigt“, schimpfte sie zornig weiter. „Und wisst ihr was? Anstelle sich bei mir zu entschuldigen oder zumindest Verständnis für meine Situation als hochschwangere Frau zu zeigen, hat er mich doch als Spaßbremse beschimpft!“
„Na, dann komm meine süße Spaßbremse“, flötete Thorsten seiner Ehefrau ins Ohr. „Es gibt hier noch einiges zu entdecken.“ Damit hatte er recht.
Die Idee, dass Bürger ihre Lieblingsbilder, -drucke oder -gemälde für die Öffentlichkeit ausstellen, war eigentlich nur so ganz nebenbei und quasi als Lückenfüller für das Kulturwochenende gedacht gewesen. Aber es fand überraschenderweise großen Anklang. Wir hatten sogar befürchtet, Bilder ablehnen zu müssen, da die Ausstellung zu groß zu werden drohte. Der Besucherstrom war riesig. Zum Teil kamen die Besucher allerdings nicht aus Kunstinteresse, sondern aus purer Neugierde, was wer im Wohnzimmer hängen hatte. Sogar die regionale Presse war zahlreich erschienen. Natürlich gab es Bilder, die mehr über den Besitzer als über den Kunstwert aussagten. Auch einiges Amouröses aus dem 19. Jahrhundert war dabei. (Ich wusste gar nicht wie viele es davon in der angeblich ach so prüden Biedermeierzeit gab.) Wir mussten sie, laut den Vorschriften des Jugendgesetzes, hinter einem Vorhang in einem separaten Raum ausstellen. – Er war übrigens der best besuchte Raum. Viel Klassisches oder Modernes wie Rosina Wachtmeister fanden sich in den anderen Räumen. Ein Kind hatte ganz stolz sein Diddel-Poster gebracht. Es hatte einen Ehrenplatz bekommen. Und zwar bei den Originalen, die die Besitzer selbst gemalt hatten oder die aus dem Urlaub mitgebracht worden waren. Das ein oder andere Gemälde eines alten Künstlers fand sich aber dennoch. Dazu gehörte eindeutig das Bild von Emmas Tante. Mit 2 Meter auf 1,20 Meter und der angeblichen Signatur von Klimt hatte es mich doch tatsächlich Verhandlungen mit der Versicherung gekostet.
„Dass du dich von deinem Klimt trennst?“, stichelte Emma liebevoll ihre Tante. Das runde Gesicht der alten Dame glühte vor Aufregung. Sie sah Emma dennoch böse an.
„Natürlich kann ich mich von meinem Bild trennen, du dummes Ding.“ Sie strich liebevoll über den Rahmen des Bildes und ihr Gesicht nahm die Farbe ihrer malvenfarbenen Leinenbluse an. „Außerdem kann ich es ja morgen wieder mit nach Hause nehmen“, ergänzte sie freudestrahlend.
„Es ist doch nicht wirklich ein echter Klimt?“, fragte mich Blankenfels besorgt. „Allein die Versicherungssumme muss ja enorm sein.“
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.