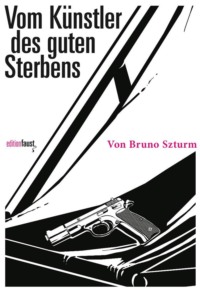Kitabı oku: «Vom Künstler des guten Sterbens»
Bruno Szturm
Vom Künstler des guten Sterbens
Roman


1. Auflage 2020
© Edition Faust, Frankfurt am Main 2020
Titelillustration: Alexander Pavlenko
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
eISBN 978-3-945400-83-8
Inhalt
Vom Künstler des guten Sterbens
Zum Autor
Zum Buch
Und einmal, bevor Ekkehard zum Kartäusernovizen wurde, lagen wir hinter den Gewächshäusern seiner Inselgärtnerei im Gras. Ich hätte rausfahren und zum dritten Mal Beute machen sollen, aber Babo Jo ließ mich nicht und Marlene kuschte. Eigentlich war längst Herbst; nur am See hat das wenig zu heißen, wo die Jahreszeiten sich selbst hinterhertrudeln, weil die Sonne im Frühjahr einen Winter voll Nebel und Selbstmorde wegbrennen muss, was seine Zeit braucht, die dann hintendran gehangen wird. Wir lümmelten uns also auf der Wiese, Babo Jo in einem alten Liegestuhl schlief oder sah so aus, und vor lauter Nixnützigkeit ließen wir für ihn eine Katze aus dem Sack. Marlene tat es, oder Laienbruder Ekki, Jarek oder ich: nahm das Playstation Headset, startete ‚Stalingrad: Die Revanche‘ vom letzten Beutezug, setzte Babo Jo die VR-Brille auf die geschlossenen Augen. Nahm die Česká, schob sie ihm in die rechte Hand, legte seinen Finger sachte an den Abzug.
So echt war die stumm attackierende Rotarmistin und unser Gekreische dazu, so jäh der Sprung aus seinem Träumchen – jedenfalls brüllte Babo Jo um sich, spürte die Knarre in seiner Hand und ballerte auf das Trugbild los.
Klack-klack-klack, mit leerem Magazin.
Über der Reichenau kehrte wieder Ruhe ein. Ich aber, der ich deinen aus der Zeit gefallenen Gewissensgrundsatz, niemals selbst eine Waffe in die Hand zu nehmen und damit einen Menschen zu töten, zum Härtetest vor eine Pixelkulisse schob, muss nun wohl oder übel schreiben.
Alter!
Selbst wenn wir fünf erfunden wären, ich müsste es dennoch. Irgendein frommer Schriftkundiger, der uns warum auch immer erfand, zwingt mich, dir die Computerbrille wieder und wieder aufzusetzen und dich durchglühen zu lassen: weil du, Joachim Schwengel, am unentrinnbar Zwingenden in diesem harmlosen Streich – der Lektion, dass sogar du als Kriegsdienstverweigerer gegen Instinkte Reflexe Tiefenschichten nicht ankommst – knabbertest und knabberst.
Nicht ganz so die üblichen Worte für eine Siebzehnjährige, ich weiß. Roger & over.
Als Jachym Szwengl zeitig vor Ausrufung des Kriegsrechts im Sommer 1981 das Licht der Welt erblickte, konnte sein Vater, der als Schweißer auf der Leninwerft zu Danzig dicke Pötte zusammennähte, noch nicht ahnen, dass er zwei Jahre später von seinem deutschen Stammbaum Gebrauch machen würde. Mit der Ausreise in die BRD wurde aus Szwengl wieder Schwengel, und aus dem Altertümchen Jachym wurde Joachim.
Joachim war damals in Konstanz, Allensbach und Radolfzell nicht der angesagteste Vorname, aber auch nicht übler als Norbert, Manfred oder Dorothee. Ich weiß, wovon ich schreibe, denn als Ekkehard war ich mit Berno und Pirmin ein anderes Kaliber. Wir drei bekamen es zu spüren, als es zum Schulwechsel von Grund- auf Weiterführend von der Insel runterging auf die Geschwister-Scholl.
Als ‚Fenchelfresser‘ hatten sie uns dort zwischen. ‚Feld-, Kraut- und Bohnensalat‘ nannten sie uns, weil Bernos Mutter bei meinen Eltern in der Gärtnerei aushalf und der Vater vom langen Pirmin einen Pritschenwagen besaß, mit dem er Obst, Gemüse und Schnittblumen auf die Wochenmärkte in Petershausen und am Sankt-Stephans-Platz kutschierte und auf klapprigen Tapeziertischen verkaufte. ‚Die grüne Dreifaltigkeit‘, sagte Relilehrer Pastor Hahn und meinte es gar nicht so. ‚Spinatjesus‘, kriegten wir es einzeln ab, bis Hahn vertretungsweise auch Latein übernahm und De bello gallico gegen die Visio Wettini eintauschte, weil er meinte, zwei Spatzen aus der Luft zu klopfen, wenn er uns am Zipfel der Regionalgeschichte packte und den Reichenauer Abt Walahfrid Strabo seine Jenseitsvorstellung ausrollen ließ. Außer Klassenprimus Norbert von Bresen konnte in Latein auf einmal keiner mehr mit uns mithalten, Heimvorteil war Heimvorteil, selbst Berno, als Halbwaise mit einer Glucke von Mutter geschlagen, schwamm dieses Mal nicht nur mit, sondern paukte inbrünstig Vokabeln und Grammatik und zog Einsen.
Latein bei Hahn brachte uns neue Kosenamen ein: bösartigere als der kuschelige ‚Strebergarten‘, den Marlene bei einer Exkursion auf unsere Insel fallen ließ. ‚Lauch‘ (jawohl: Lauch) war einer davon, versetzt mit Klassenkeile oder einem Spießrutenlauf über den Schulhof durch ein Spalier mit fauligen Porreestangen als Prügel. Dass nicht der komplette Ausschuss auf uns niederregnete, hatten wir Joachim zu verdanken, der schweigend mit uns in die Gasse ging und dafür scheel angesehen, aber verschont wurde. Wir schoben uns an ihn, und er ließ es zu.
Was wir Insulaner uns da nicht zum ersten Mal fragten: Konnte man mit der Reichenau nirgends punkten, überhaupt nicht und niemals? Waren wir an der Geschwister-Scholl abonniert auf die Gemobbten?
In der Sieben steckte irgendwer Pirmin Schirrner den Tipp mit dem Fußballplatz hinter dem Strandbad. Einfach rein durch den rostigen Zaun, dem Platzwart einen Wink geben, der früher selber auf unserer Schule gewesen war, abgebrochen zwar, aber unser Elend nachvollziehen konnte. Und dann die Pille aufgepumpt und los. Auf dem Festland hatte es entweder Rasenanlagen mit hohen Zauntoren davor und dicken Schlössern dran, oder Aschenplätze. Zwischen Mittelzell und Niederzell dagegen gab es weiches Gras, kurz getrimmt und ordentlich drainiert, auf dem man sich beim Hinfallen nicht gleich rote Rösti schrammte.
Noch war zart Frühjahr und trotzdem schon Mai, als wir das erste Mal auf Rasen gegeneinander antraten. Insel gegen Festland. Wir wurden herausgefordert und stampften eine Mannschaft aus dem Boden: wir drei, ergänzt durch Messdiener und Hauptschüler, alte Grundschulkumpels, keiner älter als vierzehn, das war Bedingung.
Das Festland kam mit allem, was sie hatten. Anderthalb Dutzend Kicker mit weißen Leibchen über dunklen kurzen Hosen und ein Trupp Gören, unsere Mitschülerinnen, die uns anmachen, auslachen, niederbrüllen sollten. Die Sonne schien den diesigen Himmel langsam blank, und uns auf die schweißzerfurchten Stirnen. Rund um den Rasenplatz war eine Absperrung aus halbverrosteten, vor Jahrzehnten das letzte Mal blau lackierten Sechseinhalbzoll-Eisenrohren gezogen, die alle zehn Meter auf weißen Pfosten von gleichem Material und Durchmesser saßen. Dahinter Büsche, ein paar Bäume, ein Streifen Natur, im Norden dahinter das Strandbad, Schilf, wieder Natur, Vogelgezwitscher, Insektengebrumm, von Ferne tuckerte ein Dieselmotor und ein Handrasenmäher säbelte, die Gärtnereien brachten ihre Freilandflächen in Schuss und Bernos Mutter hob bei uns die blinden Dachfenster der Gewächshäuser an, weil das erste Kondenswasser des Jahres die Scheiben herunterlief.
Auf den Eisenrohren hockten, an ihnen turnten herum, auf ihnen fläzten sich die Mädchen, sahen uns beim Spiel zu und langweilten sich eigentlich, denn die zweimal Elf auf dem Spielfeld hatten keinen Blick für sie übrig, so ernst nahmen wir Insel gegen Festland. Auch die Auswechselspieler der Festländer, die auf der anderen Längsseite des Platzes hinausrotiert waren, hatten nur Augen für den Kick, brüllten rum und rein und warteten sprattelnd darauf, wieder aufs Gras zu rotieren.
Team Reichenau hatte keine Chance. Sogar Joachim, eigentlich nicht der Schnellste und vor allem ohne Bums in den dünnen Beinchen, schenkte Pirmin einen ein, der mit Pflanzhandschuhen bei uns im Kasten stand. Wir waren zu ministrantenbrav, nur die Hauptschüler wehrten sich, auch weil sie auf dem Platz und von außen Sprüche kriegten.
Darum soll es aber gar nicht gehen, sondern um Rönz.
Denn Pascal Rönz wird noch eine Rolle spielen, sogar dreimal. Er und Joachim hatten sich ab jenem Nachmittag schwer auf dem Kieker.
Rönz gehörte im Mai 1994 zu denen mit Pubertätsvorsprung. Legte nach und nach die Stimme tiefer, wo wir von der Insel alle noch rumkieksten. Hatte einen Flaum unter den Achseln und Haare an den Eiern, wo wir noch glatt wie die Delphine waren, hatte schlechte Manieren und außer in Sport schlechte Noten. Dass er nicht sonderlich ausgeglichen war, kam dazu, störte aber Marlene nicht, die ihre Beine von der Eisenstange baumeln ließ und immer dann nicht mehr gelangweilt vor sich hin stierte, wenn Pascal Rönz die Stutzen hochzog und sich einwechselte. Es hieß, Rönz und sie hätten Doktor gespielt miteinander, denn auch Marlene hatte längst ordentlich Futter vorne unterm Schlüsselbein. Die zwei sollen gefummelt haben: ein Gerücht, das unsereinem wenn, dann wie durch einen feinen Schleier wehtat, weil wir ihr Mundwerk mochten und sie wegen des strohblonden Pferdeschwanzes liebten, aber noch nicht zu begehren wussten.
Und dann rammt einer unserer Inselhauptschüler Rönz ab. Keilerei, während der Gehackte sich auf dem Platz krümmt. Irgendwann geht es weiter, ohne Rönz, der mit einer Schweinewut im Bauch und einer klaffenden Risswunde im Oberschenkel auf der Mädchenseite den Platz entlanghumpelt. Mit Marlene im Kielwasser, flucht er vor sich hin. Im selben Augenblick riskiert ein Amseljunges ein verhängnisvolles Tschilpen. Am Ende des Rohres, auf Höhe der Eckfahne hockt es in einem Nest, hat Hunger, macht aber den Falschen auf sich aufmerksam mit seinem Gezwitscher.
Rönz muss sich das Junge aus dem Rohr gegriffen haben, mit derselben kalten Wut in den Augen, mit der er uns beim Porreespalier gemustert hatte. Nehme ich jedenfalls an, denn gesehen habe ich es nicht, sondern war achtzig Meter weiter weg mit der nächsten Notbremse gegen einen durchgebrochenen Festländer beschäftigt.
Zuerst hörten wir Marlenes Kreischen, selbst ich am anderen Ende des Fußballplatzes bekam es mit. Dann sahen wir, wie sie mit beiden Fäusten auf Rönz eindrosch, der ihr den Rücken zukehrte und dem Amseljungen seelenruhig die winzigen Flügel auffaltete, die weichen Knochen vom Brustbein nach hinten überdehnte und die zwei Flügel erst rechts, dann links vom kleinen Körper weg anriss. Mit der Gleichgültigkeit eines Imbissbudenkunden ging er vor, meinte Norbert von Bresen später, der als erster von uns dazu stieß. Mit der bestecklosen Gelassenheit eines Essers, der ein Brathähnchen ausbeint. Nur dass er dabei raste und knurrte.
„Rönz, du Wichser!“
Marlene war die einzige, die was über die Lippen brachte. Nicht Pascal-lass-das, meinte Manfred Stresow später zu mir (ich hatte es immer noch nicht ganz über den Platz geschafft). Sondern Rönz-du-Wichser.
Die anderen standen stumm um Pascal Rönz herum, trauten sich nicht einzugreifen oder griffen nicht ein. Das kleine Federknäuel gellte sich die Seele aus dem Leib. Sein Peiniger war im Tunnel und kriegte nicht mit, wie wir ihn umzingelten und doch nichts taten. Die Flügel ganz abzureißen, nur das ging ihm durch den Kopf.
Wieder war es Marlene, die den Bann brach. Ihre Schelle hatte es in sich, die Rönz zwar nicht zur Besinnung brachte, aber auf die Bretter schickte, die winzige Amsel in der Hand. Wir näherten uns, zogen den Kreis kleiner, sehr vorsichtig, obwohl er nach dem Foul und der Backpfeife komplett außer Gefecht war. Es dauerte, bis ein halbes Dutzend Quartaner auf seinen ausgetreckten Armen hockten, auf seinem heilen und dem wunden Bein, und Marlene auf dem Brustkasten. Die Inselmessdiener und Hauptschüler waren später baff, warum so zögerlich.
An ein Weiterspielen war nicht zu denken, wir brachen die Partie ab.
Joachim muss sich das Gerangel teilnahmslos angeschaut haben. So würde ich meinen, der ihn damals nicht im Blick hatte, aber sonst begann ihn mit neuen, genauen Augen zu sehen. Dann, meine ich, hat er sich hingehockt und das Vogeljunge aufgelesen, das Rönz aus der Hand gekullert war und nach den Eltern oder Erlösung brüllte, aber mit seinem wilden Piepsen nichts ausrichten konnte gegen das Durcheinandergeschrei der bösen jungen Menschen.
Nur Marlene, vom Feldherrenhügel auf Rönz‘ Brustkorb herab, wird es aus dem Augenwinkel mitbekommen haben. Jedenfalls reime ich es mir so zusammen. Joachim bat mich, ihm und der kleinen Amsel zu helfen.
Wir machten uns auf zu mir nach Hause, wo er mit Streichhölzern und abgeknickten Wattestäbchen versuchte, die gebrochenen Flügel zu schienen, das Junge zu füttern und zu tränken. Er fragte nach einer Schmerztablette, bröselte sie klein, löste sie in Wasser auf, zog die Lösung auf eine Spritze aus meinem Spielzeug-Arztkoffer und träufelte sie in den kleinen Schnabel. Er baute ein Nest aus Holzspänen und Watte, ich hatte eine Rotlichtlampe aufzutreiben, wir stellten das Nest auf die Fensterbank in meinem Zimmer. Er saß davor, wortlos, und ich setzte mich wortlos daneben. Dann schloss das Tier die Lider. Das Pulsen in der kleinen Brust wurde kräftiger, schien mir, wenn Joachim nachfütterte und die Spitze der Spritze vorsichtig in den Schnabel schob. Ein Fehlschluss. Es war die Anstrengung, die es das Tier kostete, den Kopf zu recken und zu schlucken. Sein müdes Herz pumpte aus Verzweiflung und, vielleicht, dem kleinen letzten Willen, in Joachim und mir Verbündete zu sehen im Kampf um sein Leben.
Bis um halb zwei nachts hat es durchgehalten, Joachim auch, während ich irgendwann eingeschlafen bin. Als ich aufwachte, hatte Joachim es im Karottenfeld hinter dem Kühlcontainer begraben.
Aber was sind die richtigen Worte für eine Siebzehnjährige, die am Boden angefüttert worden war und ein Teilzeitdasein als Baronin auf den Bäumen im Hambacher Wald verbrachte, das sich von Tag zu Tag richtiger anfühlte, über mehr als ein Jahr hinweg, Mai 2017 bis Oktober 2018. Fridays for Future, denn ja, ich bin die ganze Zeit weiter zur Schule gegangen, neuntes Schuljahr, zehntes Schuljahr, elftes im rheinischen Braunkohlerevier. Extinction Rebellion, wo sich viele Betroffenheitserwachsene tummelten, und schließlich Marlene, die mich aufpickte und direkt was mit mir vorhatte, ihr Babo Jo genauso. Was sind die richtigen Worte? Frühreife Göre, Lockvögelchen, Susanne Albrecht II.? Ich bin gespannt, was sie eines Tages über mich schreiben.
Bis dahin schreibe ich.
Meine Wut, sie hatte Karriere gemacht und sich verändert. Ihr Ziel wurde mit den Jahren ein anderes. Mit fünfzehn waren es die satten Erwachsenen mit ihren drei Urlauben im Jahr auf Miles and More, ihren SUVs und warmen Ärschen aus der Ölheizung. Eine verlorene Generation. Dreckschleudern mit einem fossilen Fußabdruck so breit und schwarz wie ein verrußter Scheißhausdeckel. Mit sechzehn wurden aus Eltern die ‚Auslebenden‘ und ‚Früher-ins-Gras-Beißer‘. Ihr Tod kam als Vorstellung ins Spiel, garniert mit Ungeduld, Torschlusspanik und dem Gefühl von Ohnmacht. Ich war nach endlosen Diskussionen einmal komplett durchgefrustet und knallte es den Trittbrettfahrern von Parents for Future genau so vor den Kopf. Bis zur biologischen Lösung dauerte es noch, die Auslebenden würden bis dahin weiter schalten und walten. So wie es aussah, das entscheidende Weilchen zu lang, frag nach beim Meeresspiegel oder hau dein Thermometer an. Danke für nichts, Sterbetafeln und Lebenserwartungsstatistiken, medizinischer Fortschritt und achtzig Jahre lang kein Krieg!
Stand Frühherbst 2019, sah meine Wut die biologische Lösung, mit der sich die verlorene Generation irgendwann wegerledigen würde, als Problem. Mein zorniges Köpfchen suchte nach einer Lösung für das Problem der biologischen Lösung.
Diese Wut trug ich auf einen Bio-Bauernhof im Schwarzwald. Als die aus den Baumhäusern war ich eingeladen worden und hatte nicht nein gesagt, weil ich streiten wollte. Die Gastgeber dachten, mein Auftritt würde ein Selbstläufer werden. Vor Gleichgesinnten über Kohle, Konzerne, Kurzstreckenflüge abledern, was sollte da schiefgehen? Drei Dutzend Zuhörer trudelten in die umgebaute Scheune ein. Sie kamen aus der Ü50-Schublade und wollten mich streicheln, achtsam herzen, nachhaltig anlächeln. Das mit dem schlechten Generationengewissen mochte bei ihnen funktionieren, das mit dem Kindchenschema aber auch.
Nach fünf Minuten war ich auf Betriebstemperatur. Hielt dem Publikum seine, meine, unsere verpassten Chancen vor. Kam auf seine Verlogenheit zu sprechen. Verurteilte sie aus meiner mitgebrachten Baumkronenwarte in Bausch und Bogen.
„Ihr mögt euch für die falschen Ansprechpartner halten, die falschen Angeklagten. Ihr seid Sympathisanten und Unterstützer, denkt ihr. ‚Hambi bleibt‘ habt ihr doch mitgerufen, sagt ihr. Das Lied gegen die mitgesungen, die baggern in der Ferne. Ihr habt Bioschokolade und Müsliriegel und veganen Eintopf gespendet, sagt ihr, und bei den Waldspaziergängen in unsere Körbe gelegt, damit wir sie hochseilen. Wie schön“. Luftholen. „Blöd nur, dass ich euch nicht traue. Nicht über den Weg, und auch nichts zu“.
Stille, ein Anflug von Rot in einigen Gesichtern und ein Pärchen in der zweiten Reihe, das jünger war als der Rest. Sie mit Vollmondgesicht, etwas üppig und blondem Zopf. Er mit abgewetzter Cordhose in Erbsensuppenfarbe, verschmierter Nickelbrille, mit erstem Grau in den ungekämmten hellen Locken, wie Zufalls-Dreadlocks sahen die aus, und tageslichttauglich. Für einen Enddreißiger ganz sicher.
Die Beleidigung wirkte. Aus dem blutjungen Vorbild für sämtliche Klimaaktivisten des Planeten wurden nacheinander ein lokal engagierter Anti-Rodungs-Teenager und eine freches Huhn, dem es noch an Reife. Das erst mal so alt werden soll wie. Da gaben sich die Supporter der Bewegung und ihre Hater nichts. Sobald sich das ablaufende Haltbarkeitsdatum angegriffen fühlte, gab es Kontra.
„Kleiner Tipp, Mädchen. Undank lässt sich auch wieder verlernen“.
„Ich hab meinen Eltern damals auch nichts Gutes mehr zugetraut. Aber dass wir jetzt als deine Nazis herhalten sollen …“
„Kann es sein, dass du uns zur Hölle wünschst? Senozid, gibt es das Wort?“
„Abdanken allein reicht nicht“, sagte ich. „Ihr seht ja selbst, wie ihr von euch eingenommen seid. Wie ihr mir das verkauft als Altersweisheit. Ein Leben lang nichts auf die Kette gekriegt und am Ende auf Respektrentner machen“.
„Ich verstehe dich nicht, Kind. Deine Hirngespinste“.
„Ist das dein Ernst?“
Dass ich euch zur Hölle wünsche? Es sind Gedankenspiele, ja.
„Ich zucke mal nur mit den Schultern“, sagte ich stattdessen.
Wieder Stille. Die Köpfe vor mir inzwischen puterrot, die Mienen versteinert.
Und dann stand der blonde Zopf auf.
„Ich kann Sie verstehen“. Sie war die erste, die mich siezte. „Es sind auch nicht gleich Hirngespinste. Ich nehme Ihr Anliegen ernst, das so viel Wut und Befürchtungen auslöst, und spiele es mal durch. Damit wir alle wieder etwas runterkommen“.
Es gehe ihr um sowas wie Interessenausgleich, sprach sie. Um ein Szenario, das zwar biotechnisch noch nicht möglich sei, aber die Position der Zuhörer berücksichtigt und zugleich auf meine Forderung eingehe. Sie hoffe, dass ihre Idee nicht gleich belächelt wird, nur weil sie schräg klingt. Denn hinter der Idee stecke eine andere Idee, die einer Lösung für den Konflikt.
„Gehen wir über das Leben an die Sache ran“, sagte sie. „Nicht über den Tod, den Sie uns vielleicht insgeheim wünschen, schon gar nicht die Hölle, sondern das Leben. Es soll bewahrt bleiben, das Leben der, wie sagt man so schön, Altvorderen. Prämisse Nummer Eins. Nummer Zwei: Sie stehen momentan im Weg, diese Altvorderen. Sie haben nichts bewegt und bewegen nichts, wo uns allen die Zeit davonläuft, Ihnen mehr als denen, weil Sie noch mehr davon auf der Uhr haben. Die Pegel der Meere steigen, es wird heißer, je nach Berechnung erleben Sie noch, dass die Arktis im Sommer komplett eisfrei ist. Also auf Seite mit den Alten, damit Sie das in die Hand nehmen. Wie bekommt man beide Prämissen zusammen? Das am Leben Lassen und die Übergabe des Staffelstabs jetzt? Folgen Sie mir, springen Sie mit. Durch Kryonik …“
Raunen im Bauernhof, während ich gespannt war, wie es weiterging. Es war der Moment, an dem Marlene mich am Schlafittchen packte.
„Durch ein Moratorium des älteren Lebens mit Hilfe von Kälte. Einfrieren und Konservieren, bis das junge Leben die Probleme in den Griff bekommt. Dann wieder auftauen und zu Ende leben, je nach Zeitpunkt sogar biologisch jünger als Sie [Zeigefinger auf mich] es dann sind. Sie wollen ja nicht nur stänkern, sondern auch Verantwortung übernehmen. So ginge es. Nebenbei schlössen alle einen Generationenvertrag der anderen Art: Ihr lasst uns Jungen jetzt machen, wir halten euch dafür schön gefroren und sorgen später dafür, dass ihr wieder ans Laufen kommt“.
Darauf Vogelzeigen und Wegbrabbeln hier, nachdenkliches Nicken dort. Je nach Grad des Eingegroovtseins darauf, dass das hier nur ein versöhnliches Visiönchen sein sollte, ein Vorschlag zur Güte, ein Brückchen, über das alle wieder aufeinander zugehen konnten. Die Cordlocke neben Marlene witterte, was in der Luft lag. Er applaudierte energisch los, hoffte auf Nachahmer.
Doch nur ich wäre gerne mit eingestiegen. Das bisschen Klatschen, das von den anderen kam, beschämte den Claqueur.
„Ja, hätte was mehr sein können“, meinte Ekkehard vor dem Hoftor.
„Hauptsache, dich hat seine Idee erreicht“, sprach Marlene. Wir waren jetzt beim Du. „Du musst Joachim unbedingt kennenlernen“.
In den Sommerferien lud ich Joachim regelmäßig ein zum Zelten. Jedes Mal ist er rausgekommen mit einer anderen im Schlepptau. Heike Marlene Jolanta Marlene. Untertertia Obertertia Untersekunda Obersekunda. Im achten Schuljahr war es bei ihm explodiert, die schmächtigen Beinchen kriegten Muskeln, die Nase einen Ring voller Pickel, natürlich stand der Adamsapfel vor wie eine rausgedrückte Kniescheibe und sein Sack mauserte sich zur Minikokosnuss. Wie man nach Sport unter der Brause feststellen musste. Wo man nicht dran vorbeisehen konnte.
Seine Weibergeschichten hießen nicht, dass ich zu kurz kam, wenn er die Zeltheringe in die Wiese hämmerte, auf der ihn Jahre später eine virtuelle Russin für einen Moment aus dem Lot bringen sollte. Wir nahmen uns Zeit für Spaziergänge zu zweit, das Schweizer Ufer im Blick oder, wenn wir die Pirminstraße entlang nach Oberzell liefen, den Säntis in seiner kitschigen Postkartenpracht. Wir palaverten, tasteten uns wortreich in die Welt, gaben uns zu zweit frühreif philosophisch. Fahndeten nach Gott und setzten ihn voraus, dass es Pastor Hahn eine Freude gewesen wäre, wenn Joachim es nicht so mit den Befreiungstheologen gehabt hätte.
„Für einen Polen ist eine politische Kirche doch eher untypisch“, frotzelte ich. „Bei dem Papst!“
Pole sei er ja nur zwei Jahre lang gewesen. Dann hatten sein freiheitsliebender Vater und die gottesfürchtige Mutter die Schnauze voll gehabt und waren mit Klein-Jachym im Schlepp ausgereist. Über Friedland zogen sie nach Hamburg und wurden im Rubbedidupp aus Freiheitsliebe und Gottesfurcht geschieden.
„Zwei polnische Jahre bloß. In so kurzer Zeit frömmeln sie dich nicht durch“, meinte er. „Frag Jolanta, die ist mit vier raus“.
Katholisiert wurde er trotzdem.
„Katholisiert wurdest du trotzdem“.
„Von Mutter Teresa“, witzelte er. Teresa Szwengl, heute Schwengel, geborene Jagoda, die nach der Scheidung drüben im Kloster Hegne, an der anderen Uferseite eine Arbeit und Unterkunft für sich und Klein-Joachim fand. „Mutter Teresa“ sagte ich, „klingt nicht nach einer Befreiungstheologin“.
„Auf meinen Vater schieben kann ich’s auch nicht“. Mariusz Szwenglschwengel, den einzigen Atheisten unter den streikenden Werftarbeitern Danzigs, kümmerte nur die Befreiung, nicht die Theologie. „Obwohl er stammbaumkatholisch ist“.
„Na denn“.
Wir ließen uns forttragen, weg von Boff Gutiérrez Cardenal, die ich höchstens quer-, Joachim dafür genauer gelesen hatte, und orgelten unsere Stammbäume durch. Wenn unsere Gärtnerei in direkter Linie auf Strabos Kräutergarten zurückgehe, wie mein Vater meinte, konnte Joachim kontern. Sein Vorfahr sei Georg Schwengel gewesen, Prior des Kartäuserklosters Paradisus Beatae Mariae in Karthaus, heute Kartuzy, Kaschubien.
„Die stahlharten Kartäuser“, lachte Joachim. Nachts um halb zwölf lassen die sich wecken, mitten in der Tiefschlafphase, für zwei Stunden Offizium. Morgens kein Frühstück. Beten in der Zelle, jeder für sich, von der Prim bis zum Komplet das Stundengebet einmal durch. Klausur Klausur Klausur und Schweigegelübde. Das Leben eine einzige Liturgie. „Von der Welt draußen abgenabelt, jedenfalls die Priestermönche“.
Und Georg Schwengel, fabulierte Joachim, war im 18. Jahrhundert drei Jahrzehnte lang ihr Chef gewesen. Er legte eine Büchersammlung an. Las und ließ lesen. Fand zwischen den Gebeten Zeit, den Apparatus ad annales Cartusiae Paradisi zu verfassen. Joachim ratterte das so runter. Eine Chronik des Klosters ab Gründung 1381.
Sicher was für Hahn, dachte ich, und Joachim sagte es. Grübelpäuschen.
„Hast dich ja ganz schön reingerödelt in das Thema“, fing ich nochmal an.
„Wegen dem alten Schwengel. Und weil die Mönche so radikal sind. Raus aus der Welt, rein in die Versenkung, krasses Programm. Nichts für mich, aber mit ein paar Sächelchen, die mich nicht kalt lassen“.
„[---]?“
„Der Tod, auf den sie ihr Ausdauerbeten vorbereitet und vor dem sie keine Angst haben zum Beispiel. Die Klosterkirche der Kartause war voller Anspielungen, das Dach sieht heute noch aus wie ein Sargdeckel“.
„Und das kickt dich?“
Nein, nicht das. Joachim seufzte, atmete tief.
„Nicht ihr Tick vom guten, furchtlosen Sterben. Nicht der Zuversichtskram beim Abkratzen“.
„Sondern?“
Nochmal Luftholen.
„Das, was es mit dem macht, der jemanden zum Sterben bringt. Der tötet. Was macht das Wissen darüber, dass das Opfer für den Tod gewappnet ist, mit dem Killer? Erleichtert es ihm die Tat? Sieht er es als Gabe? Als Geschenk des Getöteten an den Mörder? Kann man deswegen weniger Gewissensbisse haben, sühnt es sich leichter? Wie kriegt man es dem Getöteten vergolten? Verschuldet man sich ihm? Ist das ein anderes Band zwischen Mörder und Ermordetem als die üblichen Schuldgefühle?“ Kunstpause. „Darf man sowas überhaupt denken?“
Dann Funkstille.
„Hast du vor, wen hops zu nehmen?“
Von ihm immer noch nichts.
„Sicher wieder was für Hahn“, sagte ich hilflos.
Im Sommer darauf redeten wir über die Zukunft. Dieses Mal war Marlene dabei, wie schon in den Ferien nach der Acht. Anders als Heike und Jolanta ließ sie sich nicht abwimmeln, wenn Joachim und ich zum Palavern gingen. „Na, Ekki? Leistungskurse schon ausgeguckt“, bohrte sie. „Latein und Reli, in einer Bank neben meinem Dosenöffner? Oder Philosophie?“
„Kommt alles drei nicht durch“, meinte der Dosenöffner.
„Das wird keiner wählen. Lieber leicht und seicht. Deutsch, Englisch, Mathe“.
„Deutsch bei Mohrenbeck“, wieder Marlene, „und ich bin dabei“.
Mohrenbeck, der neue Stern am Geschwister-Scholl-Firmament. Mitte dreißig, mit einer Plauze wie ein Braumeister und jeden Tag, wirklich jeden, in schwarzem Anzug auf schwarzem Seidenhemd. Mohrenbeck, der in der Oberstufe Binjamin Wilkomirski lesen ließ und den Kanon beiseiteschob: Holocaustskandal statt Kabale, Liebe und Kindsmord. Mohrenbeck, der uns an Freitagsdoppelstunden im Bodensee rudern ließ, sich selbst ins Bootsheck pflanzte, über Megaphon Erich Frieds Vietnamgedichte rezitierte und Greflingers Ehehasser. Mohrenbeck auf der Achterbahn im Europa-Park in Rust, wie er eine öffentliche Vorlesung hält über Züge, die pünktlich sind auf ihrem Weg nach Osten.
„Du beim Haarkranz, das passt“. Mohrenbeck hatte nicht nur schütteres, sondern oben auf dem Schädel gar kein Haar mehr.
„Ach Schwengel“. Marlene winkte ab. „Mein ganzkleinbisschen eifersüchtiges Schwengelchen“.
Joachim ging nicht drauf ein.
„Du müsstest auch mal wieder unter die Schafschere, Ekki“, meinte er nur.
„Lenk nicht ab“, sagte Marlene und lenkte selber ab. Griff mir in den Schopf, ließ die dicken Locken durch ihre Finger gleiten, ihre Kulleraugen rollten unter dem Ponyblond. „Ekki, warum lässt du eigentlich die Finger von den Mädchen? Du könntest sie alle haben, alle“.
„Weiß er doch“, von Joachim, „lass ihn in Frieden“.
„Leistungskurs Spanisch könnte klappen“, sagten Marlenes Gefühl und, wie sie andeutete, ihre Freundinnen.
„Wär das nicht was für dich, Ekki? Der einzige Junge. Du wärst der Hahn im Korb. Freie Auswahl, und olé!“
„Weißt du“, sagte ich nach einer Weile und tat dabei so runtergefahren wie möglich, „ich hab hier zwei Optionen. Mönch oder Gärtner. Was anderes geht auf dieser Insel nicht. Wenn Religion nicht kommt, nehme ich Bio“.
Womit sich Marlene nicht abspeisen ließ. Zwei Optionen bloß? Was ist mit wegziehen, meinten ihre Kulleraugen spöttisch.
„Bio klingt auch gut“. Auch Joachim war der Blick nicht entgangen. „Bleib du mal hier, Ekki. Es ist gut zu wissen, wo du deinen Anker hast“.
Das klang damals noch nicht so prophetisch wie es sich heute anhören muss. Joachim wird auch nicht geplant haben, was dann geschah. Jedenfalls im Sommer 1997 noch nicht, als uns die Wahl der Oberstufenkurse und Lehrer Kopfzerbrechen bereitete, weil ja sonst nichts los war.
Dann kamen 1998 und 1999, der Kosovokrieg und Post vom Kreiswehrersatzamt: Musterung und Eignungsuntersuchung und Eignungsfeststellung. Es begann die Zeit, in der die Noten, die wir in unseren Fächern einfuhren, fürs Abitur zählten.