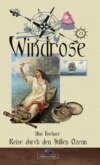Kitabı oku: «Reise durch den Stillen Ozean», sayfa 10
Kalt lächelnd blickte der Mond auf die merkwürdige Gruppe, neben welcher die Gestalt Mister Jacks sass und sich den Rücken rieb. Sein Hüftenplaid war ihm abhanden gekommen, und ohne schützende Hülle ruhte seine Basis auf dem feuchten Rasen. Er schien sich über die Veranlassung dieses unerquicklichen Zustands unklar zu sein. Ueberrascht schaute er um sich, rieb sich den Rücken, kratzte sich hinter den Ohren und blinzelte gegen den Mond, als ob er ihn fragen wollte.
Dem Tobsüchtigen verordnete ich einige Eimer kalten Wassers über den erhitzten Kopf bis er mit den Zähnen klapperte dann brachten wir ihn und Mister Jack, der ebenfalls fror, ins Bett und legten uns selber schlafen.
Zwei Stunden später graute der Morgen, und der Kutscher trommelte uns aus den Betten. Wir kamen nun in einen noch schmäleren Wagen, weil von jetzt ab die Poststrasse noch schlechter wurde, als sie bisher gewesen. Der Mangel an Raum sollte durch Wegfall der Polster ausgeglichen werden.
Leider blieb von den Reisegefährten nur einer zurück und wurde durch einen andern ersetzt, einen Offizier der Konstabulary Force, der wegen Krankheit nach Tauranga zum Arzte fuhr und eine neue Art unangenehmer Gesellschaft repräsentirte, indem er beständig durchs Fenster hinaus seiner läufigen Hündin zubrüllte und sie zur Keuschheit ermahnte den Anfechtungen eines männlichen Köters gegenüber, welcher sie mit heisser Liebe verfolgte, bis wir anhielten und ihn mit einem Strick vor Anker legten. Die alten Gefährten waren womöglich noch rücksichtsloser als je, und mürrisch und grämlich wie alle Menschen, denen es nicht vergönnt ist, ihren Rausch auszuschlafen. Abermals stand ein schwerer Tag bevor.
Für kurze Zeit liessen sich am anderen Ende des öden Tauposees die schneebedeckten Kämme des Ruapehu bestrahlt von der aufgehenden Sonne blicken. Wir bogen nach Norden und kreuzten auf hölzernen Brücken zweimal während des Tages den gleichfalls nach Norden gerichteten Lauf des Waikato.
Das Manukagebüsch wurde spärlicher, und die Gegend nahm wieder mehr den Farncharakter an. Die Dampfsäulen kochender Quellen verschwanden. Durch romantische Wildnisse stieg die Strasse bergauf und bergab, und schäumende Bäche stürzten sich daneben durch rauhe Schluchten dem Waikato zu. Stumpfe Kegelberge wechselten mit kulissenartigen Bergrücken. Herrliche Fernsichten, wie von einem Maler der klassischen Schule komponirt, thaten sich auf. Dann ging es wieder über eine dürre Grasstoppelebene, in deren Hintergrund sanft ansteigende Hügel mit Gruppen weisslicher Felsblöcke besäet waren, so dass sie Dörfer zu tragen täuschten. Der Leichenstein eines Postpferdes stand hier an der Strasse mit einer Inschrift, welche das treu in seinem Berufe vom Tod ereilte Thier verewigte. Ausser diesem Dokument der höheren Philozoie und der Strasse ist weit und breit nichts Menschliches zu entdecken. Selbst der Telegraphendraht hat uns verlassen und andere Wege eingeschlagen. Keine Vogelstimme lässt sich vernehmen. Ueberall Grabesruhe.
In einem echten Maoridorf, mitten zwischen zackigen Felsen, durch welche in der Tiefe der Waikato tost, machten wir Mittag und wechselten die Pferde. Selbst der Stationswirth, ein Weisser, und seine weisse Gattin, eine junge sanfte Blondine, wohnen hier nur in Hütten aus Flechtwerk. Die Eingeborenen werden jetzt zahlreicher, lumpiger und malerischer, je mehr es nach dem wärmeren Norden geht, ebenso wie bei uns, wenn man über die Alpen gegen Italien zieht. Bis jetzt hatte ich ausser dem blassbeinigen Mister Jack noch keinen echten Maori gesehen. An allen Einschnitten der Strasse sind Maorinamen in englischen Lettern und Maorizeichnungen von nicht geringem Verständniss in den weichen Sandstein gekratzt.
Auf einer Höhe biegt der Weg um die Ecke, der See Rotorua erscheint und vor ihm eine dampfende Tiefebene. Der ganze schwammige Boden ist hier unterwühlt von kochenden Quellen. Schnurgerade durchschneidet die erhöhte Strasse den mit Manukagebüsch besetzten Sumpf, aus dem es links und rechts überall unheimlich brodelt und qualmt und dampft. Was ich in Taupo gesehen, war nichts gegen diesen Anblick, der meine kühnsten Erwartungen weit übertraf.
Die Dunkelheit senkte sich hernieder, als wir in Ohinemutu ankamen, umringt von einem lärmenden Gesindel fröhlicher Maoris, von denen kein einziger eine Hose anhatte, was mir überaus imponirte.
VIII
OHINEMUTU UND ROTOMAHANA
Die heissen Quellen und ihre Verwendung. Ein Badeort in des Wortes verwegenster Bedeutung. Legende von der schönen Hinemoa. Maorialterthümer. Ausflug nach Wakarewarewa. Das Labyrinth der Schmutzvulkane. Die Geyser. Der missglückte Haka. Ein interessantes liederliches Kleeblatt. Ausflug nach Rotomahana. Wairoa und seine internationalen Wegelagerer. Stürmische Kanuufahrt über den Tarawera. Streitigkeiten mit den Maoris. Ueberall kocht das Verderben. Ungemüthliche Nacht. Tetarata und Otukapuarangi. Mister Davis und seine Singschule.
Dieses Ohinemutu ist nicht nur der interessanteste Punkt von ganz Neuseeland, sondern auch einer der interessantesten Punkte der ganzen Erde.
Ohinemutu liegt etwas nördlich vom Zentrum der Nordinsel am südlichen Ufer des Sees Rotorua. Die Berge treten hier in einen weiten Kreis zurück. Sumpfige Ebenen, von welchen wir gestern den breitesten Theil durchfahren haben, umgeben den See und lassen auf eine ehemals grössere Ausdehnung desselben schliessen. Soweit das Auge blicken kann, qualmt zwischen Farnkraut und Manukagebüsch weissglänzender Dampf empor, und an kühleren Morgen ist die ganze Ebene mit Dampf überlagert. Allenthalben entspringen kochende Quellen, kochende Schlammpfützen und Schlammvulkane.
Doch nicht blos wegen seines kochenden Untergrunds ist Ohinemutu so hoch interessant, sondern auch wegen seiner Maoribevölkerung, die dort, etwa 300 Köpfe stark, noch viel von den alten Sitten beibehalten hat.
Nahe dem Ufer steigt ein isolirter, kaum 25 Meter hoher Hügel, mit europäischen Weidenbäumen bepflanzt, aus dem heissen Sumpf, und an diesem, dem See zugewendet, baut sich die Ortschaft auf. Am Anfang und am Ende einer sehr primitiven Strasse, die sich oben entlang zieht, sind zwei gute Hotels für Touristen und in der Mitte ein Kaufhaus mit einigen Nebengebäuden. Dies ist das weisse Viertel. Alles übrige ist Maori und besteht aus unregelmässig zerstreuten umzäunten Hütten, zwischen denen sich schmale Pfade hindurchschlängeln. Etwas erhöht thront auf einem Ausläufer des Hügels das Versammlungsgebäude der Gemeinde, ein langgestreckter Holzbau, dessen Dach beiderseits fast den Boden berührt. An der Frontseite sind unter dem vorspringenden Giebel der Eingang und zwei hohe Glasfenster. Alles innen und aussen ist mit schönen stylvollen Holzschnitzereien verziert, und an einem Ornament der Dachränder baumelt eine Glocke.
Die Hütten sind niedrig, mit Wänden aus Flechtwerk und Dächern aus Stroh und sehen sehr formlos und ruppig aus, die zum Wohnen bestimmten wenigstens. Die Vorrathshäuschen jedoch, welche in keiner Umzäunung fehlen, sind zierlicher und von Holz, ruhen auf drei Pfosten ein Meter hoch über der Erde und erinnern durch ihre flachen Dächer an grosse Taubenschläge im Schweizerstyl. Eine geschnitzte Figur schmückt den Giebel, und Schnitzereien verkleiden die Dachränder. An den Thüren hängen anachronistischer Weise europäische Vorhängeschlösser.
Die innere Einrichtung der Wohnhütten ist von der grössten Einfachheit und ebenso rauh und unansehnlich wie das Aeussere derselben. In den Strohwänden stecken ein paar Zahnbürsten, ein Kamm, ein Spiegel, eine Axt, eine Flinte und sonstige Gegenstände mannigfaltigster Art, selten in ordentlichem, meistens in halbzerbrochenem, lotterigem Zustand. Unter dem Dach hängen etliche Pageien (kurze löffelartige Ruder) und einige Bretter, auf welche russige Töpfe gestülpt sind. Den Boden bildet die nackte Erde, und unmittelbar auf dieser liegen ohne Erhöhung in den Ecken die Betten, umschlossen von einem Holzrahmen und aus dicken Polstern elastischen Farnkrautes und wollenen Decken bestehend. Bei Reicheren findet man wohl auch Weisszeug, Bettlaken und Federkissen. Bei diesen herrscht ein höherer Grad von Reinlichkeit, und die wollenen Decken zeichnen sich durch grellere Farben und buntere Muster aus. In der Mitte brennt ein Feuer, welches jedoch weniger zum Kochen als zur Erwärmung dient, da zum Kochen die kochenden Quellen viel bequemer zur Hand sind.
Die unterirdische Hitze wird von den Bewohnern in dreifacher Weise ausgebeutet. Grosse Steinfliesen bedecken hie und da vor und in den Hütten den Boden, durch unter ihnen emportauchende heisse Quellen erwärmt, und auf diesen natürlichen Oefen hocken den ganzen Tag alte Weiber und Männer. Andere Quellen sind sauber mit Blöcken eingefasst und zum Kochen bestimmt. Wieder andere, weniger heisse dienen zum Baden.
Im Sommer ist auch der See bis weit hinaus genügend erwärmt um Stunden lang darin verweilen zu können. Da wir eben Juni, also Winter hatten, war dieses Vergnügen, abgesehen von den vielen zerstreuten Badetümpeln, auf eine 20 Schritt breite und 100 Schritt lange Bucht beschränkt, welche durch zwei vorspringende Landzungen gebildet ins Dorf hineinragt.
Von allen drei Seiten fliessen heisse Quellen herab, aus dem Grunde tauchen heisse Quellen auf, und über dem inneren Ende gähnt, von steilen zerbröckelten Felswänden eingefasst, ein brodelnder Kessel, ein alter Geyser, in dem es beständig kocht und stampft und wallt und hämmert, zwischen wucherndem Farnkraut Verderben drohend empor, gerade gross genug, um etwa fünfzig Menschen auf einmal darin zu kochen. Hier hinein sollen nämlich in der guten alten Zeit die Gefangenen genöthigt worden sein, um zum festlichen Schmause zu dienen sobald sie gar waren – eine Sage, die jedoch nur im Munde der Europäer kursirt, und von der die Maoris selbst nichts wissen wollen.
Jene kleine Bucht ist das famoseste warme Schwimmbad, welches menschliche Ueppigkeit sich wünschen kann, und war damals der allgemeine Zusammenkunfts- und Vergnügungsplatz der Europäer männlichen und der Maoris beiderlei Geschlechts. Namentlich an heiteren Abenden ehe es dunkel wurde, versammelte sich hier Alles was zur Gesellschaft von Ohinemutu gehörte, und gleichwie man in Italien nach Sonnenuntergang promeniren geht, so ging man in Ohinemutu ins warme Wasser, schwamm einigemal hin und her, und setzte sich dann in den schönen warmen und weichen Schlamm der seichteren Stellen, so dass nur der Kopf aus dem Wasser guckte, und plauderte ein paar Stunden im Kreise brauner Herren und Damen. Von einer Art Bekleidung war dort natürlich nicht die geringste Rede, und über einen alten Herrn, der einst in einer Badehose auftrat, wird berichtet, dass er dadurch nur die grösste Heiterkeit und Neugierde der Eingeborenen auf sich gezogen habe, welche nicht eher ruhten als bis sie sich durch Augenschein überzeugten, was denn eigentlich hinter der Badehose Geheimnissvolles verborgen sei. Diese Ursprünglichkeit der Sitten und diese klassische Nudität wirkt doppelt überraschend mitten in einem Lande, in welchem der bibelfromme und bis zum Unerträglichen anständige Brite neun Zehntel der Bevölkerung bildet.
Die Weiber und Mädchen beobachten in der Regel die grösste Sorgfalt, beim Hinein- und Herausgehen so wenig als möglich von ihren Reizen zu exponiren, und jenes Titelbild, welches Lieutenant Meade seinem Buch über Neuseeland voranschickt, auf welchem er badende Nymphen von antiker Formenschönheit und mehr als europäischer Lilienweisse unter dem kochenden Sprühregen eines gewaltigen Geysers sich amüsiren und produziren lässt, fand ich niemals verwirklicht. Nur alte Vetteln geniren sich weniger und zeigen sich oft in der ganzen Länge ihrer nicht sehr aphroditischen Leiber. Maorigreisinnen sind gewöhnlich über alle Massen hässlich. Sie scheeren sich das Kopfhaar ganz kurz wie abrasirt, und die kahlen Schädel mit den hohlwangigen und hohläugigen braunen Gesichtern und die mageren ausgemergelten Körper machen den Eindruck von Todtengerippen.
Es war mir auffallend, dass ich im Bade niemals einen gröberen Verstoss gegen die Dezenz zwischen beiden Geschlechtern, niemals eine Aeusserung erotischer Triebe wahrnahm, obwohl doch die Anschauungen der Maoris in diesem Punkt sehr liberal sind und obwohl die Anwesenheit so vieler einzelner Mädchen in Ohinemutu nur aus einer gewissen mit dem Fremdenverkehr zusammenhängenden kosmopolitischen Erwerbsquelle erklärt werden kann.
Ich lade übrigens hiermit den Leser ein, mit mir ein derartiges Bad zu geniessen.
Wer nichts zu thun hat, was bei den Bewohnern von Ohinemutu so ziemlich ausnahmslos der Fall zu sein scheint, badet nicht selten dreimal des Tages, nämlich gleich nach dem Aufstehen, Abends gegen Sonnenuntergang und Nachts um 11 oder 12 Uhr ehe man ins Bett geht, und oft auch noch später wenn man vielleicht nicht schlafen kann. Die beliebteste Zeit ist der späte Nachmittag. Es ist dann am vollsten und lebhaftesten im Wasser und das schöne Geschlecht am zahlreichsten vertreten.
Schon ehe wir vom Hotel weggehen, wird es gut sein, uns der überflüssigsten Kleidungsstücke zu entledigen, da unten beim Bade nicht viel Raum und Bequemlichkeit zum Aus- und Ankleiden ist, und den Rock, die Weste und den gestärkten Halskragen zu Hause zu lassen. Man kümmert sich hier wenig um alle diese ängstlichen Kleinigkeiten, und würden wir einen längeren Aufenthalt nehmen, wer weiss ob wir es nicht vielleicht ebenso machten, wie die ansässigen Weissen, welche auch die Beinkleider zu Hause lassen, wenn sie baden gehen, und nur in Hemd und Schuhen, nach Maoriart einen bis zu den Knieen reichenden Schal um die Hüften geschlungen und einen faltigen Schlapphut mit Fasanenfeder auf dem Kopf, erscheinen. Dieses leichte Kostüm, das ich zuerst an Mister Jack the Guide of Taupo bewundern musste, hat auch in dem milderen Ohinemutu viel mehr Berechtigung als in dem kalten hochgelegenen Tapuaeharuru.
Die Sonne wird bald hinter die westlichen Berge tauchen und giesst ihr strahlendes Licht mild über den glatten Spiegel des Sees, in dessen Mitte die kuppenförmige Insel Mokoia liegt, so dass wir nicht umhin können öfters bewundernd stehen zu bleiben, während wir den Hügel hinabsteigen. An Mokoia knüpft sich eine poesievolle Maorilegende, welche ich in den verschiedenen Neuseeländischen Reisehandbüchern in so vielen abgeschmackten Versionen gelesen habe, dass es mir beinahe unmöglich ist, sie kurz wiederzugeben.
Hinemoa, das ist »ein Mädchen (Hine) dem grossen Vogel Moa vergleichbar«, war die schönste Maoriprinzessin weit und breit im Lande, und Tutanekai war der schönste Prinz. Tutanekai wohnte auf Mokoia und Hinemoa in Ohinemutu. Sie liebten sich, aber die Väter, mächtige Häuptlinge, hassten sich und wollten nichts davon wissen. Alle Kanuus hüben und drüben wurden strenge bewacht, damit die beiden Liebenden nicht zu einander kommen konnten. Doch ihre Liebe wurde dadurch nur um so heftiger. Eines Abends als es bereits dunkel war, sass die schmachtende Hinemoa vor ihrer Hütte auf einem warmen Stein und seufzte nach der Insel hinüber. Da trug ein sanfter Zephyr die Töne von Tutanekais Flöte an ihr Ohr. Eine mächtige Sehnsucht ergriff sie. Lautlos eilte sie an den See hinab und schwamm nach Mokoia, wo sie zu Tode erschöpft ankam. Selbstverständlich legte sie sich sofort in einen warmen Tümpel am Ufer um sich zu erholen und zu überlegen, wie sie dem Geliebten ihre Nähe kündigen möchte ohne von einem Anderen entdeckt zu werden. Der Zufall und weibliche Tücke halfen ihr aus der Verlegenheit. Ein Sklave Tutanekais kam herab, um Wasser zu holen. Gleich einem bösen Kobold warf sie sich heulend auf den Ahnungslosen, entriss ihm das Gefäss und erschreckte ihn dermassen, dass er bebend von dannen floh, seinem Herrn von dem nächtlichen Spuk zu berichten. Dieser, ein echter Held, kommt sofort Rache schnaubend gelaufen und – findet seine Hinemoa. Nun hatten sie sich und ehelichten sich. Die Väter verziehen nach einiger Zeit, und Hinemoa und Tutanekai lebten lange und glücklich miteinander.
Es ist bereits kühl, und der Dampf der heissen Quellen, welcher bisher, von der höher stehenden Sonne aufgelöst, kaum sichtbar war, ist nun so dicht, dass er wie ein deutscher Herbstnebel über den Vertiefungen des Dorfes lagert. Ueberall, rechts und links, vor uns und hinter uns brodelt es in hundert grösseren und kleineren Löchern. Ueberall steigen Dampfsäulen empor, heisse dampfende Wasserfäden, geschäftig dem See zueilend, kreuzen unseren Pfad, eine Dampfwolke verhüllt ihn auch wohl auf Augenblicke, und wir müssen dann stehen bleiben und warten, bis wir wieder sehen können. Denn ein Fehltritt ist gefährlich und würde vielleicht eine schlimme Verbrühung des Fusses im Gefolge haben.
Das geheimnissvolle Brodeln ringsum, meist unsichtbar, da eine ewig von schwefelig riechendem Dampf bethaute kränkliche Gras- und Farnkrautvegetation die Löcher verbirgt, macht einen befremdenden, unheimlichen Eindruck. Wir stehen über einem kochenden Sumpf, den nur eine dünne Kruste fester Erde bedeckt. Und über diesem kochenden Sumpf lebt ein ganzes Dorf und freut sich des heissen Bodens!
Hier kauern einige Gestalten vor ihrer Strohhütte auf warmen Steinfliesen, in steife wollene Decken gehüllt, schwarzgeräucherte Thonpfeifenstummel im Munde. Manchmal ziehen sie die Decken ganz über den Kopf, so dass man nur eine Gesellschaft formloser Bündel sieht, aus welchen oben Pfeifenstummel herausgucken. Dort in einer heftig dampfenden sprudelnden Quelle, deren saubere Einfassung andeutet, dass sie zum Kochen dient, hängen Körbchen mit Kartoffeln, Krebsen und Süsswassermuscheln an quer darüber gelegten Stangen, und geschwätzige Gruppen von Weibern sitzen herum und beobachten den Prozess der Zubereitung mit sichtlichem Behagen, während sie sich die Zeit mit Rauchen, Schreien und Lachen vertreiben. Wir selbst werden sofort die Zielscheibe ihrer Witze, indem wir vorüberwandeln, und »Pakeha« (Europäer) ist das dritte Wort, was wir hören. Speisereste liegen zu Haufen geschüttet, und wohlgenährte schwarzborstige Schweine schnüffeln und grunzen wohlgefällig von einem zum anderen.
Hinter jenem Gebüsch sind mehrere Badetümpel. In jedem sitzen etliche Dutzend brauner Kinder eng zusammengedrängt, so dass man kaum begreift, wie sie sich noch regen können, prügeln und spritzen und balgen sich, purzeln über einander und verüben ein Geschrei, welches weithin das Dorf durchgellt. »Mat mat« betteln sie um unsere Zigarren, die sie sofort in den Mund stecken, wenn nicht die Mutter kommt, sie für sich zu beanspruchen. »Mat« ist das maorisirte englische »Match«, in übertragener Bedeutung auch auf den verwandten Begriff brennender Zigarren angewendet.
So ein kleiner Junge von Ohinemutu führt ein sehr ungebundenes Leben. Den ganzen Tag läuft er nackt umher, stiehlt sich hier eine Kartoffel, dort eine Muschel oder einen Krebs und setzt sich von Zeit zu Zeit, um sich zu wärmen, ins warme Wasser.
Aber auch die Erwachsenen lieben diese Wohlthat. Man mag zu irgend einer Zeit durch Ohinemutu gehen, es sitzt fast immer die halbe Einwohnerschaft links und rechts vom Wege im Bad. Ohinemutu ist ein Badeort in des Wortes verwegenster Bedeutung, und den ausgedehnten Badegelegenheiten verdankt es nicht blos seine Maoribevölkerung, welche gegenwärtig nicht mehr autochthon, sondern von allen Seiten herbeigewandert ist, weil man hier einen beträchtlichen Theil des Daseins im warmen Wasser zubringen und Kartoffel kochen kann, ohne Feuer zu machen, sondern auch zahlreiche Touristen und einige Kurgäste.
Unser Schwimmbad ist noch ziemlich leer. Einige Jungen vergnügen sich damit, einander zu tauchen und von einem niedrigen Felsen herab ins heisse Wasser zu springen, und ein altes runzeliges Weib mit kahlgeschorenem Kopf hockt nackt am Ufer und gafft uns affenartig entgegen.
Wir suchen eine passende Stelle zum Auskleiden auf dem fortwährend bethauten und feuchten Rasen, wobei wir wieder Acht haben müssen, die vielen heissen Löcher zu meiden, welche allenthalben unter Farngestrüpp verborgen sind und ihre Anwesenheit nur durch das brodelnde Geräusch verrathen. Es kostet etwas Ueberwindung in der kühlen Winterluft sich zu entblössen. Zähneklappernd kriechen wir über das nasskalte Gras hinab, da die vielen spitzen Steine ein freies Auftreten verbieten, und erschrecken über die Hitze des Wassers sobald wir es mit dem Fusse berühren. Aber wir gewöhnen uns an diesen Gegensatz, wagen uns immer tiefer hinein, trotzdem uns oft die Hitze den Athem stockt, und fühlen uns nach längerem Aufenthalt ganz behaglich in dem warmen Medium.
Die Temperatur wechselt jedoch beständig. Kältere und heissere Strömungen von Quellen, die aus dem Grunde kommen, kreuzen sich nach allen Richtungen, und oft fühlen wir uns attakirt von einer so brennenden Hitze, dass wir schleunig die Flucht ergreifen. Als ich einmal mit dem Thermometer ins Bad ging, schwankte an ein und demselben Punkte die Quecksilbersäule ohne zur Ruhe zu gelangen fortwährend zwischen 37 und 44 Zentigraden auf und nieder bei einer Lufttemperatur von 10 Zentigraden. Weiter gegen den See zu wird das Wasser kälter, und näher dem inneren Ende der Bucht und dem Geyserkessel, da wo die Maoris noch mit dem grössten Vergnügen kopfüber hineinspringen, ist es so heiss, dass ein normaler Europäer sich dieser Stelle nur allmälig nähern kann.
Der Boden ist Schlamm, durch welchen weiche Felsenspitzen emporstehen. Ein etwa drei Meter tiefes Loch, 20 Schritt lang und 10 Schritt breit, gewährt die Möglichkeit sich im Schwimmen und Tauchen zu üben, was jedoch manchmal unangenehm ist, da heftigere Bewegungen das Gefühl der Hitze vermehren.
Haben wir das Bad genügend nach allen Dimensionen explorirt, so suchen wir eine seichtere Stelle, setzen uns und erwarten die Ankunft der Damen und der übrigen Gesellschaft. Ganz Ohinemutu ist voll von Lärm und Lustbarkeit, und aus allen Hütten und hinter jedem Gebüsch erschallen laut lachende und schreiende Stimmen. Dampfwolken ziehen langsam dahin die Szenerie verschleiernd und wieder enthüllend. Die Dämmerung senkt sich hernieder, die ersten Sterne beginnen zu funkeln, und eine zauberhafte Stimmung bemächtigt sich unser, die wir im schönen weichen Grundschlamm sitzen und bis zum Kinn von warmem Wasser umspült sind. Man darf sich übrigens nicht zu tief in den Schlamm eingraben, sonst kann es passiren, dass plötzlich ein heisser Wasserfaden sehr unangenehm überraschend von unten hervorbricht. Für gewöhnlich sind dem Gesetz der Schwere entsprechend die unteren Schichten nicht so warm wie die oberen, und man mildert die brennende Hitze der oberen dadurch, dass man mit den Händen kühleres Wasser von unten emporfächelt.
Um die nächste Ecke biegt ein braunes Mädchen mit einem Handtuch über der Schulter, bleibt stehen, lächelt uns grüssend zu und besinnt sich und kokettirt ein wenig, als ob sie sich schämte, vor uns ins Bad zu steigen. Gleich darauf kommen drei oder vier andere Mädchen mit Handtüchern und machen es ebenso. Auch sie besinnen sich und kokettiren ein wenig. Aber nicht lange, und ehe sichs unsere Blicke versehen, sind sie im Wasser und schwimmen zu uns heran. Ein Schal und ein Hemd ist ihre ganze Bekleidung. Mit einer rühmenswerthen Geschicklichkeit wissen sie das letztere gerade nur so weit zu lüften als nothwendig ist, je tiefer sie sich ins Wasser begeben, und zuletzt rasch über den Kopf zu streifen und aufs Ufer zurück zu werfen ohne es nass gemacht zu haben.
Manchmal behalten sie ihr Hemd am Leibe um es auf diese Weise, das Nützliche mit dem Angenehmen vereinigend, zu waschen und stürzen sich mit einem kühnen Salto vom Felsen herab. Sie schwimmen und tauchen vorzüglich, und ich kenne eine braune Schöne von vielleicht 16 Jahren, deren Name Rahia heisst und auf ihrem Oberarm in römischen Lettern eintätowirt ist, welche damals täglich mit weissen und braunen Männern um die Wette schwamm und jedesmal den Sieg davontrug.
Rahia ist auch anthropologisch nicht uninteressant. Denn sie besitzt statt schwarzer dunkelbraune Haare mit einem Stich ins Röthliche, während ihre Haut denselben angenehm satten Ton, wie die der Genossinnen zur Schau trägt. Solche Abweichungen in der Farbe des Hauptschmuckes sind übrigens nicht gar selten, und bei zwei anderen Mädchen bemerkte ich einmal sogar hellere und dunklere Partieen neben einander auf demselben Kopfe.
Rahia ist nicht hübsch, wenn man ihr auf dem Trockenen begegnet, wo sie immer ein sehr ernsthaftes Gesicht macht. Im Wasser aber wird sie reizend durch ihre Geschmeidigkeit und die lebhafte Freude, die ihr die Ueberlegenheit im Schwimmen und Tauchen sichtlich bereitet. Sie weiss auch alle möglichen Kunststücke zu machen. Erst stürzt sie sich einigemal im durchnässten Hemd, welches sich verrätherisch an ihre jugendlich runden Formen schmiegt, von oben herab ins heisse Wasser. Dann formt sie grosse Luftblasen mit ihrer Gewandung und lässt sich ruhig auf dem Rücken liegend wegtreiben, taucht unter und nach wenigen Sekunden wieder auf gerade da wo man sie am wenigsten vermuthet. Wir werden von hinten mit Schlamm beworfen und wenn wir uns umdrehen ist niemand zu entdecken. Ein zweites Schlammgeschoss besudelt unseren Nacken aus entgegengesetzter Richtung. Unter den überhängenden Farnen des Ufers aber taucht Rahia empor und sieht uns so gleichgültig an als ob nichts vorgefallen wäre. Denn sie ist die Thäterin, wofür sie auch tüchtig angespritzt und getaucht wird.
Das Bad füllt sich mit Gästen. Männer jeglichen Alters, Weiber mit Säuglingen auf dem Arme oder in einem Sack um die Schultern gehängt, Mädchen und Jünglinge setzen sich nebeneinander und klatschen.
Ihre Konversation scheint sich häufig mit uns und unseren bleichen Gliedmassen zu beschäftigen, wie aus ihren Mienen und dem immer wiederkehrenden Wort »Pakeha« hervorgeht. Sie fühlen sich offenbar sehr geschmeichelt, wenn wir uns zu ihnen setzen, und will man einer Dame seine ganz besondere Aufmerksamkeit erweisen, so nimmt man ihr ohne viel Worte zu verlieren die nie fehlende Pfeife aus dem Mund, raucht selbst einige Züge daraus und steckt sie dann wieder an ihren Platz zurück.
Kinder und Jungen machen einen betäubenden Lärm, und auch sie möchten gern mit uns anbinden. Forschend welchen Geistes wir seien, nähern sie sich, und haben sie erst bemerkt, dass man ihnen freundlich gesinnt ist, so hat man auch gleich die ganze Schaar auf dem Halse, und jeder der kleinen braunen Frösche bemüht sich an uns emporzuklettern und auf uns zu reiten. »Kopai, kopai« (gut) suchen sie uns zu schmeicheln und um Geduld zu bitten. Unsere Armmuskulatur erregt grosses Interesse bei Alt und Jung, und sind wir im Besitze eines nur halbwegs anständigen Biceps, so können wir ihn nicht oft genug kontrahiren und unter Ausrufen der Bewunderung befühlen lassen. Nur hiedurch wurde ich darauf aufmerksam, wie weich und unausgebildet die Arme auch der robustesten Maoris sind, ganz im Gegensatz zu ihren ausserordentlich starken Unterextremitäten.
Nachdem wir auf solche Weise etwa eine Stunde im Bade zugebracht, verabschieden wir uns, indem wir den Nächstsitzenden die Hände reichen, und begeben uns wieder aufs Trockene. Der Gedanke in die frostige Luft hinauszusteigen hat etwas Abschreckendes. Aber wir sind so mit Wärme gesättigt, dass wir die Kühlung sehr angenehm empfinden, und die naheliegende Befürchtung eines Schnupfens oder eines Rheumatismus soll sich niemals erfüllen.
Die östliche von den beiden Landzungen, welche die eben beschriebene Badebucht bilden, ist eine höchst interessante Fundstätte von Maorialterthümern. Dort wären noch viele werthvolle Dinge für unsere Museen zu retten. Ehemals war sie bewohnt und ein Theil der Ortschaft. Jetzt ist sie »tabu« erklärt, geheiligt, verpönt oder wie man dieses allgemein polynesische Wort übersetzen will. Wahrscheinlich deshalb, weil die Wellenbewegung des Sees, unterstützt von der Wirkung der heissen Quellen, welche den ganzen Boden durchsetzen, sie allmälich hinwegspült. Erst ganz kürzlich sollen in einer stürmischen Nacht mehrere Hütten untergraben und verschlungen worden sein. Hie und da ragen noch vier Pfähle aus dem Wasser.
Es ist von den Maoris verboten, den Platz zu betreten. Ich habe dies gleichwohl mehrmals unbehelligt gethan. Zwei oder drei Hütten stehen noch unversehrt so da wie der letzte Bewohner sie verlassen hat, als er starb. Schwere Bohlen sind vor die verandaartige Frontseite gelegt und verrammeln den Eingang. Lüftet man sie um ins Innere zu blicken, so sieht man alle möglichen Geräthe herumliegen. Wurflanzen und Beile, Kochkessel und Trinkgeschirre alten und modernen Ursprungs sind auf den Boden gestreut oder hängen an der Wand. In einer Hütte sah ich sogar noch zwei Zahnbürsten und einen Kamm in dem Schilfgeflecht stecken. Alles ist tabu, und kein Mensch wagt diese Gegenstände zu berühren.
Aussen herum liegt ein ganzer Trödelmarkt von Ueberresten früherer Zeiten. Zerschlagene eiserne Töpfe, verrostete Flintenläufe, die Trümmer von Holzschnitzereien, Giebelverzierungen, Fratzenbilder, ornamentale Fensterläden und hundert andere Dinge. Auch glaubte ich unter dem Schutt ein Stück von einer grossen Holzschüssel mit einem Fratzengesicht als Handhabe von jener Art, wie sie einst für Menschenfleisch gebraucht wurden, gesehen zu haben. Alle die Schnitzereien zeigten das gröbere Gepräge jener früheren Zeit, als noch mit Muscheln statt mit importirten Messern gearbeitet wurde.
Nahe der Spitze stehen am Rande des Sees, von einem Phormiumgebüsch umgeben, fünf mannshohe Bildsäulen nebeneinander, und auch oben mitten im Dorf findet man deren vereinzelte. Es sind die Konterfeis besonders erlauchter Häuptlinge und Häuptlingsfrauen, Gesichter und Genitalien unförmlich gross und sehr komisch stylisirt.
An den meisten Speicherhäuschen ist vorne die Giebelspitze mit einer festgebundenen, etwa halbmeterlangen geschnitzten Menschenfigur geziert. Einige sind schon locker geworden und drohen zu fallen, andere liegen bereits auf der Erde und vermodern. Kein Mensch, auch die Regierung nicht, scheint sich um diese Schätze zu kümmern, und so stehen sie denn so lange bis sie eines schönen Tages der Wind umwirft und der vollständigen Verrottung preisgiebt. Ganz nahe dem Schwimmbad führt ein Steg über eine tiefere Schlucht, die mit dem stampfenden Kessel zusammenhängt. Diesen Steg bilden Bruchstücke eines alten Kriegskanuus, deren obere konvexe Seiten mit Basreliefs von rudernden Gestalten geschmückt sind.