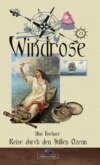Kitabı oku: «Reise durch den Stillen Ozean», sayfa 12
Nach etwa zwei Stunden näherten wir uns dem östlichen Ende des Sees, wo eine Bucht in südlicher Richtung sich zu einem Bache verjüngt, der aus dem Rotomahana herabkommt. An einer Stelle ist ein schönes Echo, welches der Maorisage zufolge den in den schroffen Wänden des Ufers hausenden Dämonen seinen Ursprung verdankt. Früher musste man hier ein kleines Opfer leisten, indem man Geld, Zigarren oder Tabak auf einen niedrigen Felsblock legte. Jetzt hatte sich diese alte Sitte so weit abgeschwächt, dass es genügte, ein Stückchen Farnkraut von unserer Streu im Vorüberfahren darauf zu werfen.
Am Eingang zu dem Bach von Rotomahana, ganz nahe dem Ziele, gabs abermals Streit. Es war spät geworden. Unsere Maoris wollten nicht mehr weiter gehen und in ein paar Hütten neben einer heissen Quelle bei guten Freunden übernachten.
Es war ihnen sichtlich darum zu thun, uns möglichst viel Zeit und damit auch möglichst viel Geld für sich abzugewinnen. Im Hintergrunde der buschigen Berge dampfte es gewaltig und vielversprechend empor, und das Wasser war bereits lauwarm, weshalb wir schon eine halbe Stunde früher unsere Trinkgefässe gefüllt hatten.
Wir bestanden darauf, noch heute an Ort und Stelle zu gelangen, und wenn wir auch das schwerere Gepäck bis morgen zurücklassen mussten. Die Maoris gehorchten wider Erwarten, wir stiegen aus und setzten die Reise zu Fusse weiter, während das Kanuu mit nur vier Mann den Bach hinauffahren sollte.
Aber ganz ohne Prellerei konnte es doch nicht abgehen. Der schmale Pfad im Manukagestrüpp setzt plötzlich über den tiefen Bach. Unsere halbnackten Führer wateten einfach durch, indem sie die Hüftenplaids etwas lüpften. Wir armen Europäer waren nicht so praktisch gekleidet und standen verlegen am Rande, während jene sich höhnisch erboten, für einen Shilling uns hinüberzutragen. Wir waren entrüstet ob dieser Frechheit. Sie waren unsere gemietheten Diener, jeder von den Kerls kostete uns per Tag fünf Shilling und die Verpflegung, und nun wagten sie noch uns extra zu brandschatzen. Gerne hätten wir uns der Stiefel und sonstiger Anhängsel entledigt, allein wir hätten sie sicher wegen ihrer Feuchtigkeit nicht wieder anlegen können. Wir wollten um keinen Preis nachgeben und beschlossen, auf das Kanuu zu warten. Drüben zündeten sich die streikenden Maoris ein Feuer an. Wir versuchten dasselbe herüben, aber nicht ein einziges Zündhölzchen war trocken.
Die Kälte wurde ungemüthlich und wir wurden weich und gewährten den Shilling. Die Maoris kamen und luden uns auf den Rücken. Indess, für mich war heute ein Unglückstag. Mein Bursche glitt aus, und ich lag abermals im Wasser. Dass er dennoch seinen einmal versprochenen Shilling erhielt, schien ihn sehr zu rühren, und von nun an war er die Aufmerksamkeit selbst.
Jetzt galt es eine der schwierigsten und gefährlichsten und schauerlichsten Partieen, die ich jemals gemacht, und wir bedurften jetzt doppelt einer ortskundigen Führung. Es war dunkel in dem Manukadickicht geworden. Die Maoris nahmen uns bei den Händen und zogen uns durch Dick und Dünn. Allenthalben begann es wieder zu brodeln und zu qualmen. Aus schwarzen Abgründen unten stampfte und hämmerte es drohend herauf, heisses Wasser spritzte uns ins Gesicht, und Dampfwolken benahmen jeglichen Blick, während wir, festgehalten und geleitet von den starken Armen der Wilden und willenlos ganz in ihre Gewalt gegeben, über morsche Mauerkanten und schlüpfrige Lehmabhänge vorwärtsstrebten, links und rechts, vor uns und hinter uns das Verderben. Ein einziger Fehltritt und wir kochten in einem der siedenden Kessel.
Durch das Manukagebüsch schimmerte eine weisse Fläche, es lichtete sich, und wir waren am Fusse der berühmten, herrlichen Sinterterrasse Tetarata. Wir schritten über ihren glatten Spiegel den jenseits errichteten Hütten zu, in denen wir übernachten wollten. Rechts dampfte der kleine See Rotomahana. Stimmen von Wasservögeln, deren nächtliche Ruhe wir störten, liessen sich in seinem Schilf vernehmen.
Auch rings um die Hütten sind kochende Quellen und Tümpel zum Baden. Ich beeilte mich, aus den nassen Kleidern und aus der kalten Luft ins warme Wasser zu steigen. Während ich dort das sauer verdiente Abendbrot verzehrte, Schokolade, Eier und Kartoffeln, in irgend einer der vielen natürlichen Kochgelegenheiten zubereitet, trockneten unterdessen meine Kleider auf geheizten Steinfliesen. Wahrscheinlich würde ich auch auf unserem Farnlager ausgezeichnet geschlafen haben, wenn nicht eine kleine Art Stechfliegen uns belästigt, wenn nicht eine Kompagnie Ratten rücksichtslos und ungestüm um den Kartoffelsack der Photographen, auf dem mein müdes Haupt ruhte, hin und her geraschelt, und wenn nicht die Maoris nebenan fortwährend geplaudert hätten.
Früh am Morgen erhoben wir uns, zuerst die gestern in der Dunkelheit passirte weisse Terrasse zu besichtigen. Sie lag von den Hütten nur durch einen niedrigen mit Farn und Manuka bewachsenen Vorsprung getrennt. Wenige Schritte, und das grösste Wunder Neuseelands öffnete sich unseren Augen.
Der kleine vielgebuchtete See Rotomahana, dessen trübe Fläche und struppige dampfende Ufer jeglichen Reizes entbehren, ist in ein enges Thal gebettet, dessen Böschungen allenthalben von kochenden Quellen, kochenden Pfützen und Schlammvulkanen durchwühlt sind. Mitten in diesem Wirrsal von siedendem Schmutz hat die Natur bizarrer Weise zwei so ätherische, mährchenhafte Gebilde aufgebaut, wie vielleicht kein drittes mehr auf der Erde zu finden ist. Einander schräg gegenüberliegend, ungefähr nordöstlich und südwestlich vom See fliessen zwei breite, erstarrte Ströme einer unendlich zart und weichgefärbten Substanz von oben herab, die zwei Kieselsinterterrassen Tetarata und Otukapuarangi. Der Form nach gleichen sie beide gefrorenen Kaskaden, die in einer Höhe von etwa 25 Meter aus dem Berge hervorquellen und in sanften Staffeln sich in den See ergiessen, unten ausgebreitet zu einem flachen etwa 100 Meter betragenden Bogen.
Man steigt, theilweise in einer dünnen spiegelnden Schicht lauen Wassers watend, über die Staffeln empor. Die zarten Krystallblumen, welche den Boden bedecken, knirschen unter den Füssen wie Reif oder hartgefrorener Schnee.
Oben gähnt ein dampfender Kessel, der ab und zu aufwallen soll, von einer Platform umgeben. In jede der vielen regellos gehäuften Staffeln sind Schalen gehöhlt, welche Wasser von allen Temperaturen enthalten, je höher und näher dem Kessel oben, desto wärmer, je niedriger, desto kühler. Wülste von ornamentalen Stalaktiten umfassen diese unübertrefflichen Badebecken, deren Innenflächen gepolstert sind mit zarten Sinterkrystallen, nachgiebig dem geringsten Druck der Haut, ein Stoff würdig des raffinirtesten Sybariten.
Das Wunderbarste jedoch an den beiden Terrassen sind die Farben. Tetarata ist glänzend alabasterweiss und mit schwärzlichen Dendritenzeichnungen geschmückt, Otukapuarangi aber ist von einem wohllüstigen Rosaroth angehaucht. Die mit Wasser gefüllten Schalen beider schillern in mattem Blau, das bei Otukapuarangi oft in die anderen Farben des Regenbogens hinüberspielt. Dunkelrothe Felswände und dunkles Manukagestrüpp bilden den Hintergrund.
Trotzdem wir schlechtes Wetter hatten, und ein feiner Regen uns frösteln machte, badeten wir auf beiden Terrassen in verschiedenen Schalen, mehr aus Pedanterie als aus Gelüste.
Die zweite südöstliche Terrasse konnte man nur mit dem Kanuu erreichen. Leider ist dieselbe mit unzähligen eingekritzelten Namen von Besuchern verunziert. Neben einem durch amerikanische Reklamenhaftigkeit berüchtigten Schneider in Auckland fand ich auch den Herzog von Edinburgh in dieser geschmacklosen Weise verewigt. »Te Plines, te Plines« (the Prince) machte mich mein Führer aufmerksam darauf.
Der Prinz hat hiedurch ein sehr schlechtes Beispiel gegeben. Jeder richtige Engländer thut jetzt dasselbe. Hätte Seine Königliche Hoheit statt dessen lieber sich für die alten nunmehr vermodernden Skulpturen von Ohinemutu interessirt und einige durch Kauf erworben, so würde er dadurch der loyalen Nachahmungssucht des englischen Touristengesindels eine viel vernünftigere und heilsamere Richtung angewiesen haben. Die Maoris hätten dann vielleicht bei gesteigerter Nachfrage sich wieder einer Kunstindustrie zugewendet, für welche ihre Altvordern so viel Neigung und Geschick besassen und für welche auch die jetzige Generation unverkennbar grosse Begabung zeigt, und es wäre vielleicht ein Erwerbszweig wiedererstanden, geeignet, eine edle und liebenswürdige Rasse zu den Segnungen der Arbeit zurückzurufen.
An unserem Lagerplatz erhielt ich noch ein paar heisse Kartoffel, welche mein Bursche mit einer Muschel schälte, und nahm dann Abschied von den Gefährten, ohne sie um den projektirten dreiwöchentlichen Aufenthalt bei diesem Wetter und in dieser Jahreszeit sehr zu beneiden. Ich habe später wieder von ihnen gehört. Sie mussten noch viel von der Geldgier der Wairoabevölkerung ausstehen, welche der Ansicht war, dass Fremde eigentlich nur mit je zwei Mann im Solde (5 Shilling pro Mann und Tag) an den Ufern des Rotomahana verweilen dürften.
Der Bach, durch den wir nach dem Tarawerasee zurückfuhren, hatte so viele Krümmungen, dass das lange Kanuu kaum durchkommen konnte. Wir blieben auch mehrmals stecken und wurden von der starken Strömung halb in die Quere getrieben, was immer viel Geschrei und wenig zweckmässige Anstrengungen der acht braunen Kerls zur Folge hatte, die sich ihrer Kleider entledigten, um gleich hinausspringen und schieben zu können. Unterwegs wurde noch eine Ladung Schilf, die ein plötzlich aus dem Uferdickicht auftauchender Maori von herkulischen Gliedmassen geschnitten hatte, mitgenommen und da wo der Tarawerasee beginnt, angehalten, um in einer nahen Hütte zu plaudern und Kartoffeln zu essen. Ich hatte zwar das Kanuu für den Tag gemiethet und war somit rechtlich Besitzer und Befehlshaber desselben, musste mir aber gefallen lassen, was meinen Maoris gut dünkte und unterliess auf Grund gemachter Erfahrungen jegliche Aeusserung eines Willens.
Auch hier sind warme Quellen. Ein junges Mädchen zum Skelett abgemagert, lag in einer Badepfütze und verzehrte mit dem gierigen Appetit einer Rekonvaleszentin gekochte Teichmuscheln, während ein altes Weib gleich daneben in einem siedenden Sprudel die Kartoffeln für uns bereitete.
Ich war schliesslich doch dankbar für die von meinen Leuten eigenmächtig verfügte Unterbrechung der Heimreise. Denn einer von ihnen hatte die Pause dazu benützt, aus seiner Wollendecke, zwei Stangen und zähen Schilfhalmen ein zwar nicht marinemässiges aber doch sehr wirksames Sprietsegel herzustellen, welches bei der günstigen steifen Brise, die gerade wehte, das lange schmale Kanuu mit einer Schnelligkeit durch die aufspritzenden unwillig zischenden Wellen jagte, die einem ordentlichen breitgebauten Segelboot nie gelungen wäre. Es war trotz Kälte und Nässe ein Hochgenuss, so dahin zu stürmen, ganz nahe an den Felsblöcken und den weit über sie hereinhängenden riesigen Bäumen mit ihren herrlich dunklen Schatten vorbei, so rasch, dass sie oft nicht mehr zu unterscheiden waren, und das ganze Ufer wie verwischt am Auge vorbeihuschte.
Meine Maoris jauchzten vor Vergnügen, schrieen und sangen und klatschten in die Hände, höhnten grinsend die hinten nachrollenden Wellen, die uns nicht einzuholen vermochten und drohten mit der Faust auf jene, welche jeden Augenblick vorwitzig über den niedrigen Rand leckten, so dass sie dann doppelt emsig ausschöpfen mussten. Oder sie stellten sich im flatternden Hemd mit gespreizten Beinen auf die Borde und breiteten ihre Lendenbekleidung, die wollene Decke, als Hilfssegel aus, deren Zipfel sie mit Füssen und Händen festhielten, so dass ihr geschickt balancirender Körper zugleich Mast, Raa und Schoten ersetzte.
Als wir um die Felsenecke, an der wir gestern den Göttern so wohlfeil geopfert hatten, bogen, änderte sich leider der Wind und wurde so unbestimmt, dass es mit dem Segeln nicht mehr gehen wollte. Von allen Seiten schossen Böen aus den Schluchten herab und kräuselten weithin erkennbar kreuz und quer den hüpfenden See. Wir mussten noch über zwei Stunden rudern, was den Maoris viel weniger zu behagen schien als das Segeln, und sichtlich gewährte es ihnen grosse Befriedigung, dass auch ich theils aus Langweile theils aus Frost zuweilen Wasser schöpfte oder mit der Pageie vorwärtslöffelte.
Spät am Nachmittag kam ich nach Wairoa, von wo aus ich sofort zum abermaligen Erstaunen der irischen Hotelfamilie nach Ohinemutu abmarschirte, welches ich erst nach mehreren Stunden todmüde erreichte, nachdem ich mich in der stockfinsteren Nacht zu allem Ueberfluss noch um eine beträchtliche Strecke verirrt hatte.
Nach meiner Rückkehr von Rotomahana lernte ich den Native-Kommissioner Mister Davis kennen, einen würdigen alten Herrn, berühmt in ganz Neuseeland wegen seiner Gelehrsamkeit in Maoriangelegenheiten. Er war von Auckland nach Ohinemutu gekommen, um Streitigkeiten mit den Eingeborenen zu schlichten.
Da Mister Davis hier öfters und dann meistens längere Zeit zu thun hatte, so war unter seiner Leitung eine Art Schule für die zahlreiche Jugend des Dorfes entstanden, die er jedesmal wieder auffrischte. Missionsanstalten wie früher scheinen seit dem letzten Krieg in Neuseeland kaum mehr zu existiren. Ich habe wenigstens niemals von einer solchen gehört. Trotzdem soll es unter der jetzigen Generation der Eingeborenen nur wenige geben, die nicht schreiben und lesen können. Ohne eigentliche Lehrer zu haben lernen sie es einer vom anderen, und an allen Mauern und Zäunen, an allen Felswänden im Walde sieht man Namen und Zeichnungen eingekratzt, welche die bedeutende Vorliebe der Maoris für graphische Künste dokumentiren.
Mister Davis lud mich eines Abends ein, seine Singschule zu besuchen. Ich hörte da ausser echten Maorigesängen auch einige ins Maori übersetzte englische Lieder. Mitten darunter kam ein Hymnus, von drei Mädchen vorgetragen, der mir durch die Fremdartigkeit seiner Melodie und seines Textes sehr vortheilhaft vor den übrigen auffiel. Es war ein tonganischer Gesang, den die Mädchen in Auckland von tonganischen Matrosen erlernt hatten. Als Mister Davis seinen Schülern und Schülerinnen mittheilte, dass ich ein Deutscher sei und ein vom Englischen verschiedenes Idiom spräche, liessen sie mich bitten, ihnen eine deutsche Rede zu halten, was ich gerne that, ohne mich sonderlich kümmern zu müssen, was ich sagte. Mit grosser Befriedigung wurde konstatirt, dass es wirklich ganz anders klinge als Englisch. Eine der jungen Damen, die eine sehr schöne Handschrift besass, schrieb mir noch eine Sentenz auf einen Zettel, dann ging ich nach Hause. Jene Sentenz lautete folgendermassen: »Ki a Tiamana tena koe. Me whakaako koe ki te reo Maori. Heoi ano na Maraea i tuhi. Ki a ora tonu koe« (Deutscher, sei gegrüsst. Lerne doch die Maorisprache. Dieses hat die Maraea geschrieben. Möge deine Gesundheit beständig sein).
Ohinemutu besitzt keinen Arzt, und so wurde ich während meiner Anwesenheit häufig als solcher in Anspruch genommen, was mir sehr lieb war, da ich so tiefer in die Geheimnisse der Maoribevölkerung einzudringen hoffte. Ich wurde indess stets nur von Weissen zu Eingeborenen gerufen. Diese selbst schienen mich nicht zu wünschen und zu mir viel weniger Vertrauen zu haben als zu einem in der Nähe wohnenden Zauberer. Selten erntete ich etwas wie Dankbarkeit. Vielleicht auch fürchteten die Maoris, dass ich Bezahlung verlangen würde.
Zwei mit Knochensyphilis behaftete Weiber waren die einzigen Fälle von Interesse. Sie leugneten hartnäckig, jemals an primären Erscheinungen gelitten zu haben. Es wäre von höchster Wichtigkeit zu beobachten, wie der Verlauf dieser Krankheit unter dem Einfluss der täglichen und langdauernden heissen Bäder, denen die Bevölkerung von Ohinemutu obliegt, sich gestaltet.
IX
VON OHINEMUTU NACH AUCKLAND
Abschied. Pokohorungi und der Oropibusch. Maoriskulpturen. Eine misstrauische Waldfamilie. Der Sergeant Apro Pioaro und seine Gattin Mangorewa. Tauranga. Reges Leben und Nasendrücken. Abermals ein Stück Neuseeländischer Bummelei. Der Dampfer Rowena. Merkury-Bay. Ankunft in Auckland.
Es gefiel mir in Ohinemutu so gut, dass ich meinen ursprünglichen Reiseplan unberücksichtigt liess und länger blieb als vorausbestimmt war, bis ich eines schönen Morgens Abrechnung mit meinem Mammon hielt und die schreckliche Entdeckung machte, dass ich nicht mehr Geld genug besass um den nächsten Postwagen abzuwarten. Mit Wechseln war hier nichts zu machen. Ich musste fort, fort nach zivilisirteren Gebieten, wo es Banken gab, und zwar schleunig und zu Fuss. Denn selbst ein Pferd oder sonstiges Vehikel hätte ich nicht mehr bezahlen können.
Umsonst schlug die Wirthin, umsonst schlug der Rossarzt, Pferdeverleiher und Lohnkutscher, umsonst schlugen die rheumatismusgelähmten Badegäste die Hände über dem Kopf zusammen, als ich ihnen mittheilte, dass ich »aus wissenschaftlichen Gründen« zu Fuss durch den schauervollen Oropibusch nach Tauranga gehen wolle. Meine wissenschaftlichen Gründe waren unerschütterlich. Ich schnürte mein Bündel, übergab das schwerere Gepäck zum Nachsenden, drückte Allen zum Abschied die Hände und schritt hinweg – wenn die Wirthin und der Rossarzt und die Badegäste nur halbwegs aufrichtig waren, in mein sicheres Verderben.
Ich trennte mich ungern von Ohinemutu, und jedesmal so oft das freundliche dampfende Dörfchen zwischen den Farnhügeln wieder auftauchte, sandte ich ihm zärtliche Blicke zurück.
Im Halbkreis zieht sich die Strasse um das westliche Ufer des Sees und kriecht dann ins Dickicht des Busches hinein. Die Insel der schönen Hinemoa ruhte duftig unter den Strahlen einer wolkenlosen Sonne, und ein kühles Lüftchen milderte angenehm die Wärme des Tages. Da wo die Farnlandschaft aufhört und der Busch beginnt, liegt die Maoriansiedelung Pokohorungi, und ich bog von der Strasse ab um sie in Augenschein zu nehmen. Wenige Zelte und Strohhütten standen zwischen frischgefällten Baumstämmen, über Feuerstellen mit glimmender Asche hingen grosse eiserne Kessel. Hunde bellten, und ein paar braune nackte Kinder liefen eilig hinweg, indem sie besorgt »Pakeha, Pakeha« riefen. Unter einem Baum sassen mehrere Frauenzimmer und assen Kartoffel. Sie machten Witze über mich, lachten laut auf, und ein aussergewöhnlich hübsches Mädchen reichte mir zum Willkomm eine geschälte Kartoffel, die ich mit Dank annahm.
Der Oropibusch, den ich nun betrat, unterschied sich in nichts von den anderen prachtvollen Wäldern Neuseelands, die ich bisher gesehen. Streckenweise war der lehmige Weg so aufgeweicht, dass die Stiefel in Versuchung kamen den Beinen abtrünnig zu werden und im knietiefen Brei stecken zu bleiben. Beständig ging es bergauf und bergab, und war ich ein paar hundert Meter aufwärts gestiegen, so musste ich sicher eines kleinen Flüsschens halber eben so tief wieder hinabsteigen. Ich freute mich, nicht zu Wagen hier durchzupassiren. Denn abgesehen von der bei diesem schlechten Zustand der schmalen Strasse naheliegenden Gefahr in den Abgrund zu stürzen bot die Wagenfahrt hier kaum ein nennenswerthes Vergnügen.
Wenn die Strasse um Ecken bog und glatt abgeschnittene Wände ihre eine Seite bildeten, fehlte es niemals an eingekratzten Zeichnungen und Maorinamen, wozu sich das Gestein, ein weicher Mergel, vortrefflich eignet, und einmal stiess ich sogar auf Basreliefs. Eine Rieseneidechse, ein menschliches Antlitz sowie gleich daneben der entgegengesetzte Pol eines menschlichen Torso mit etwas anstössigem Detail und ein verschlungenes knollenförmiges Etwas, das ich nicht zu enträthseln vermochte, waren die Gegenstände, deren Darstellung kein geringes Formenverständniss bekundeten. Diese Skulpturen befanden sich so hoch oben, dass sie nur während des Strassenbaus gefertigt worden sein konnten.
So reich und üppig die Vegetation entfaltet war, so arm schien die Thierwelt vertreten zu sein. Meine zoologische Ausbeute war dementsprechend gering. Ich schälte beträchtliche Partieen von faulen Baumstämmen ab, ohne eine einzige Schnecke zu finden. Ziemlich häufig fand ich dagegen eine unserem Süsswassergammarus ähnliche Krusterart, die hier im feuchten Mulm lebt.
Nichts unterbrach die tiefe einsame Stille des Neuseeländischen Forstes als hie und da die schüchterne Stimme eines Glockenvogels, welche klang wie die Vorbereitungen eines Punschgläservirtuosen, der den Ton seiner Instrumente prüft.
Es wurde kalt, als der Abend hereinbrach und der Sonnenschein immer höher an den vergoldeten Gipfeln der Bäume und Berge emporrückte. Ich traute meinen Augen kaum, als ich Eiskrusten an den Kanten des Strassenkoths entdeckte, und ich fühlte einige Beunruhigung, als der Himmel immer dunkler und der Weg immer undeutlicher wurde, und jener Militärposten, in dem ich übernachten wollte und der nach meiner Schätzung schon lang hätte kommen müssen, noch immer nicht erscheinen wollte. Auch hier arbeiteten Soldaten und zwar eingeborene an der Herstellung und Verbesserung der Strassen, und in einer gewissen Entfernung, war mir gesagt worden, würde ich wahrscheinlich ein Zeltlager finden, welches aber jetzt auch irgendwo anders aufgeschlagen sein konnte. Endlich stieg unten im Thale eine Rauchsäule empor zu den Sternen, die bereits hell durch die Bäume herabblinzelten.
Was ich suchte, sollte mir noch nicht zu Theil werden. Nur ein einziges Zelt stand zwischen Felsblöcken am Ufer eines rauschenden Baches, und um das Feuer davor sass eine zahlreiche Maorifamilie. Drinnen im Zelt quiekste ein Säugling, und zwei grosse zottige Hunde knurrten sehr unangenehm, als ich zu ihnen hinabstieg. Keine Möglichkeit Auskunft zu erhalten. Niemand, auch der uniformirte Vater nicht, verstand was ich wollte. Alle sahen mich scheu und misstrauisch an, die Hunde schnupperten knurrend an mir herum, und der Säugling hörte nicht auf zu quieksen. In solcher Gesellschaft wäre ich um keinen Preis geblieben so müde ich auch war, und lieber wollte ich im Busch irgendwo zu schlafen versuchen.
Um nicht umsonst in die Schlucht mich bemüht zu haben, machte ich die kosmopolitische Geberde des Trinkens und bat um »Wai« (Wasser). Der Mann stiess die Frau an, die Frau aber murrte und zeigte sich nicht geneigt meinethalben aufzustehen, so dass ich selber ein Gefäss ergriff und zum Bache kletterte, um Wasser zu schöpfen. Dies war das einzige mal, dass ich von Maoris unfreundlich behandelt wurde, wobei allerdings als Entschuldigung in Betracht kommt, dass mein plötzliches Erscheinen in so später Stunde verdächtig sein mochte.
Ich war noch keine tausend Schritt weiter gegangen und machte mich eben mit dem Gedanken vertraut, die Nacht durchzumarschiren, als etwas Helles aus der Dunkelheit zwischen den Bäumen auftauchte und ein Hund zu bellen begann.
Eine Holzhütte, einige Zelte – es war mein langersehntes und schon als verloren betrachtetes Nachtquartier. Auf mein Pochen öffnete sich die Thüre der Hütte, und ich stand vor dem Kommandanten des Platzes Apro Pioaro, einem schönen braunen Sergeanten.
Seine hohe kräftige Gestalt, die edle Gesichtsbildung und die geschmackvolle Uniform der Neuseeländischen Konstabulary Force machten ihn zu einer musterhaften militärischen Erscheinung. Weniger günstig nahm sich neben ihm seine Gattin aus, die sich alsbald beeilte, mir eine Taube des Waldes und etliche Bataten zum Abendmahl zu bereiten. Sie hiess Mangorewa. Ich liess mir beider Namen von ihm in mein Tagebuch schreiben.
Als ich mit dem Essen fertig war, hatte mittlerweile mein liebenswürdiger und chevaleresker Wirth in einem leerstehenden Zelt draussen ein vortreffliches Lager zurechtgemacht. Wir plauderten noch ein Weilchen und rauchten aus schrecklich schmutzigen Thonpfeifen ätzenden Maoritabak, und wir wären sicher noch viel länger zusammen geblieben, wenn nicht Mangorewa, um uns ein Zeichen zu geben, sich demonstrativ entkleidet und ins Bett gelegt hätte. Ich wollte meinem Gastfreund etwas Tabak anbieten, doch er protestirte dagegen und litt nicht einmal, dass ich anderes als sein eigenes Kraut rauchte.
Die Nacht war kalt, aber es lagen so viele Decken und alte Soldatenmäntel auf der Farnstreu in meinem Zelt, dass ich nicht zu frieren brauchte. Nur der Hund des Kommandanten, der durch eines der vielen Löcher hereinkroch und sich mir beigesellte, da er wahrscheinlich ältere Rechte auf das Bett hatte, störte mich zuweilen. Draussen grunzten und schnüffelten alte und junge Schweine schlaflos hin und her, und jedesmal so oft diese unwirsch sich zankten oder eines an der Leinwand vorüberstreifte, fühlte mein Genosse sich verpflichtet hinauszufahren und aufzubegehren. Oben schimmerte der Mond und unten strich die erfrischende Waldluft durch das Gewebe. Ich wickelte mich wohlig in die wärmenden Decken und dachte an die ferne Heimath.
Am frühen Morgen lauerte bereits die ganze Bewohnerschaft des Militärpostens neugierig auf den Moment, da ich die Zeltwand auseinanderschlagen und erscheinen würde. Aus jeder Spalte und aus jedem Fensterchen der Hütten und Zelte guckte ein ungekämmter Weiber- oder Kinderkopf und starrte verwundert mich an.
Ich wollte nach dem Frühstücksthee meinem Sergeanten ein paar Shilling in die Hand drücken, er nahm aber durchaus kein Geld. Da ich jedoch auf Zahlung bestand, so wurde er weich und sagte verschämt und verlegen lächelnd: »Ask Woman«. Ich gab nun Mangorewa meine Münze, welche sie rasch einsackte, während Pioaro mir noch ein paar Schiffszwiebacke aufnöthigte und seinen russigen Pfeifenstummel zum Andenken schenkte.
Ungefähr zwei Gehstunden vor Tauranga liegt das nur aus einem Hotel und einigen Hütten und Zelten mit gemischter Bewohnerschaft bestehende Dorf Oropi, welchem der hier endende Busch seinen Namen verdankt. »Oropi« ist die Maoritransskription für das englische »Europe«. Diese Ortschaft war einst der äusserste von der Küste her vorgeschobene Punkt europäischer Kultur, und mit ihr begann damals für die Maoris des Inneren Europa.
Der Wald lichtet sich, und das nur mehr mit Farn bewachsene Land fällt allmälig zur Bay of Plenty hinab. Von kleinen lauter vulkanischen Inselbergen durchbrochen steigt die blaue Fläche des Meeres zum Horizont empor, und allenthalben erscheinen Farmengehöfte, mit Hainen importirter Pappeln und mit den Rechtecken von Getreidefeldern umgeben, in die braungrünen Wellen der Farnlandschaft hineingestreut. An klaren Tagen ist von hier aus auch die Insel Whakari oder White Island zu sehen, der eine von den beiden Vulkanen Neuseelands, die allein unter den vielen noch thätig sind. Der andere ist der Tongariro südlich vom Tauposee.
Als ich Tauranga erreichte, war es bereits wieder Nacht geworden. In der Dunkelheit hatte ich kurz vorher den Gate-Pa passirt, einen Punkt, der in der Geschichte des erst 1870 beendeten grossen Maorikrieges eine bedeutende Rolle spielt. Der Gate-Pa war ein verschanztes Lager, welches die Eingeborenen so tapfer und erfolgreich vertheidigten, dass trotz ihrer Ueberlegenheit an Zahl und Bewaffnung die stürmenden Engländer mehrmals mit starken Verlusten zurückgeschlagen wurden. Eine Menge Gräber aus jener Zeit bedeckt den Kampfplatz.
Tauranga lernte ich ebensowohl als einen interessanten Zentralpunkt für die umwohnende Maoribevölkerung wie als ein hübsches aufstrebendes Städtchen europäischen Styles schätzen. Gleich der erste Morgen brachte mir wieder schönes warmes Wetter. Lachender Sonnenschein lag über der weiten blauen Bucht mit den vielen kegelförmigen Inseln, als ich aus dem Bett ans Fenster trat.
Mein guter Stern hatte mich zur günstigsten Zeit hieher geführt. Alles war belebt von braunen Gestalten auf der Strasse unten, deren eine Seite das Ufer und deren andere eine Reihe anmuthiger Häuser bildet.
Die Eingeborenen der Bay of Plenty treiben etwas Ackerbau und scheinen noch nicht so vollständig in Faulheit und Liederlichkeit versunken zu sein wie jene des Lake-Distriktes, obgleich auch bei ihnen ein grosser Theil des Verdienstes sofort in Schnaps umgesetzt wird. Am nächsten Tage sollte der wöchentliche Dampfer nach Auckland abgehen, und von links und rechts kamen Maoris über die Bucht herangesegelt und herangerudert um ihren Mais zu verschiffen. Man sah da alte Kanuus und moderne scharfgekielte Böte und gedeckte Kutter von englischer Bauart in ihrem Besitz. Die Kanuus waren im besten Zustand und viel reinlicher und tüchtiger gehalten als jene morschen und lecken Tröge, die auf dem Tarawerasee dem Touristenverkehr dienen. Holzschnitzereien und Federschmuck zierten die Schnäbel. Hochaufgestapelt lagen in ihnen die Säcke, und um das Geschäft zu einer Lustpartie zu benützen kamen gleich die ganzen Familien mit.
Ein buntes charakteristisches Treiben entfaltete sich dem Kai entlang. Draussen lag der Dampfer »Rowena« vor Anker umringt von löschenden Kanuus und Kuttern. Auf der Strasse und auf dem von der Ebbe entblössten Strande hockten gruppenweise Männer, Weiber und Kinder, alle in grellfarbige steife Decken gewickelt. Neue Ankömmlinge erschienen und vergrösserten die Gesellschaft. Wilde Reiter mit flatternden rothen Tüchern sprengten rücksichtslos durch die Menge, barfüssig im Steigbügel, die äussere Stange desselben zwischen der kleinen und der vorletzten Zehe haltend.
Noch nie hatte ich so viele Maoris und zwar so viele echte, von der Zivilisation noch nicht allzustark beleckte Maoris auf einem Fleck versammelt getroffen. Bestand auch ihre Gewandung überwiegend aus europäischen Fabrikaten, so waren doch noch genug einheimische Gewebe aus Phormium und eine Menge einheimischer Schmucksachen vorhanden, natürlich etwas modifizirt durch den Einfluss europäischer Stoffe.
So zum Beispiel trugen einige Weiber weissglänzende Haifischzähne mit scharlachrothen Siegellacktropfen in den Ohren. Diese Art Schmuck ist so gesucht, dass es sich verlohnt hat, ihn aus Fayence nachzubilden, wovon ich später in Auckland mich überzeugte. Fast allen Männern hingen von den rechten und dadurch langgedehnten Ohrläppchen schwere tropfenförmige Grünsteinstäbe an einem schwarzen Seidenband mit lose flatternden Enden herab. Auf der Brust zweier älteren Frauen bemerkte ich jenes kostbare Grünsteinamulett, eine stylvoll gearbeitete Fratzenfigur mit Perlmutteraugen, welches man Tiki heisst. Ein grobes Hemd, ein paar schlumpige Röcke und der nie fehlende möglichst bunte Schal bildete die Kleidung fast aller Weiber. Auf dem Kopf, dessen dichtes blauschwarzes Haar oft struppig und ungekämmt in das braune Gesicht mit den grossen Augen hereinfiel, sassen bei einigen Männerhüte, bei anderen elegante Damenbaretts mit Schleier, während sie alle barfuss waren. Eine einzige nicht mehr ganz junge Dame bewegte sich schmerzhaft und ungeschlacht in engen Stiefeletten. Die meisten trugen keine Bedeckung oder hatten den Schal über sich gezogen, so dass nur die Pfeife aus dem unförmlichen Klumpen oben herausguckte, wenn sie auf dem Boden sassen. Säuglinge wurden huckepack in einer kapuzenartigen Ausbuchtung mitgeschleppt. Die Männer waren oberhalb der Unterextremitäten ebenso gekleidet wie die weissen Arbeiter und Farmer Neuseelands, mit dem Gebrauch einer Hose jedoch hatten sie sich noch nicht befreundet. Eine um die Hüften geschlungene Wollendecke, die bis zu den Knieen reichte, vertrat dieselbe. In den malerischen Schlapphüten waren meist schlanke und spitze Fasanenfedern befestigt.