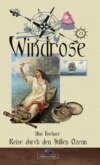Kitabı oku: «Reise durch den Stillen Ozean», sayfa 8
VII
VON WELLINGTON NACH OHINEMUTU
Ein Neuseeländischer Urwald. Die Post und ihre Gefahren. Pahantanui, Otaki und Foxton. Neuseeländische Eisenbahngemüthlichkeit und ein eisenbahnfiebriger Maori. Die Manuwatu Gorge und der Seventy Miles Busch. Palmerston, Waipakarao und Waipawa. Die Repudiation Office von Te Aute. Ein Tag in Napier. Farnhügellandschaft. Tarawera und seine Soldateska. Kaliban in der Wildniss. Opipi. Ein Tag in Tapuaeharuru. Mister Jack the Guide of Taupo. Nächtlicher Skandal.
Ich kaufte mir zunächst ein Ticket nach Napier an der Hawkes-Bai, welches ungefähr nördlich von Wellington liegt, theils per Postkutsche, theils per Eisenbahn in drei Tagen zu erreichen. Von Napier aus ging es dann ausschliesslich per Postkutsche in nordwestlicher Richtung über Tarawera und Tapuaeharuru am Taupo-See, und von hier in nördlicher Richtung über Ohinemutu nach Tauranga an der Bai of Plenty, was im Ganzen vier weitere Tagereisen ausmachte.
Am Morgen des 29. Mai, als es noch dunkel war, holte mich die vierspännige Postkutsche vor dem Hotel ab, ich bestieg den ausbedungenen Bocksitz und verliess freudigen Sinnes die Stadt Wellington, die mich schon zu lange beherbergt hatte. Die Strasse führte uns neben der Hutt River Eisenbahn dicht am westlichen Ufer des Hafens entlang. Das Leuchtfeuer auf Somes Island, meiner ehemaligen Domäne, brannte noch. Trüb stieg der Morgen hinter schwarzen Bergen und dunklen Wolken herauf, und eine zu früh erwachte Möve strich einsam über die kaltschimmernde Wasserfläche.
Steilansteigender Busch, stellenweise durch Feuer gelichtet, wo dann die schwarzverkohlten kahlen Baumstämme emporstarren, erhebt sich zur Linken. Durch einen Thaleinschnitt kommt ein Bächlein herab. Wir biegen hinein mitten ins Innere des Gebirges, und wie mit einem Schlag verändert sich die Szenerie.
Jede Spur von Ansiedelungen ist verschwunden, die üppige Pracht eines jungfräulichen Neuseeländischen Forstes umfängt uns. Die Strasse wird enger, so eng, dass kaum ein Fussgänger dem Wagen ausweichen kann, und bald auf dieser bald auf jener Seite des murmelnden Bächleins leitet der Rosselenker das Viergespann nach links und nach rechts um scharfe Felsenkanten. Die Biegungen sind so zahlreich und kurz, dass man keine hundert Schritt weit den Weg vor sich sieht und jede Minute glaubt, an der nächsten senkrechten Wand müsse er aufhören. Hohe majestätische Bäume, im Morgenthau glänzendes Strauchwerk und elegante hellgrüne Farne neigen sich über die Strasse, und blaue Eisvögel schwirren vor uns eiligen Fluges ins Dickicht. Einmal tauchen etliche Holzhütten, von kleinen Gärten umgeben, überraschend aus der romantischen Abgeschiedenheit des Busches. Hunde springen bellend an den Zaun und ärgern sich nur noch mehr, wenn unser Kutscher Zeitungen oder Briefe hinüberwirft.
In dem Dorf Johnsonville war die Wasserscheide erreicht, und ein anderes Bächlein schloss sich alsbald an uns an, um in gleicher Richtung mit uns weiterzureisen. Schulkinder, welche nach der Schule wanderten, baten den Kutscher eine Strecke fahren zu dürfen, und wir hielten um sie mitzunehmen. Die Umgebung wurde nun weiter, der Busch wich zurück, und auf einem sumpfigen See schwammen scheue Kormorane und fischten. Eisvögel sassen auf dem die Strasse begleitenden Telegraphendraht wie zu Hause im Herbst die Schwalben.
Eine halbe Stunde später kam Pahantanui4, eine grössere Farm mit Wirthshaus, wo wir frühstückten. Ein grosses Orchestrion stand im Zimmer, und der Wirth gab uns damit, während wir assen, ein Konzert zum Besten. Selbst die fernsten Erdenwinkel macht bereits diese abscheuliche Maschine unsicher. Zum Glück war das Instrument nicht bei Stimme, und seine Melodien drangen nur leise und gedämpft wie ferne Jahrmarktsmusik durch den plumpen Glaskasten.
Die Strasse, auf der wir kaum merklich ansteigend jene durch Port Nicholson aus der Südwestecke der Provinz Wellington geschnittene Halbinsel durchkreuzten, steht plötzlich vor einem jähen Absturz von 200 Meter, unter welchem gegen einen schmalen Dünensaum der Indische Ozean in langen langsam anrückenden Wogen donnert. Zwei duftig von der Morgensonne verschleierte Inseln sind in die blaue Fläche gebettet, die von unserem erhöhten Standpunkt aus trichterförmig zum Horizont emporgespannt zu sein scheint, Mana Island im Süden und Kapiti Island im Norden. Schnurgerade zieht sich die weisse Schaumlinie der Brandung und der glänzend gelbe Streifen des Ufersandes bis in die allmälig verschwimmende Ferne. Zwei kleine schwarze Pünktchen bewegen sich auf ihr näher. Es sind Maorireiter, die auf dem Strand, der einzigen Verkehrsstrasse dieser Gegend, ihre struppigen Pferde entlang hetzen.
Auch wir mussten dort hinunter. Unheimlich steil klettert die schmale und schlechte Strasse, ängstlich sich an alle Krümmungen der schroffen Bergwand drückend, in die Tiefe. Kein Geländer schützt vor dem drohenden Abgrund, und an den Ecken ist der Rand so schadhaft und nahe, dass die von den Pferdehufen losgeschlagenen Steine unmittelbar in die grüne Schlucht hinabkollern, in der unser Bächlein halbversteckt von Felsblock zu Felsblock hüpft.
Im Innern des Wagens sassen zwei Frauenzimmer, und kaum hatten sie bemerkt, um was es sich handelte, als sie zu jammern begannen und flehten, man möge sie aussteigen lassen. Aber es war zu spät, und maliziös lächelnd trieb der Kutscher das Viergespann bald im Trab bald im Schritt über den gefährlichen Weg. Der Mann flösste mir Respekt ein, und ich begriff jetzt, warum man in Wellington immer, wenn von Postkutschen die Rede war, sich wunderte, dass noch nie eine in den Abgrund gestürzt sei, und wann dies wohl zuerst geschehen würde. Sehr angenehm war es mir, dass uns dieses interessante, mit so grosser Spannung erwartete Ereigniss nicht traf, obwohl die beiden Weiber durch ihr Gekreisch beinahe die Pferde scheu machten, so oft die Kutsche sich nach aussen statt nach der Felswand neigte.
Unten wurden die Pferde gewechselt, und zwar auf einer Station Namens Paikekariki. Dann gings auf die muschelbesäte Beach hinaus, deren nasser Sand 40 Meilen lang eine so vortreffliche feste und glatte Strasse abgiebt, wie man sie nicht besser wünschen kann. Wir bogen rechts und nach Norden. Die Berge wichen zurück, das flache Vorland wurde breiter und überzog sich mit einer fremdartigen Vegetation von wogendem Schilf, von Phormiumgebüsch und von einzeln stehenden Kohlpalmen. Hinter uns tauchten die Konturen der Südinsel aus dem Wasser. Donnernd brach sich zur Linken in endloser Linie die Brandung und goss zuweilen über die sanfte Böschung unseres Pfades breite schaumige Zungen, welche ohnmächtig unter den Hufen und Rädern zerspritzten. Wild und malerisch zerlumpte braune Maoris zu Pferd begegneten uns und frugen nach Briefen. Möven watschelten auf ihren dünnen Beinen im seichten Wasser herum, sahen uns misstrauisch an, unentschieden ob sie auffliegen sollten oder nicht, und thaten es schliesslich doch, als wir sie eigentlich schon überholt hatten.
Brücken giebt es auf dieser Naturstrasse nicht, wenn auch mehrere Flussmündungen sie quer unterbrechen. Wir fuhren einfach durch ihr kiesiges Bett, und unsere Damen im Wagen wurden ersucht, die Beine und das Gepäck auf die Sitze zu nehmen.
An einer der vielen Fuhrten, die sich durch die Regengüsse der letzten Tage verändert haben mochte, bogen wir nach einem weiter innen liegenden Gehöft, um einen Lootsen zu holen. Das Gehöft, mehrere altersschwache Gebäude im Verandastyl, stand in einem ehemaligen Maori-Pa, dessen niedriger Wall und Graben noch deutlich zu erkennen war. Die eine Ecke der Befestigung bildete ein ansehnlicher wenigstens 8 Meter hoher Hügel von weissgewitterten Muschelschalen, den Mahlzeitresten mehrerer Generationen, ein neuseeländischer Kjökkenmödding. Schweine und Hunde bummelten auf dem freien Platze. Drei Maoriweiber sassen vor der Thüre, in grellrothe Decken gewickelt, schwarzgeräucherte Thonpfeifen im Munde, und sonnten sich, zwischen ihnen ein nackter fünfjähriger Junge, der ungestüm mit der Faust auf seine Mutter schlug, bis sie ihm die Brust zum Saugen reichte.
In Otaki, der bedeutendsten Maori-Ortschaft der Strecke, wartete unser im Wirthshaus, dem einzigen von einem Weissen gehaltenen Anwesen, das Dinner. Schon ehe wir Otaki erreichten, wurde die Umgebung kultivirter. Wiesen von kurzem aus England hieher verpflanzten Gras, mit zahlreichen Kohlpalmen, die sich noch nicht hatten verdrängen lassen, besetzt und dazwischen Kartoffelfelder traten auf, als wir die Beach landeinwärts verliessen und nach etlichen Terrainschwierigkeiten mit einmal wieder eine richtige Strasse befuhren, die sich durchs Dorf zog.
Nach einem ziemlich kalten Morgen sandte die Mittagssonne wohlthätig warme Strahlen herab, und die ganze Bevölkerung war aus den Hütten gekrochen. Hübsche braune Mädchen, die tiefschwarzen Haare ungekämmt ins Gesicht hereinhängend, roth und gelbkarrirte Schaltücher nachlässig umgeworfen, lungerten schäkernd herum. Dem Wirthshaus gegenüber hockte eine Gruppe Männer auf dem Boden und war so eifrig in ein Kartenspiel vertieft, dass sie selbst von der Ankunft der Postkutsche keine Notiz nahmen, die doch sonst nicht uninteressant zu sein schien.
Otaki besitzt eine Kirche im modernen Maoristyl, und ich beschleunigte mein Mahl, um für sie noch einige Minuten zu erübrigen. Wie bei allen christianisirten Polynesiern haben sich die Formelemente der alten Architektur im Wesentlichen erhalten, und nur die Dimensionen der Höhe sind bedeutend vergrössert worden, so dass man die jetzigen Bauten aufrecht betreten kann, während man früher nicht anders als auf allen Vieren hinein und drinnen herumkriechen konnte.
Bei der Kirche von Otaki ist das Giebeldach, welches bei Maorihütten flach zu sein pflegt, so spitzig in die Höhe gezogen, dass es den Eindruck eines gothischen macht. Drei roh zugehauene vierseitige Pfeiler stützen in der Mittellinie des Inneren den Giebelbaum. Senkrechte Streifen von massiven Brettern und Schilfgeflecht bilden abwechselnd sowohl die niedrigen Seitenwände als auch das steile Dach. Das Geflecht ist weissgetüncht, und die Holztheile tragen auf rothem Grund ebenfalls weissgemalte groteske und eigenartige Ornamente. Ausser einem Tisch und mehreren Bänken findet sich keinerlei Geräth für den Gottesdienst. Das vorspringende Dach beschirmt den Eingang wie eine Veranda, in der fünfeckigen Frontwand sind zwischen den Bretterstreifen nebst der Thüre lange und schmale Fenster eingesetzt, welche nur wenig Licht durchlassen.
Der Kutscher knallte draussen, ich musste wieder fort. Wir hatten noch eine lange Reise vor uns, und es wurde Nacht, ehe wir unser Ziel erreichten, Foxton, eine junge Stadt von vielleicht 500 Einwohnern.
Als der Abend hereinbrach, fuhren wir noch immer auf der Beach entlang. Der Himmel war wolkenlos, die Luft wurde kühl, glühend sank die Sonne unter den dunklen Meeresrücken, und links vor uns, weit weit draussen über der See schwamm eine auffallend blaue Bergespyramide in der Luft, der altehrwürdige Vulkan von Taranaki Mount Egmont, zu dem sich die Küste in einem weiten, mehr als 100 Kilometer langen Bogen hinüberzieht.
So lange wir auf dem glatten Ufersand fuhren, ging es trotz der Dunkelheit rasch dahin. Fünf grosse blitzende Laternen warfen ihr helles Licht voraus auf den Weg. Die vier Pferde fühlten, dass es galt, das Nachtquartier zu erreichen.
Kurz vor Foxton mündet der Fluss Manuwatu. Ihn zu überschreiten hatten wir eine Fähre etwa zwei Kilometer binnenlands aufzusuchen. Aber es war nicht leicht, den undeutlichen Weg durchs Gestrüpp zu finden, und erst als der Kutscher abstieg und mit einer Laterne rekognoszirte, entdeckte er, dass er zu weit auf der Beach gekommen war und zurückfahren musste. Ein wildes Wirrsal von Phormium und Schilf suchte unsere Fahrt zu hemmen, aber die eifrigen Pferde rissen ungestüm den heftig stampfenden und rollenden Wagen vorwärts, um so ungestümer je hartnäckiger die zähen Pflanzen sie zurückzuhalten strebten, dass die Fetzen davonstoben.
Endlich hielten wir an der Fähre. Lichter glimmten auf der anderen Seite der weiten Wasserfläche. Langsam trug die plumpe schwimmende Brücke, an ein quergespanntes Tau gefesselt, mittels des schräg gehaltenen Steuers durch die Strömung getrieben, Wagen, Pferde und Passagiere hinüber. Im Gallop gings dann durch einen lehmigen Hohlweg hinauf und vors Hotel.
Während wir in dem geräumigen Speisesaal des köstlichen, äusserst reinlich servirten Abendmahles genossen, bei welchem der Kutscher präsidirte gleichwie der Kapitän eines Schiffes, lungerten draussen in der schmutzigen und räucherigen Schnapsstube ein paar Maorifrauenzimmer herum, mit Hut und Schleier Europäerinnen imitirend, und betranken sich.
Seit wenigen Wochen war die Eisenbahn von Foxton nach Palmerston, eine Strecke von ungefähr 37 Kilometern, dem Verkehr übergeben. Mit Tagesanbruch sollten wir auf ihr weiterreisen und legten uns deshalb zeitig zu Bett.
Das Hotel war voll, und ich wurde mit drei anderen Reisenden zusammen in ein Zimmer gesteckt. Unter diesen befand sich ein europäisch und verhältnissmässig fein gekleideter Maori, der morgen früh mit demselben Zuge wegzufahren beabsichtigte. Er war beständig in Furcht nicht zur richtigen Zeit aufzuwachen, machte alle Stunden Licht und sah nach der Uhr, und als Mitternacht vorüber war, zündete er sich seine Pfeife an und rauchte, um ja nicht mehr einzuschlafen. Diese Unruhe störte auch unseren Schlaf, und die zwei anderen Weissen begannen zu schimpfen. Mich selbst liess die Neuheit des braunen Kerls tolerant gegen sein Benehmen, und ich blieb unparteiischer Zuhörer des Streites, in welchem der Maori sehr viel Gutmüthigkeit und Naivetät, die zwei Weissen sehr viel Gehässigkeit zu entwickeln schienen.
Die kurze Strecke Eisenbahn zwischen Foxton und Palmerston war, wie bereits erwähnt, erst seit ein paar Wochen eröffnet, und der Betrieb noch überaus primitiv und bummelhaft gemüthlich. Eine aussergewöhnlich kleine Maschine mit Tender und zwei Personenwagen amerikanischen Styls bildeten den ganzen Zug. Ziemlich lange schon war die fahrplanmässige Abfahrtszeit vorüber, die Passagiere trippelten laut vor Kälte und Ungeduld mit den Füssen, die Lokomotive summte, aber Maschinist und Schaffner fehlten noch. »Charly, Charly« rief der Billeteur durch die Hinterthüre des Miniaturstationsgebäudes nach einer Kneipe hinüber, und auch wir riefen aus Leibeskräften »Charly, Charly«. Jedoch Charly kam nicht. Wir stiegen wieder aus, und erst eine Viertelstunde später erschien mit einem Rudel Freunde der Schaffner, frug nach dem Maschinisten und ging ihn suchen, worauf sogleich dieser erschien und nun den Schaffner suchen ging. Und als endlich beide sich gefunden hatten, und der Zug in Bewegung war, musste nochmals gehalten werden, weil man den Briefsack vergessen hatte.
Norddeutsche Freunde sagen meinem edlen baiuvarischen Vaterlande nach, dass dort Eisenbahnzüge an allen Stationen länger hielten, wo die Kondukteure gutes Bier wüssten. In Neuseeland würde ich dies unbedingt für möglich halten, wenn es in Neuseeland überhaupt einen Stoff gäbe, dem der Baiuvare den Namen Bier zuerkennen möchte.
Es ging durch flaches dünenartig welliges Land, vorne im Osten erhoben sich blaue Berge. Farn bedeckte weithin den Boden und machte von ferne den Eindruck unseres heimischen Haidekrauts. Dunkle Büschel von Phormium tenax und die graziösen Rispen von Arundo conspicua, bald vereinzelt, bald dichter zusammengedrängt, ragten darüber hervor, Schilfhütten und Zelte lagen zerstreut und kaum erkennbar in die übermannshohe Vegetation eingebettet. Männer, Weiber, Kinder und Hunde standen zuweilen oben am Rande der Bahneinschnitte, sahen herab auf unseren gemächlich dahin wackelnden Zug, und kalt glänzte hinter ihren dunklen Gestalten der wolkenlose Morgenhimmel. Die Passagiere froren und klopften mit den Füssen, und in der frostigen Stimmung, die ringsum herrschte, bedauerte ich herzlich jene armen Wilden, die hier in einer so unwirthlichen Landschaft ohne genügende Wohnstätten und ohne genügende Kleidung leben mussten. Hie und da kamen dann auch Maorihütten, die einer höheren Kulturstufe angehörten, bis zu europäischen Holzhäusern mit Veranden hinauf. Aber nur wenige Fenster waren ganz an diesen, und alle Theile, Dach und Wände, hatten Defekte und trugen den Stempel der Verlotterung.
Ein hoher Busch nahm uns auf. Der Durchhau für die Bahn war so schmal, dass über ihm die Bäume zusammenschlugen und eine grandiose Laube bildeten. Weisse Zelte, über deren Eingang häufig ein Stück rohen Fleisches hing, guckten hie und da aus dem Dickicht, die Nachtquartiere von Bahnarbeitern. An einer Stelle mussten wir halten, weil die Schienen momentan nicht in Ordnung waren. So quälten wir uns langsam durch diesen herrlichen Busch, dessen Genuss die Kälte schwer beeinträchtigte.
Die Gesellschaft, meist männlichen Geschlechts, war einsilbig und verfroren und roch nach Schnaps. Nur mein Schlafgefährte der letzten Nacht, der eisenbahnfiebrige Maori, war munter und redselig.
Er hatte in mir einen ausnahmsweise wohlwollenden »Pakeha« (Europäer) erkannt und suchte mich unausgesetzt zu unterhalten, und wenn ihm gerade nichts zu schwatzen einfiel, so blinzelte er mir wenigstens freundlich mit den Augen zu. Er machte mich auf seine schöne Bekleidung aufmerksam, auf seine Stiefel, die bis zum Knie reichten, und dass er Unterhosen trug. Alles musste ich bewundern und befühlen, Hose und Weste, Stiefel, Rock und Hut. Ganz besonders stolz aber war er auf seine goldene Uhr, die er überlegen lächelnd meiner silbernen gegenüberhielt. Und von jedem dieser Artikel sagte er mir den Preis und war erstaunt, vielleicht auch misstrauisch, als er mich umsonst um den Preis der meinigen frug, den ich nicht mehr wusste. Er war schwer zu verstehen, obwohl er besser englisch sprach, als je ein anderer Maori vor oder nach ihm, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Aber die Aussprache des »S«, welcher Buchstabe im Maori, wie in den meisten polynesischen Sprachen fehlt, machte ihm grosse Schwierigkeit und gelang auch ihm nicht immer. Statt »Sixpence« sagte er »Hickipenni« und »Chilling« statt »Shilling«.
Das Wetter verdüsterte sich, ehe wir in Palmerston ankamen, wo jenseits eines freien Platzes, auf welchem noch die frischen Stümpfe gefällter Bäume aus der Erde hervorstanden, das Hotel mit dem Frühstück und davor die bereits angespannte Postkutsche unser harrten.
Palmerston bot mir das richtige Bild einer hinterwäldlerischen Ansiedelung. Ringsum ist Busch. Ausser ein paar grösseren Holzhäusern sieht man nichts als ganz kleine, niedliche Hütten, eine genau wie die andere, ebenfalls aus Holz und nur die ziemlich geräumigen Schornsteine gemauert, durch das weithin gelichtete Terrain zerstreut. Vereinzelt stehen noch etliche Bäume in ihrer ganzen gigantischen Höhe und vermehren dadurch die Winzigkeit der Hütten. Sägemühlen dampfen geschäftig, und schwere Blockwagen tragen ihnen die Riesen des Waldes zu.
Eine halbe Stunde von Palmerston entfernt erreichten wir wieder den schmutzigen Manuwatufluss und eine Fähre, um abermals, zurück nach dem linken Ufer, überzusetzen. Die Pferde wurden ausgespannt, und der Wagen mit vereinten Kräften der Fährleute und des Kutschers an der Deichsel und an Stricken, das Hintertheil voran, den steilen, lehmigen Uferrand hinabgelassen auf eine Platform aus Brettern, welche auf zwei schwächlich aussehenden Kähnen ruhte, denen ich ohne diese Probe eine solche Tragfähigkeit niemals zugetraut hätte. Dann kamen paarweise die Pferde, und zuletzt die Passagiere, ausser mir eine Dame mit einem kleinen Mädchen, an die Reihe, so dass die Prozedur des Uebersetzens ungefähr eine halbe Stunde in Anspruch nahm.
Bald nach diesem nautischen Intermezzo erreichten wir die Berge und die wegen ihrer halsbrecherischen Gefährlichkeit berühmte Strasse durch die Manuwatu Gorge, von der man sich in Neuseeland in höherem Masse, als von irgend einem anderen Punkt der Postlinien wundert, dass sie noch nie eine Kutsche zu Fall, das heisst zum Sturz in den Abgrund gebracht hat. Etwa dreissig Meter unter uns zur Linken toste der Manuwatu über Felsblöcke und Baumstämme, zur Rechten war eine steile, zuweilen drohend überhängende Felswand, und wäre eines der vier Pferde scheu geworden, nichts hätte uns gehindert, hinabzustürzen.
Ein überaus herrlicher Busch baut sich jenseits in die Höhe, unzweifelhaft das Schönste, was ich je an Waldszenerie gesehen. Das helle Grün elegant geformter Farnbäume strahlt prangend aus den dunkleren Farben üppigen Unterholzes und majestätischer Baumriesen, an denen Schmarotzerpflanzen in buntester Mannigfaltigkeit sich hinanschlingen. Wunderbar leicht und graziös wachsen alle diese Laubmassen auseinander hervor, von den überhängenden Zweigen unten, die ins Wasser des schäumenden Gebirgsstromes tauchen, bis hinauf zu den luftigen Höhen, in denen sich die Wipfel der Totaras wiegen. Tiefe Ruhe und Einsamkeit lagert über dem Ganzen, nur selten unterbrochen durch das dann um so befremdender klingende seltsame Geschrei eines aufgeschreckten Papageis oder Tuis, die wenige Augenblicke sichtbar, über den Busch hinwegfliegen, um sogleich wieder in den geheimnissvollen Schatten einer dunklen Laubhöhle zu tauchen. Nur Tauben sind weniger vorsichtig und bleiben oft sitzen, bis wir so nahe sind, dass wir sie schiessen könnten. Schade, dass die gefährliche Situation den Genuss all dieser Schönheit störte. Immer wieder wurde das Auge nach dem Boden abgelenkt, der kaum einen Fuss von den Rädern fast senkrecht abgeschnitten war.
Noch eine Biegung, eine hochbeinige hölzerne Brücke erscheint, wir poltern donnernd im Gallop über sie hinweg. Die gefährliche Gorge ist hinter uns, aber auch die schöne romantische Szenerie ist vorüber, und die Ansiedelung Woodville zieht sich an der Strasse entlang, auf welcher Schaaren gesund und fröhlich blickender Kinder uns entgegen lärmen. Die Brücke ist zugleich die Grenze zwischen den Provinzen Wellington und Napier, und wir befinden uns nun in der letzteren. Bis nach Takapau, unserem Nachtquartier, ging es durch den Seventy Miles Busch und hauptsächlich durch skandinavische Ansiedelungen, deren eine den Namen Danewirk führt.
Mittag machten wir in einem einsamen Gehöft, in dessen Nähe ich die ersten Maorihütten im alten Style sah, niedrig und mit vorspringendem Dach tief in der Erde steckenden Schweizerhäuschen nicht unähnlich, melancholisch öde, ohne Menschen, nur von einigen weidenden Pferden umgeben. Ein altes Maoriweib begegnete uns in Lumpen gehüllt, blieb oft stehen und saugte gierig an einer Medizinflasche, welche einen röthlichen Stoff, wahrscheinlich Rum enthielt.
Unser Nachtquartier Takapau bestand aus einem Gebäude, welches den stolzen Namen »Railroad Hotel« unter dem Giebel trug. Hinter ihm jungfräulicher Urwald, vorne eine wellenförmige Stoppel und Moorebene, von einer Eisenbahn weit und breit nichts zu entdecken. Der Schienenstrang von Napier her war vorerst noch nicht über das Stadium des Projektirtseins hinausgekommen, aber doch gab es hier in der Wildniss bereits ein Railroad Hotel.
Am nächsten Tag, der uns nach Napier bringen sollte, kamen wir zum Dinner an eine höhere Stufe der durch die künftige Bahn bedingten Entwicklung. Waipakarao hiess der Ort, ein Dorf der Zahl, ein Städtchen dem Aussehen seiner Häuser nach, die alle neublinkend in einer Reihe stehen, ringsum weitgestreckte Wiesenflächen. Es berührte komisch, mitten in solcher Ländlichkeit die Aufschrift »Bank of New Zealand« zu lesen. Grossartige Geldgeschäfte waren in dieser Filiale wohl noch nicht abgemacht worden. Indess war hier die Eisenbahn schon im Bau begriffen, die Gegend ist fruchtbar, und aus der einen halben Strasse kann sich in kürzester Zeit eine blühende Stadt entwickeln.
Dass es in Waipakarao viel Vieh geben musste, darauf deuteten die allenthalben auf den Wiesen errichteten Schlachtgalgen hin. Ich hatte diese eigenthümlichen Gerüste, welche dazu dienen, die unglücklichen Rinder mittels eines Rades in die Höhe zu winden, um sie bequemer zu tödten und abzuhäuten, aus der Ferne für Ziehbrunnen gehalten, bis ich sie näher betrachtete und die blutigen Spuren ihres Zweckes einsah.
Unweit davon kreuzten wir den Tukituki Fluss in der landesüblichen Weise, indem wir einfach hindurchfuhren, neben der Eisenbahnbrücke, die in den nächsten Tagen vollendet sein sollte. Bald darauf gings durch das Städtchen Waipawa und über den Eisenbahndamm, vor welchem bereits eine funkelnagelneue Tafel »Look out for the Locomotive« warnte.
Wieder kam eine Stunde menschenleerer Einsamkeit, und unter einem immer düsterer werdenden Himmel dehnte sich eine wüste gelbgebrannte Steppe, durch welche ein ausgetrocknetes kiesiges Flussbett mit einem dünnen Wasserfaden sich schlängelt. Phormiumdickichte und die seltsamen starren Büschelköpfe der für Neuseeland so charakteristischen Cordyline australis, einzeln oder zu kleinen Wäldchen gruppirt über jene hervorragend, sahen fast aus, als ob sie einer früheren geologischen Epoche angehörten und nicht mehr in unser Zeitalter passten. Ringsum Todesstille. Selbst Pferde und Wagen sind kaum hörbar auf dem weichen Rasen, der ab und zu den schwarzen Moorboden bedeckt.
Eine einsame Seemöve flog unstät ihre Richtung ändernd über die düstere Landschaft. Hatte sie sich verirrt, oder fliegen hier die Möven über ein hundert Kilometer breites Land von einer Küste zur anderen, oder war es eine darwinistisch gesinnte Möve, die des wilden Seelebens satt sich in den Kopf gesetzt hatte, ein ehr- und tugendsamer Landvogel zu werden? Der Weg wurde wieder herzlich schlecht und nahm stellenweise den Charakter eines richtigen Moorsumpfes an, in den die Räder tief einschnitten, bis wir endlich eine Hügelkette erreichten. Jenseits derselben begann ein Wald, der stellenweise gelichtet und mit den Hütten von Holzschlägern durchsetzt war. Diese Hütten hatten alle nicht nur hölzerne Wände und Dächer, sondern auch hölzerne Schornsteine, aus schweren grob gearbeiteten Bohlen flüchtig zusammengezimmert und grossentheils halbverkohlt.
Kurz vor Te Aute sahen wir in der Ferne einige Maorigehöfte, und bald darauf passirten wir eine noch interessantere Stätte. »Dies ist die Repudiation Office« sagte mit spöttischem Ausdruck der Kutscher, indem er auf eine durch Neuheit glänzende Hütte wies, und machte mich dadurch auf eine berechtigte Eigenthümlichkeit Neuseelands aufmerksam, von der ich noch nichts wusste.
Bekanntlich hatten die Engländer in Folge schreiender offiziell sanktionirter Ungerechtigkeiten von 1860 bis 1870 einen zehnjährigen Krieg mit den Maoris zu bestehen, welcher ihnen oft Gelegenheit gab, soviel Respekt vor der Tapferkeit und Kriegsfähigkeit dieser sogenannten Wilden zu bekommen, dass sie sich nunmehr ängstlich hüten, abermals mit ihnen anzubinden. Die weissen Ansiedler müssen heutzutage das Land, was sie von den Maoris haben wollen, auf ehrliche Weise erwerben, und die gute alte Zeit, in welcher man sich grosse Besitzthümer erschwindeln konnte, ist vorüber. Nun aber entstand eine Partei, welche vorgiebt, dass ihr dieser einfache goldene Mittelweg der Gerechtigkeit noch nicht genüge, und behauptet, sich in ihrem Gewissen so lange bedrückt zu fühlen, bis alle seit undenklichen Zeiten geschehenen Landkäufe geprüft und wenn nicht in Ordnung befunden, rückgängig gemacht worden sind. Solch hoher Edelsinn konnte natürlich nicht verfehlen, sofort die Herzen der Maoris zu gewinnen. Die Gegner freilich waren der Ansicht, dass es nur ein Blendwerk sei, unternommen um die treuherzigen Wilden desto sicherer auszubeuten. Das ungefähr verstand man damals unter Repudiation Party, und die neue Holzhütte an der wir vorüberfuhren, war eines der Hauptquartiere, die Repudiation Office von Te Aute, bestehend aus einem Direktor, zwei Advokaten und zwei Dolmetschern.
Bis nach Te Aute kam uns die fertige Eisenbahn entgegen, und in einem auffallend komfortablen und eleganten Wagen fuhren wir nach Napier. Ein geschwätziger, alter Herr, ein reichgewordener »Schafbaron« sass neben mir und erklärte mir die Gegend. Das Land zwischen Te Aute und Napier ist flach und ganz im Gegensatz zu den bisher gesehenen, weniger kultivirten Gegenden Neuseelands saftig grün von erst kürzlich gesäetem englischem Gras. Ueberall weiden Schafe. Auf einem Farnhügel stand ein alter Maori-Pa, der jetzt nur mehr wenige Hütten enthielt. Noch ragten zwei schlanke Pfeiler, nach oben etwas anschwellend und mit ornamental geschnitzten Kapitälen ähnlich den Gondelpfosten zu Venedig empor, deren früher hier hunderte gewesen sein sollen. Sie waren einst ein charakteristischer Schmuck der befestigten Dörfer.
Als wir Napier erreichten, war es bereits Nacht. Ich fuhr in einer Droschke ins Kriterion Hotel, berühmt in ganz Neuseeland durch seine grossartige und kostspielige Anlage, sowie auch durch die Marotte des reichen Besitzers, der diesem unrentirlichen Institut zu Liebe jährlich einen Theil seines Einkommens zusetzt.
Napier, ein Städtchen von 3000 Einwohnern, ist auf und um einen Sandsteinfelsen gebaut, der isolirt mitten aus niedrigen marschigen Ufern in die weite Hawkes Bay hineinragt und nur durch einen schmalen, theilweise von Menschenhand gebildeten Deich mit dem Hauptland zusammenhängt. Nach innen eine Lagune, nach aussen der weite Ozean, ohne Unterlass seine Wogen gegen flache Dünen heranrollend, sind die Begrenzungen. Falls die Brandung hier jahraus jahrein mit derselben Heftigkeit fortdonnert, wie ich sie während der zwei Tage meines Aufenthalts gehört, beneide ich die Bewohner Napiers nicht um ihre so malerische Lage. In den Häusern am Strande konnte man damals nur schreiend und mit dreifachem Kraftaufwand konversiren.
Ein Theater in »Oddfellows Hall«, ein Lesekabinett »Athenäum« genannt, wie es in jedem Städtchen Neuseelands zu finden ist, eine Irrenanstalt und ein Gefängniss, die Post und die Provinzialregierung sind die öffentlichen Gebäude, alle natürlich von Holz, aber stylvoll konstruirt, um welche sich, theils zu geschlossenen sauberen Strassen gereiht, theils mit Gärten umgeben, Häuser jeglichen Grades von Kultur gruppiren bis hinab zu den aus Brettern und Leinwand, aus Blechfetzen und Pappendeckel lumpig zusammengeflickten Hütten der ärmeren Maoris.