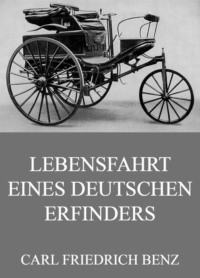Kitabı oku: «Lebensfahrt eines deutschen Erfinders», sayfa 2
Hygienisches.
Das Fahren im M. bewirkt wie jede mechanische Gymnastik eine regere Tätigkeit des gesamten Organismus, besitzt aber den sonstigen gymnastischen Methoden gegenüber bemerkenswerte Vorzüge. Der Zimmergymnastik gegenüber kommt insbes. der frische Luftstrom in Betracht, der in angenehmer Weise Haut- und Lungentätigkeit anregt und damit eine höchst vorteilhafte Entlastung der inneren, mit Blut vielfach übersättigten Organe herbeiführt. Das Reiten erscheint vielen Leuten zu scharf, das Fahren im gewöhnlichen Wagen ohne Luftreifen als zu hart; demgegenüber besteht das Fahren im M. in einem sanften und leichten Dahinschweben, das sich in gleich angenehmer Weise fühlbar macht, wie etwa das Kahnfahren auf stillem Wasser. Die harten Stöße der Straße werden bei der tiefen Schwerpunktlage des Fahrzeuges durch die Pneumatiks und Federn fast vollständig aufgenommen, so dass sich nach einer langen Fahrt nicht etwa wie beim Ausstieg aus einer gewöhnlichen Droschke oder einem Eisenbahnwagen das Gefühl der Ungelenkigkeit und Steifigkeit einstellt, sondern das einer angenehmen Ermüdung, wie sie sich etwa nach einer lustigen Klettertour durch gesteigertes Schlaf- und Hungergefühl bemerkbar macht. Mit der wohltuenden Ausspannung durch die landschaftliche Szenerie und der Entlastung der inneren Organe geht Hand in Hand eine höchst vorteilhafte Einwirkung auf die Nerven; allerdings sind hierbei einige Vorbedingungen zu erfüllen: nicht langsam dahinbummeln, aber auch nicht rasen, sondern ein Mitteltempo, und zwar systematisch morgens und mittags, im Sommer und Winter bei jedem Wetter, wenn nötig mit Brille, Lederhandschuhen, Pelz etc. ausgerüstet. Infolge der wohltuenden Wirkung auf die Nerven finden wir gerade unter den Gehirnarbeitern enthusiastische Anhänger des Motorwagens.
Geschichtliches.
Im 15., 16. und 17. Jahrh. finden wir in China, England, Holland und auch Deutschland Wagen ohne Pferde, bewegt von Menschen, die sich im Innern des Wagens befanden; diese Wagen waren meist mit elegantem Schnitzwerk versehen. Den ersten, wenn auch nicht lange brauchbaren M., einen Dampfwagen, konstruierte Cugnot 1769. Um 1785 baute der Assistent Watts, William Murdock, einen Dampfwagen, ebenso William Symington, Francis Moore, Robert Fourneß, James Ashworth, desgleichen der Amerikaner Evans seinen Amphibium-Dampfwagen, der »zu Wasser und zu Lande« fahren sollte; auch Trevithick ließ 1801 einen großen Dampfwagen laufen. Zu Anfang des 19. Jahrh. beschäftigte sich Blenkinsop, Brunton, Nasmyth, Gurney, Hancock, namentlich aber Gordon mit dem Dampfwagenbau; letzterer baute einen Wagen, der mit Krücken versehen war, die den Gang der Pferdefüße nachahmten. 1827 erschien die Stephensonsche Lokomotive, in der zwar das Prinzip des Selbstfahrers verwirklicht war, die aber doch nur eine halbe Lösung des Verkehrsproblems bedeutete, denn ihr Betrieb war an eine festgelegte Organisation, Zeit und Ort gebunden. Die Bestrebungen, Selbstfahrer zu bauen, die im Gegensatz zur Eisenbahn eine individuelle Benutzung gestatten, hörten deshalb mit der Erfindung der Eisenbahn nicht auf; ja, es trat sogar mit der Erfindung der Lokomotive ein ungeahnter Aufschwung des Dampfwagenbaues ein; so sollen um 1833 in London über 20 Dampfwagen im Gebrauch gewesen sein. Das Jahr 1865 brachte ein Gesetz, das die Geschwindigkeit der Wagen für offene Strecken auf 4 engl. Meilen und für Ortschaften auf 2 engl. Meilen pro Stunde vorschrieb, was den völligen Ruin der englischen Automobilindustrie bedeutete. England trat seine Rolle an Frankreich ab, woselbst Bollée seit 1873 mehrere Wagen baute, desgleichen Graf de Dion in Verbindung mit Bouton und schließlich Serpollet.
Einen neuen Impuls erfuhr der Bau von M. durch die beiden deutschen Techniker Daimler und Benz, die, unabhängig voneinander, um die Mitte der 1880er Jahre den Explosionsmotor so ausbildeten, dass er den automobilen Bedingungen in fast idealer Weise genügte. Wie aber jede große Erfindung nicht als Folge eines einzigen technischen Fortschritts aufgefasst werden kann, so darf auch die Bedeutung des »leichten Explosionsmotors« für den modernen Automobilbau nicht überschätzt werden; auch das Automobil ist als das Produkt des organischen Zusammenwirkens der technischen Gesamtentwickelung aufzufassen, und man kann beispielsweise nicht sagen, welche Erfindung für den modernen Automobilbau die wichtigste ist, die Erfindung des leichten Motors, oder des Pneumatiks, oder sonst eines Automobilbestandteils; keine dieser Erfindungen hätte zum Ziele geführt, wäre sie nicht begleitet gewesen von den übrigen technischen Errungenschaften; deshalb gilt auch nicht das Jahr 1880 als Geburtsjahr des modernen Automobilismus, sondern das Jahr 1895, denn um diese Zeit war die Ausbildung des modernen Automobils in allen seinen Teilen bereits so weit gediehen, dass die Pariser Zeitung »Le Petit Journal« ein Automobilrennen inszenieren und ein Preisausschreiben erlassen konnte, womit sie die Aufmerksamkeit der Sportskreise auf das neue Fahrzeug lenkte. Die Entwickelung vollzog sich zunächst fast ausschließlich in Frankreich, wo es Levassor gelungen war, unter Verwendung der Arbeiten früherer Techniker sowie derjenigen von Daimler und Benz einen Gesamtaufbau des Motorwagens zu schaffen, der im wesentlichen bis auf den heutigen Tag beibehalten worden ist.
Wirtschaftliches.
Wenn der M. heute noch in hohem Maße Sportszwecken dient, so teilt er diese Entwickelung mit dem Fahrrade, das sich vom Sportsfahrzeug im Laufe der Zeit zum unentbehrlichen und volkstümlichen Verkehrsmittel entwickelt hat. Der M hat indes diesen Entwickelungsgang heute schon zu einem großen Teil zurückgelegt; denn in aller Stille ist er in die verschiedensten Zweige des modernen Wirtschaftslebens eingedrungen und in der gesamten Fachliteratur steht der Gebrauchswagen im Vordergrunde des Interesses. Von den verschiedenen Arten solcher Wagen sind, abgesehen von den Personenwagen, am verbreitetsten die Lieferungswagen, die den größeren Geschäften zur Überbringung der Waren an die Kunden dienen, und die Lastwagen, wie sie namentlich von Brauereien, Fabriken, Spediteuren etc. in immer umfangreicherem Maße verwendet werden. Die Ursache, weshalb solche Betriebe von den Lieferungs- und Lastwagen so willig Gebrauch machen, liegt weniger darin, dass die Betriebskosten erheblich reduziert wurden gegenüber dem Pferdebetrieb, als vielmehr darin, dass der M. schneller ist und deshalb erhebliche Zeitersparnisse ermöglicht. Auch in der Armee und im Postdienst gewinnt seine Verwendung fortwährend an Ausdehnung. Ein ungeahntes Feld hat sich ihm in der Unterstützung der Eisenbahn durch die Automobilverbindungen eröffnet, indem sich besonders in weniger bevölkerten Gegenden, wo eine Eisenbahn nicht angezeigt erscheint, in neuerer Zeit Vereinigungen von Kapitalisten zur Einrichtung von Automobilverbindungen bilden. Für den großstädtischen Verkehr lassen den M. seine Schnelligkeit, leichte Lenkbarkeit und die Möglichkeit der raschen Bremsung wie geschaffen erscheinen. Wenn die früheren Versuche, das Automobil in Form der Motordroschke in Großstädten einzuführen, vielfach finanziell versagten, so ist dies auf technische und wirtschaftliche Gründe zurückzuführen. Bei dem gänzlichen Mangel an praktischen Erfahrungen und feststehenden Modellen fehlte die kalkulatorische Grundlage für die Rentabilitätsberechnung. Heute, wo man es mit ausprobierten, feststehenden Modellen zu tun hat, die Amortisationsquote, Betriebs- und Reparaturkosten auf Grund mehrjähriger Erfahrung bekannt sind, liegen die Verhältnisse anders, und nun zögert das Großkapital nicht mehr, diesem neuen, gewinnabwerfenden Verkehrsunternehmen mit großen Mitteln an die Hand zu gehen.
Der ungeahnte Aufschwung des Motorwagens als Sports- und Gebrauchswagen hat eine blühende Industrie entstehen lassen, die allem Anscheine nach in den Mittelpunkt der gesamten industriellen Entwickelung treten wird und nur in dem seinerzeitigen wirtschaftlichen Aufschwung der elektrischen Industrie Ihresgleichen wieder findet. An der Spitze aller automobilproduzierenden europäischen Völker steht Frankreich. Die enorme Entwickelung der französischen Automobilindustrie zeigen die folgenden Zahlen (in Franken):

Etwa 200 Motorwagenfabriken (abgesehen von den Sonderfabriken für Motorwagenzubehörstücke) fabrizierten 1904 ca. 22,000 M. im Gesamtwerte von 178,500,000 Frank.
Die Ziffern der deutschen Handelsstatistik sind weit niedriger; es betrug in Mark:

In Deutschland beschäftigen sich mit der Herstellung von M. ca. 15 Fabriken, abgesehen von den Sonderfabriken für Motorwagenzubehörstücke. Die Erzeugnisse der deutschen Werke erfreuen sich in der gesamten automobilistischen Welt eines glänzenden Rufes und gelten den erstklassigen französischen Wagen gegenüber in mancher Beziehung als überlegen.
Die englische Motorwagenindustrie hat keine so rasche Entwickelung nehmen können, weil das englische Kapital infolge früherer finanzieller Misserfolge selbst heute sehr zurückhaltend ist und mehr der französischen Industrie zuströmt. Die Ausfuhr ist verhältnismäßig gering. Der italienische M. war bis vor kurzer Zeit nur gering entwickelt, hat aber neuerdings einen ungeahnten Aufschwung genommen, so dass es Frankreich und Deutschland gegenüber als ernster Konkurrent auftritt. Auch die schweizerische Motorwagenindustrie hat in jüngster Zeit einen bemerkenswerten Aufschwung genommen. Österreich-Ungarn besitzt einige anerkannte Fabriken, doch ist die Einfuhr deutscher und französischer M. nicht unbeträchtlich.
Vereine.
Von den im Laufe der Zeit entstandenen automobilistischen Vereinigungen und Klubs haben sich weitaus die meisten zu nationalen Verbänden zusammengeschlossen. Von ausländischen Klubs sind zu nennen: der Französische Automobilklub (Paris), der Englische Automobilklub (London), Österreichischer Automobilklub etc.; von deutschen Automobilklubs: der Bayrische, Frankfurter, Kölner, der kaiserliche Automobilklub in Berlin, der Mitteleuropäische Motorwagenverein (Sitz Berlin), die Automobiltechnische Gesellschaft (Sitz Berlin) etc.; sie haben sich unter der Bezeichnung »Deutscher Automobilverband« (Sitz Berlin) zusammengeschlossen. Neben der Veranstaltung von Vorträgen, Aussetzung von Preisen, Veranstaltung von Ausstellungen, Einschreiten gegen rücksichtslose Schnellfahrer, Zustellung von Fachzeitschriften, ermäßigte Überlassung von Landkarten, Fachliteratur etc. suchen sie vor allen Dingen ihren Zweck zu erfüllen durch Veranstaltung von Zuverlässigkeitsfahrten und ähnlichen Konkurrenzen, auch durch Rennen. Diese Rennen betrachten sie nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zu immer vollendeterer Ausbildung des Motorwagens als Verkehrsmittel; auch die gründlichsten Studien in den Laboratorien unsrer Hochschulen und der Konstruktionsbureaus der industriellen Werke hätten das nicht erreicht ohne die Rennen, d.h. praktische Erprobung der M.; die Rennen scheiden mangelhafte Fabrikate rasch und sicher aus und geben die Richtung an, die Technik und Industrie zur Erzielung immer vollendeterer Fabrikate einzuschlagen haben. Die Tätigkeit der Automobilklubs etc. ist also auch in dieser Richtung von unschätzbarer industrieller und damit volkswirtschaftlicher Bedeutung. Zu erwähnen ist noch der Verein deutscher Motorfahrzeug-Industrieller als Interessenvertretung der industriellen Unternehmer, der neuerdings ähnlich wie in Frankreich zu großem Einfluss gelangt ist.
Rechtliches.
Das Automobil untersteht bisher in privatrechtlicher Beziehung, insbes. bezüglich der Haftpflicht für angerichteten Schaden, den allgemeinen Normen des bürgerlichen Rechts. Dagegen bestehen fast überall besondere öffentlich rechtliche (Polizei-) Vorschriften bezüglich des Automobilverkehrs. In Preußen und den meisten übrigen deutschen Staaten müssen die Automobile betriebssicher sein. Erregung übermäßigen Geräusches, Rauches und Geruchs ist unstatthaft. Die Lenkvorrichtungen müssen ein Umwenden auf 10 m breiten Dämmen ermöglichen. Jeder Kraftwagen muss eine Huppe, zwei Vorderlaternen und zwei voneinander unabhängige Bremsen führen (für Motorräder bestehen einige Erleichterungen). Jedes Automobil erhält nach vorheriger Untersuchung eine Erkennungsnummer, die nebst einem Buchstaben (zur Bezeichnung der Provinz) beim Befahren öffentlicher Wege geführt werden muss. Für den Zustand des Fahrzeugs, namentlich der Bremsen, ist der Eigentümer (oft auch der Besitzer) polizeilich verantwortlich. Der Führer muss im Besitz eines Befähigungsscheines sein (das Recht der Polizei auf Fahrscheinentziehung ist mit Erfolg angefochten worden). Die Sperrung der Straßen für Automobile ist zulässig. Die Geschwindigkeitsgrenze beträgt in der Regel 15 km (gestreckt trabendes Pferd), höher ist sie nur außerhalb der Bebauungsgrenze auf geraden übersichtlichen Wegen. Strafen: Geldstrafe bis 60 Mk. oder Hast bis zu 14 Tagen.
Vgl. Baudry de Saunier, Das Automobil in Theorie und Praxis (deutsch, Wien 1900–01, 2 Bde.; neuer Abdruck 1905), Praktische Ratschläge für Automobilisten (deutsch, das. 1901) und Grundbegriffe des Automobilismus (deutsch, das. 1902); Hasluck, Automobile (neue Ausg., Lond. 1903); Zechlin, Der Automobilsport (Leipz. 1903) und Automobilkritik (Berl. 1905); Lang, Die Adler-Fahrradwerke vormals Heinrich Kleyer, Festschrift (das. 1905); Vogel, Der M. und seine Behandlung (das. 1906); Jahrbuch der Automobil- und Motorbootindustrie (das., seit 1904); Zeitschriften: »Der M.« (das.); »Zeitschrift des Mitteleuropäischen Motorwagenvereins« (das.); »Stahlrad und Automobil« (Leipz.); »Allgemeine Automobilzeitung« (Münch.); »Das Fahrzeug« (Eisenach); »Automobilwelt« (Berl.); »L'Auto« (Par.); »L'Automobile« (Nizza); »La France Automobile« (Par.); »La Locomotion automobile« (das.); »Le Chauffeur« (das.); »The Autocar« (Coventry); »The Motor-Car Journal« (Lond.); »The Horseless Age« (New York); Walloth, Der Automobilismus auf öffentlichen Straßen (Wiesbad. 1904); Meili, Die rechtliche Stellung der Automobile (Zürich 1902); Rixeus u. Lafont, Législation et jurisprudence du cyclisme et de l'automobilisme (Par. 1902); Isaac, Das Recht des Automobils (Berl. 1905).
Lebensfahrt eines deutschen Erfinders
Im Feuerschein der Dorfschmiede
Wenn ich als achtzigjähriger Mann von den weißen Firnhöhen des Lebens hinunterschaue ins Land der Kindheit, dann ist es mir, als müßte ich wieder heim – ins Jugendland. Blaue Berge tauchen auf in verschwimmender Ferne, ein Tal, durch das ich in herzhafter Ferienfreude weiß Gott wie oft gewandert, wird im Vordergrund ganz deutlich sichtbar. Ein trauliches Tal, mit Wiesen im Grunde und dem schäumenden Bache.
Tannen klettern an den Hängen empor, und oben träumt zwischen Sonnenglanz und Waldesschatten ein Dörflein so einsam, wie eben nur Schwarzwalddörfer einsam träumen können.
Pfaffenroth heißt das liebe Nest. Es ist die Heimat meiner Väter. Hier oben in diesem grünen Erdenwinkel regierten meine Groß- und Urgroßväter.
Fürsten waren meine Vorfahren allerdings keine – nichts als schlichte Bauernsöhne ihrer wälderischen Heimaterde. Aber sie regierten doch – als Bürgermeister ganze Generationen hindurch.
Von meinem Großvater weiß ich zum Beispiel, daß er als Schulze des Dörfleins Schicksale 27 Jahre lang in guten und bösen Tagen in Händen hielt. Wer ihn amtlich aufsuchen mußte, kam immer vor die rechte Schmiede. Denn er war der Mann, der das Lied der Technik vom Amboß seiner Werkstätte aus hell und laut hinausklingen ließ in die Stille des Dorffriedens. Wenn er den großen Hammer schwang, daß die Funken sprühten, dann mußte das glühende Eisen sich formen und biegen nach seinem Willen.
Heute noch steht die Dorfschmiede, in der mein Großvater Michael Benz (geb. 1778, gest. 1843) schon im Zeitalter Napoleons sich die Sorgen vom Herzen herunterhämmerte.
Diese Dorfschmiede bestand aber auch schon jahrhundertelang vor Napoleons Zeiten, in ihr hatte mein Stammbaum seinen Wurzelboden.
Wer einen Blick auf seine Ahnenreihe wirft, wird in der Regel überrascht sein, wie die Vorfahren in buntem Wechsel gekommen und gegangen sind. Bauern und Handwerker, Lehrer und Kaufleute, Apotheker und Doktoren lösen im Laufe vieler Generationen einander ab. Das ist bei mir ganz anders.
Ich sehe meine Vorfahren in einer langen Linie hintereinander gereiht; alle haben das Schurzfell vorgebunden und den Hammer in der Hand – alle sind Schmiede bis herab zum Großvater und Vater. Wenn ich mir das heute alles überlege, dann wird es mir klar, warum ich vor Freude in meinem Leben immer in die Hände klatschen mußte beim Singen des Liedes: »Wenn ich an meinem Amboß stehe.« Meine Vorfahren, die alle in irgendeiner Gehirnzelle, in irgendeinem Blutstropfen oder in irgendeiner Herzfaser in mir weiterleben, wollen eben offenbar bei dem Liede alle mitsingen und aus mir herausjauchzen. Und daher mußten die freudeklatschenden Hände noch die Rolle von schwingenden Stimmbändern übernehmen. –
Mein Großvater hatte zwei Söhne und eine Tochter. Der ältere, 1809 geborene Sohn hieß Hans Georg, der jüngere Anton. Beide sind des Hauses Tradition treu geblieben und wurden Schmiede. Während aber der »Schulze-Toni« im Ort blieb und auf dem Amboß der Urahnen seines Glückes Schmied zu werden versuchte, nahm Hansjörg das Felleisen und zog in die Welt. –
Vater und Mutter
Im April 1843 wurde die Eisenbahnstrecke Karlsruhe-Heidelberg eröffnet. In eine neue Welt der Wunder führte die eiserne Schienenspur. Die von allen Seiten herbeigeströmten Neugierigen wunderten sich über die unerhörte Geschwindigkeit, mit der die Dampfmaschine samt den angekuppelten Wagen über die Schienen rollte.
Auf der Maschine aber steht einer, den die treibend süße Wandersehnsucht im Herzen einst von den Tannenhängen seines stillen Waldtales hinausgeführt hatte in das laute Wirtschafts- und Verkehrsleben der Stadt. Es ist unser Hansjörg. Glückstrahlend steht er da oben. Seine Jugendträume sind erfüllt. Stolz ist er darauf, daß man die Führung des neuen, eisernen Verkehrsriesen seinen Händen anvertraut hat. Aber auch ich bin stolz auf diesen Mann, der auf einer der ersten Lokomotiven Badens einer neuen Zeit entgegenfuhr, jener Zeit, die ein eisernes Schienennetz um den Erdball spannte.
Ich bin stolz auf ihn, wenn ich ihn auch nie gekannt habe; denn er ist mein Vater.
Leider habe ich ihn nie gekannt. Am 26. November 1844 bin ich in Karlsruhe zur Welt gekommen. Und schon 1846 kamen eines Tages schwarze Männer und trugen meinen Vater fort, dorthin, woher keiner mehr zurückkehrt, auf den Friedhof. Sie trugen ihn fort und mit ihm unser Glück. Den glückstrahlenden Führer hatte der Tod auf der Maschine an die Hand genommen und ließ ihn nicht mehr los. Als Opfer seines Berufes ist er gleichsam in den Sielen gestorben.
Wer von Karlsruhe nach Heidelberg fährt, der kommt vorbei an der Station St. Ilgen. Hier war es, wo ein Weichenwärter zu meines Vaters Zeiten eine Weiche falsch gestellt hatte. Infolgedessen entgleiste eine Maschine, nicht die des Vaters, sondern die eines Kollegen. Aber der Vater wurde von dem Führer der entgleisten Lokomotive und dem Weichenwärter zu Hilfe gerufen. Diese fürchteten nämlich eine empfindliche dienstliche Strafe zu bekommen. Mein Vater konnte ihnen die Bitte nicht abschlagen, obwohl bei den wenigen ins Vertrauen gezogenen Männern die Hebearbeiten sich recht anstrengend und schwierig gestalten mußten. Unter Aufbietung aller Kräfte half der Vater die Lokomotive wieder auf die Schienen stellen. Schweißtropfen rinnen dem hilfsbereiten Mann über die Stirne. Man sieht ihm an, daß er das Letzte hergegeben hat. Aber er darf nicht säumen. Seine Aufenthaltszeit ist abgelaufen. Stark erhitzt stellt er sich auf seine eigene Maschine. Der verantwortungsbewußte Führer kennt keine Rücksicht auf sich und seinen erhitzten Zustand. Er kennt auf der eisernen Schiene nur die eiserne Pflicht. Das aber wird ihm zum Verhängnis. Denn sein Führerstand ist noch – zum Unterschied von heute – ungeschützt.
Einige Tage später. Mein Vater hat den Führerstand vertauscht mit dem Krankenbette. Eine heftige Lungenentzündung warf ihn infolge der zugezogenen Erkältung nieder. Aber seiner Lokomotive ist er treu geblieben. Sie steht neben ihm am Krankenlager. Sie schwebt ihm vor in Schmerzensträumen. Und in den höchsten Fiebern spricht er immer wieder von seiner Lokomotive.
Auf einmal wird es still in ihm, ganz still. Die Lokomotive ist verschwunden und mit ihr alles Fiebern und Denken und Träumen. Die schlimme Krankheit hat den willensstarken Sechsunddreißigjährigen rasch hinweggerafft.
Was mir der tote Vater als Erbe zurückließ, war fast nichts als das leuchtende Beispiel der ethischen Forderung: »Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.«
So war ich denn mit zwei Jahren vaterlos geworden. Aber ich hatte ja noch eine Mutter. Sie war die beste Mutter von der Welt.
Ich schließe die rechte Schublade meines Schreibtisches auf. Drin liegt etwas. Das habe ich gehütet wie ein Kleinod mein Leben lang. Eine Linse – einst geschenkt von meiner armen Mutter. Wenn ich durch diese Linse schaue- und ich habe es in den 80 Jahren meines Lebens mehr als tausendmal getan –, da sehe ich sie wieder vor mir, ganz wie sie war, groß wie ein Held. Nur ein Held konnte das traurige Schicksal, in das wir nach des Vaters frühem Tode geraten waren, so meistern, wie diese tapfere Frau es meisterte. Nichts ist im Kampfe gegen die Not so stark wie Mutterliebe. Wie eine Mutter schon bei der Geburt ihr Leben einsetzt für das Kind, so kann sie hungern und frieren, kann leiden, entbehren, sorgen, sparen und lachen unter Tränen, wenn nur das Kind lacht und fröhlich ist.
Als der Vater die Augen geschlossen hatte, da wollte mir meine treffliche Mutter beides zugleich sein: Vater und Mutter.
»Kommt, laßt uns unseren Kindern leben«, dies schöne Wort beseelte sie nun ganz und gar. Sie war groß, schlank, schlicht. Aus ihren Augen leuchtete die Herzensgüte. Aber auf ihrer Stirn lag ein Ausdruck von Kraft, von Willenskraft und Tatkraft.
Sie hatte selbst eine harte Jugend hinter sich. Ihr Vater war der Eroberungssucht jenes Mannes zum Opfer gefallen, unter dessen klirrendem Schritt die halbe Welt erdröhnte. Bekanntlich lastete das korsische Joch der Fremdherrschaft so schwer auf uns, daß unsere Großväter gezwungen werden konnten, mit Napoleons »Großer Armee« nach Rußland zu ziehen. Dort, wo unter dem Eishauche des Todes die Leichen der Erschlagenen, Erfrorenen und Verhungerten den Weg säumten, blieb auch der badische »Feldgendarm«, der Vater meiner Mutter. Nur einmal hat man noch über sein Schicksal von einem anderen Kriegsteilnehmer etwas gehört. Demnach soll mein Großvater mütterlicherseits mit anderen Reitern in einem Schuppen über Nacht geblieben sein. Die Pferde standen unten, und darüber auf einem Heuboden schliefen die Reiter. In der Nacht zeigten sich die Pferde unruhig. Der Großvater ging hinunter, um nach der Ursache zu sehen, und war von da an – seine Kameraden kümmerten sich nicht weiter um sein Schicksal – verschwunden. Es ist anzunehmen, daß er bei einem feindlichen Überfall niedergemacht wurde.
Das war die korsische Faust; sie preßte Blut aus und Tränen. Und von diesen Tränen der Sorge und der Not wußte meine Mutter aus ihren Kindheitstagen gar viel zu erzählen.
Jetzt wollte sich die leidgebeugte, aber von ihrer Jugend her auch leidgestählte Frau auf meinem Lebenswege neben mich stellen, zunächst als Vorkämpferin, später als Mitkämpferin. Denn bei der kleinen Pension, die sie vom Staate bekam, hatte das Wort vom »Kampf ums Dasein« einen sorgenvollen Klang. Alles opferte sie, selbst ihr bescheidenes Vermögen, um ihrem Sohne eine gute Erziehung und Bildung zu geben. Mit weichen Händen – Mutterhände sind immer weich – hob sie das kleine Stück Leben hinauf ins Licht, damit es wachse und gedeihe. Nicht wild sollte es der Sonne entgegenwachsen. Frühzeitig gab sie ihm eine feste Stütze zum Empor- und Weiterranken. Und diese wegweisende Stütze hieß: Gymnasium. Doch ich eile voraus. Verweilen wir zunächst noch beim kleinen Carl.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.