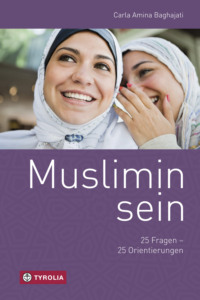Kitabı oku: «Muslimin sein», sayfa 2
Zum Buch
„Eine gute Frage ist die Hälfte der Wissenschaft“4: Dies begründet die vorliegende Form, die Kapitel mit Fragen zu überschreiben. In muslimischen Kreisen gehört manchmal Mut dazu, eine Frage zu formulieren, in der fundamentale Kritik an bestehenden scheinbaren Selbstverständlichkeiten steckt. Diese Fragen können somit einen Prozess in Gang setzen, der auch die Theologen in die Pflicht nimmt, stärker dem zutiefst islamischen Anspruch zu entsprechen und bei Berücksichtigung der Quellen Koran und Sunna die Lebenswirklichkeit der Gläubigen einzubeziehen. Die Angst, nur mehr zeitgeistig irgendwelchen Trends hinterherzulaufen und allerlei Meinungsmachern nach dem Mund zu reden, bremst hier leider oft. Offenheit für die Moderne ist aber eine theologische Notwendigkeit. Sonst ginge ein wesentlicher Anspruch des Islams verloren: „Erleichterung von der Bedrängnis“5. Darin steckt eine emanzipatorische Kraft, die gerade in der Frage der Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit zu nutzen ist.
Auch Fragen aus der Außensicht sind wertvoll, weil sie dazu einladen, Unterschiede zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung zu entdecken. Wer sich ehrlich auf eine Beantwortung einlässt, muss eigene Standpunkte überprüfen.
Selbstverständlich kann es auf viele Fragen keine letztgültige Antwort geben. Die Beiträge verstehen sich als Teil eines spannenden Prozesses, in dem die Leserinnen und Leser selbst als Agierende angesprochen sind. Manchmal werden Fragen auch neue Fragen aufwerfen. Auf jeden Fall sollen die Texte aber Orientierung bieten, gewisse Erscheinungsformen gerade des Alltags und des Zusammenlebens besser einordnen zu können. Praktische Vorschläge, wie in auftretenden Situationen eine zielführende Handlungsweise aussehen könnte, dürfen dabei nicht fehlen. Oft geht es um ein gemeinsames Ausloten von Möglichkeiten.
So soll das Buch Dialogerfahrungen nicht nur würdigen, sondern auch ein Stück erlebbar machen. Fragen – und gerade die „dummen“ oder provokanten Fragen – regen zu kritischer Selbstreflexion an und liefern wertvolle Denkanstöße. Der Dialog unter Frauen – sei es auf interreligiöser Ebene bereits seit den 1990er-Jahren, sei es zwischen der Frauenrechtsbewegung und Musliminnen – hat in Österreich wesentlich dazu beitragen können, mehr gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Viele der nachfolgend aufgenommenen Fragen stammen daraus. Frauen können nicht nur viel voneinander lernen, sondern werden entdecken, dass bei der Vielfalt der Zugänge letztlich gemeinsame Interessen vorhanden sind. Das „Wir Frauen“ kann so neue Bedeutung in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft gewinnen.
Dass auch Männer Partner in diesem Prozess sein können, ist von immenser Bedeutung. Sie können als Multiplikatoren ein wichtiges Sprachrohr sein, wenn sie etwa die Kanzel der Moschee nutzen, um Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit zu wecken. Mit dem Begriff der Geschlechtergerechtigkeit tun sich viele Muslime, sowohl Frauen wie Männer, leichter als mit „Emanzipation der Frau“, weil er vermittelt, dass der Weg, beiden Geschlechtern gerecht zu werden, auch ein gemeinsamer ist. Gerechtigkeit als universaler Anspruch impliziert ein gemeinsames Interesse. Auch Männer erkennen darüber hinaus zunehmend den Bedarf, ihnen zugeschriebene traditionelle Rollenbilder zu hinterfragen.
Manche der Antworten mögen sehr „theologisch“ erscheinen. Eine seriöse Verankerung in den islamischen Quellen ist aber unumgänglich, wenn erfolgreich gegen verkrustete Haltungen angegangen werden soll. Zu oft wurden Forderungen nach Einstellungsänderungen mit dem Hinweis: „Nicht islamisch argumentiert!“ vom Tisch gewischt. Das betrifft den innermuslimischen Diskurs. Gleichzeitig ist es angesichts aktueller Debatten um die Vereinbarkeit des Islams mit Europa auch wichtig, nicht nur theoretisch zu behaupten, dass Muslime ihre Religion als dynamisch verstehen, sondern dies unter Beweis zu stellen. Das geht nur, wenn auch methodisch Einblick gegeben wird, wie zeitgemäße Auslegungen zugleich den Anspruch der Authentizität erheben können und somit für gläubige Muslime Relevanz gewinnen. Es ist zu hoffen, dass auch Nichtmuslime sich von einer theologischen Argumentation nicht abschrecken lassen, sondern, im Gegenteil, mit Interesse verfolgen, wie das betrieben werden kann. Viele praktische Beispiele sollen dabei helfen, dicht an der Lebensrealität zu bleiben und nicht in reine Theorie abzuschweifen.
Damit es leichter fällt, der Argumentation zu folgen und vielleicht sogar ein Stück vorauszudenken, auf welchem Wege wohl am schlüssigsten eine Beweisführung aufzubauen sein wird, hier einige Hinweise:
Koran und Sunna (Vorbild des Propheten) als Hauptquellen der Auslegung
Erste Quelle ist immer der Koran, für die Muslime Wort Gottes und daher erste Referenz. Als zweite Quelle tritt die Sunna hinzu. Damit ist die vorbildliche Lebensweise des Propheten Muhammad gemeint. Schon zu Lebezeiten galt sein konkretes Handeln als Referenz. Jahrzehnte nach seinem Tod wurden einzelne beispielgebende Geschehnisse von verschiedenen Sammlern systematisch aufgezeichnet. Die Sunna ist darum so bedeutend, weil sie praktische Hinweise liefert, wie konkret in dieser oder jener Angelegenheit vorgegangen wurde. Diese Berichte über das, was der Prophet Muhammad gesagt, getan und gebilligt hat, übersetzen also gewissermaßen das, was der Koran allgemein vorzeichnet, in die Glaubenspraxis. Ohne Zweifel wäre ohne die Sunna das rituelle Gebet in seinem Ablauf nicht ausgeprägt, da im Koran eher die allgemeine Bedeutung und einige Rahmenbedingungen geschildert werden. Der Hadith, der Bericht zur Sunna des Propheten, unterstützt also das Verständnis des Korans, vor allem, wenn es um die religiöse Praxis geht.
Historischer Hintergrund
Für die Koranexegese gibt es mit der Praxis des asbab an-nuzul seit Jahrhunderten eine Methode, die Begleitumstände der jeweiligen Offenbarung oder deren Anlass genau zu analysieren und so Aufschlüsse für das Verständnis zu gewinnen. Die Sunna dagegen bildet ein noch wenig bearbeitetes Feld der Überprüfung von historischen Begleitumständen. Zwar gibt es mit dem asbab al wurud (Anlass des Hadith) eine dem asbab an-nuzul (Offenbarungsanlass) vergleichbare Methode zur Untersuchung, die sich aber schwächer entwickelt hat. Interessant ist zum Beispiel die Erforschung, wann und in welchem Zusammenhang sich Personen aus dem Umfeld des Propheten an eine vorbildhafte Begebenheit erinnert haben, und nicht nur der Kontext, in dem diese stattfand.
Methodisch hat sich sehr rasch eine für die damalige Zeit sehr ausgereifte Wissenschaft zur Überprüfung entwickelt, ob ein Bericht als authentisch in eine Hadithsammlung aufgenommen werden könne. In deren Zentrum steht vor allem die Kontrolle der Überlieferungskette (isnad). Hadithe, also die vielen einzelnen Überlieferungen der Sunna, wurden klassifiziert in verschiedene Kategorien (stark, schwach etc.), die anzeigen, wie relevant ein Hadith zu nehmen ist, je nachdem, wie viele Überlieferer unabhängig voneinander das Gleiche gesagt haben und wie verlässlich deren Charakter und Persönlichkeit eingestuft werden. Die Konzentration auf die Überliefererkette bei der Einordnung eines Hadith sollte ein möglichst neutrales Kriterium zur Bewertung der Hadithe an die Hand geben. Hier schien man Subjektivität eher ausschließen zu können als bei einer Untersuchung des Inhalts eines Hadith.
Denn es entwickelte sich eine Scheu, den Inhalt eines Hadith in Frage zu stellen. Wenn dieser sorgfältig von Überlieferer zu Überlieferer bis auf den Propheten zurückverfolgt werden kann – wie könnte man sich anmaßen, damit vielleicht an einer Aussage des Propheten zu zweifeln? Diese Skrupel bewogen viele Gelehrte im Fall, dass der Inhalt (matn) „eigenartig“ wirkt, dazu, diese Eigenartigkeit im eigenen mangelnden Verständnis zu suchen. Entsprechend wurde an Interpretationen getüftelt, die den Hadith doch im Rahmen des allgemeinen muslimischen Religionsverständnisses einbetten sollten. Schon früh gab es aber auch Stimmen, die ein Hadith, das sich inhaltlich im Widerspruch zum Koran befindet, dann als Beleg für die Beantwortung einer religiösen Frage ausschließen.
Jonathan Brown zeigt diese zwei Ansätze in der Geschichte islamischer Gelehrtentätigkeit auf und schält dabei besonders heraus, dass es sehr wohl auch eine am matn ansetzende Hadithkritik unter namhaften Gelehrten gab, die sich aber gegenüber der vorsichtigen, einzig am isnad orientierten Richtung nicht wirklich durchsetzen konnte.6 Der ägyptische Gelehrte Muhammad Al Ghazali (gest. 1996) belebte diesen Ansatz, den Inhalt (matn) zu analysieren, in seinem viel diskutierten Buch „al-Sunna al-nabawiya bayn ahl al-fiqh wa ahl al-hadith“ (Die Sunna des Propheten zwischen Leuten des Rechts und Leuten des Hadith). Der arabische Titel verrät besonders gut, dass es dem Autor auch um die Schaffung eines Gegengewichts zu der literalistischen Hadithauslegung der ultraorthodoxen Wahabiten beziehungsweise Salafiten (ahl al hadith) ging. Sie würden den Inhalt eines Hadith nicht in Frage stellen und zudem möglichst buchstabengetreu bei der Auslegung vorgehen. Muhammad Al Ghazali stellt die Frage: „Was ist der Wert eines gesicherten isnad bei einem schwachen Text?“7 Als starken Beleg für die Vorgangsweise, einen Hadith abzulehnen, wenn er sich im Widerspruch mit dem Koran befindet, nennt er die Gattin des Propheten Aisha. Sie regte sich auf, als ihr ein Hadith vorgetragen wurde, demzufolge eine verstorbene Person dafür bestraft würde, wenn die Hinterbliebenen um sie weinen. Sie zitierte den Koranvers: „Keine Seele trägt die Last einer anderen.“8 Der Widerspruch zum Koran ließ sie den Hadith zurückweisen. Al Ghazali merkt kritisch an, dass der Hadith trotzdem noch immer in manchen Sammlungen zu finden sei.
Die Kernaussage eines Hadith ist jedoch herauszuschälen und zu trennen von mitgelieferten Begleitumständen. Der Prophet bewegte sich schließlich in einem historischen Kontext, der von vielen vorislamischen Sitten und Gebräuchen bestimmt war. Die Sunna ist so auch eine ergiebige Quelle für die Erforschung des damaligen Zeithintergrunds. Neben der eigentlichen Aussage des Propheten oder seiner Handlung wird er mitüberliefert. Hier gilt es darauf zu achten, dass nicht Gepflogenheiten, die in einem Hadith vielleicht eher beiläufig als Rahmen der Erzählung überliefert wurden, zum noch heute gültigen Maßstab erhoben werden. Dies kann vor allem dann leicht geschehen, wenn eine schwärmerische Sehnsucht nach einer Wiederbelebung der Zeit besteht, in der der Prophet lebte.
Hadithe wurden gefälscht und es gibt eine schon früh einsetzende eigene Forschung, um diese zu entlarven, damit sie nicht für die theologische Auslegung verwendet werden. Auch hier bedient man sich einer historischen Überprüfung, wenn etwa in einer angeblichen Überlieferung Personen auftauchen, die zum behaupteten Zeitpunkt noch gar nicht geboren waren. Mit Fälschungen wurde immer wieder eine gewisse Absicht verfolgt, die theologische Auslegung im eigenen Interesse in diese oder jene Richtung zu lenken. Anders als beim Koran, der als Textkorpus unbestritten ist, hat sich rund um den Hadith eine umfangreiche Forschung entwickelt, um die Berichte Jahrzehnte nach dem Tod des Propheten zu sammeln und zu klassifizieren. Zu Lebzeiten hatte der Prophet immer Wert darauf gelegt, dass keine schriftlichen Aufzeichnungen über seine Aussagen gemacht werden, um eine Verwechslung zwischen Koran und Hadith auszuschließen. Viele Muslime sehen die heute berühmtesten Sammlungen, etwa von Bukhari oder Muslim, aber als fast ebenso gesichert an wie den Koran. Auch das macht es nicht einfach, kritisch mit einzelnen Hadithen umzugehen.
maqasid asch-scharia – Grundprinzipien der Religion
Um bei der Auslegung nicht literalistischen Tendenzen zu erliegen, die starr am Buchstaben festhalten, ist ein Vergleich mit den übergeordneten Zielen der Religion sinnvoll, den maqasid. Damit hat sich der bekannte Gelehrte Imam Abu Hamid Al Ghazali beschäftigt (gest. 1111) und fünf besonders schützenswerte Kategorien ausgemacht: Glaube, Leben, Verstand, Familie, Besitz. Daraus hat sich über die Jahrhunderte von Al Shatibi (gest. 1388) bis zu modernen Theologen ein vielschichtiger Diskurs entwickelt, der gerade heute wieder an Aktualität gewinnt. Gesellschaftliche und individuelle Werte wie Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit aller Menschen, Gemeinwohl, Verantwortlichkeit, Prosperität und Wissensdrang haben so auch Eingang in die Anschauung über die maqasid gefunden. Auch das Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit müsste ein Prinzip bilden, das stärker zu berücksichtigen ist.
Exegese – tafsir
Der Koran wurde schon früh interpretiert und daraus sind berühmte Exegeten hervorgegangen. Auch wenn der Koran in seinem Wortlaut von Gott stammt und nicht veränderbar ist, verändert sich doch unser menschliches Verständnis. In die Exegese fließen Methoden ein, wie „den Koran durch den Koran“ zu erklären. Ein Vers oder Textabschnitt wird so durch einen anderen, der vielleicht in einer ganz anderen Sure vorkommt, erläutert. Diese inneren Zusammenhänge werden von den Exegeten hergestellt. Das ist auch darum wichtig, weil dadurch verhindert wird, dass einzelne Verse isoliert betrachtet werden. Selektive Wahrnehmung bildet ein großes Problem immer dann, wenn Verse – oft sogar wissentlich in manipulierender Absicht – fern des Gesamtkontextes betrachtet werden und dann zu völlig falschen Schlüssen führen. Mitunter verwenden Exegeten auch Parallelstellen aus den Heiligen Schriften der beiden verwandten Buchreligionen, Judentum und Christentum. Dies darf aber nicht dazu führen, dass zentrale Aussagen des Korans verfälscht werden. Im vorliegenden Buch wird öfter auf den tafsir von Muhammad Asad verwiesen. Dieser hat den Vorteil, berühmte Exegeten erst zu rezipieren und dann eine eigene Abwägung zu leisten. Als Intellektueller des 20. Jahrhunderts trifft er einen Ton, der dem modernen Leser entgegenkommt.
Aktuelle Kontextualisierung
Eine moderne Auslegung steht vor der Herausforderung, die Lebensumstände heutiger Muslime zu berücksichtigen, freilich ohne in Beliebigkeit zu verfallen und willkürlich eine Anpassung voranzutreiben. Der Prophet selbst wies immer wieder darauf hin, dass es Lebensbereiche gibt, wo der Islam eine klare Linie und Ziele vorgebe und doch ein längerer Prozess von Nöten sei, um durch gesellschaftliche Veränderungen und Bildung schrittweise dieses Ziel zu erreichen. Dies trifft gerade auf die Frage des Verhältnisses der Geschlechter zu. So revolutionär damals viele Maßnahmen gewirkt haben müssen, muss man sich heute mehr deren Zielrichtung vergegenwärtigen, als nur stur nachahmen zu wollen, was damals geschah. Dann können auch im heutigen Kontext Wege gefunden werden, um traditionelle Rollenbilder von Mann und Frau in Richtung Geschlechtergerechtigkeit positiv zu verändern.
GOTTESDIENST
1. Wie stehen Mann und Frau in ihrem Menschsein zueinander?
Eva – Verführerin des Mannes. Eva – Verkörperung der Sünde. Die Frau an sich als Schuldige für die Vertreibung aus dem Paradies. Über Jahrhunderte wurde die abendländische Vorstellung geprägt von dieser Urerzählung, die Frauen potentiell verdächtig machte, den Mann vom geraden Wege abzubringen. Trotz anders lautender wissenschaftlicher christlicher Auslegungen zur biblischen Erzählung vom Sündenfall ist die Vorstellung von der Frau als personifizierte Versuchung tief verwurzelt. Im Mittelalter trug die bildende Kunst dazu bei, in der Neuzeit auch die Literatur, wie etwa John Miltons „Paradise Lost“. Heute beziehen sich Werbestrategen in ihrer Bildlichkeit auf Eva und die von ihr ausgehende Verlockung: Da ein Joghurt mit Botticelli-Eva, dort eine Frau im Evakostüm mit Apfel in der Hand, die sich auf der Kühlerhaube eines Autos räkelt.
Im Koran findet sich die Geschichte des Sündenfalls bereits zu Beginn.9 Ich las die Stelle gleich mehrmals, weil mir irgendetwas gegenüber der vertrauten Version besonders erschien. Eva wurde von Adam nicht beschuldigt, ihn verführt zu haben! Beide tragen zu gleichen Teilen die Schuld, sich über das Verbot hinweggesetzt und vom verbotenen Baum gegessen zu haben. Da packte mich die befreiende Erkenntnis, was das allgemein für Frauen bedeutet: „Ich bin nicht die sündige Eva!“ Dieser Gedanke übt bis heute die gleiche Faszination aus. Wie hatte ich mich im Geschichtsunterricht aufgeregt, dass in mittelalterlichen Wertungslisten eine Frau sogar nach einem Mörder geführt wurde – bloß, weil dieser ja immerhin ein Mann sei.
Von Adam und Eva ausgehend lässt sich das islamische Menschenbild untersuchen. Und wieder war ich in Bann gezogen, dass Mann und Frau in ihrem Menschsein die zentrale erste Erfahrung des Scheiterns und der Wahrnehmung eigener Grenzen teilen, eines Scheiterns, von dem Gott in seiner Allwissenheit vorher Kenntnis hatte. Lernen durch Fehler – das schien hier die Botschaft zu sein. Menschsein inkludiert die Erfahrung der eigenen Endlichkeit und der Anfälligkeit für Fehler – ohne die wiederum keine Entwicklung möglich wäre. Als wäre das Erlebnis der Übertretung notwendig gewesen, um Mann und Frau auf ihr Dasein als Menschen auf der Erde vorzubereiten.
Mann und Frau bereuen ihr Verhalten zutiefst und ihnen wird durch Gottes Barmherzigkeit verziehen. Hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zur christlich-jüdischen Erzählung. An dieser Stelle entsteht ein anderes Narrativ. Gott gibt ihnen für ihre Aufgabe in der Welt, in die sie nun versetzt werden, eine zentrale Erfahrung mit: das Gefühl für Verantwortlichkeit. Konsequenzen des eigenen Handelns sind persönlich zu tragen.
In der tiefen Scham, als ihnen bewusst wird, gegen den göttlichen Willen verstoßen zu haben, fällt ein zentraler Satz: „Wahrlich, wir haben gegen uns selbst gesündigt.“10. Die gleiche Wendung ist immer dann im Koran zu finden, wenn es um die menschliche Erkenntnis eines Fehlverhaltens geht. Was hat es mit dem „Gegen-uns-selbst-gesündigt-Haben“ auf sich? Wäre nicht viel eher zu erwarten, dass es „gegen Gottes Gebot“ heißt? Dahinter steht, dass Gott in Seiner Größe von den Sünden der Menschen unberührt bleibt. Es wäre ja absurd anzunehmen, Er sei angewiesen auf das Wohlverhalten der Menschen. Dies lässt die Formulierung „gegen uns selbst“ plausibel und angemessen erscheinen.
Erst wenn auch das Prinzip der fitrah mitgedacht wird, erschließt sich freilich die ganze Tiefe der Bedeutung. Fitrah bedeutet, dass Gott bei der Erschaffung des Menschen diesem die prinzipielle Erkenntnisfähigkeit in den rechten Weg mitgegeben hat. Mann und Frau, dem Menschen schlechthin, ist nicht nur ein Gewissen mitgegeben, sondern die Möglichkeit, das Gute zu erkennen und danach zu handeln. Folgerichtig ist Adam und Eva bewusst, dass sie nicht nur gegen Gottes Gebot verstoßen haben, sondern eigentlich sich selbst untreu geworden sind. Denn der göttliche „Bauplan“ hat im Menschen eine Art Kompass angelegt, sich nach dem Guten auszurichten. So haben sie gegen sich selbst gesündigt.
Dieses grundsätzlich positive Menschenbild wird ergänzt durch Aussagen im Koran, die auf die Vermessenheit des Menschen, seine Maßlosigkeit und Selbstüberschätzung eingehen. Hier werden die dunklen Seiten des Menschen sehr deutlich angesprochen. Davon ist sogar schon unmittelbar vor der Erschaffung des Menschen die Rede, als die Engel – eigentlich bedingungslos in ihrem Gehorsam gegen Gott – das neue Wesen, das da entstehen soll, geradezu in Frage stellen: „‚Willst du auf ihr einen solchen einsetzen, der darauf Verderbnis verbreiten und Blut vergießen wird – während wir es sind, die Deinen grenzenlosen Ruhm lobpreisen und Dich preisen und Deinen Namen heiligen?‘ Gott antwortete: ‚Ich weiß, was ihr nicht wisst.‘“11 Die Stelle weist auch auf die besondere Rolle des Menschen hin, auf der Welt „eingesetzt“ zu sein. Mann und Frau sind beide als khalifatullah, also als „Statthalter Gottes“ entsandt und tragen damit besondere Verantwortung für die Schöpfung. Dieser Gesichtspunkt wird uns noch einmal beschäftigen, wenn wir auf die politische Repräsentation zu sprechen kommen.
Die absolute Gleichwertigkeit von Mann und Frau als Menschen zeigt sich überall, wo es um das Verhältnis zwischen ihnen geht. Bereits die Geschichte der Erschaffung des Menschen macht die gleiche Bedeutung von Mann und Frau klar. Dazu sei der Beginn der vierten Sure zitiert: „O Menschheit! Seid euch eures Erhalters bewusst, der euch aus einer einzigen lebenden Wesenheit erschaffen hat und aus ihr Partnerwesen erschuf und aus den beiden eine Vielzahl von Männern und Frauen verbreitete.“12 Mann und Frau sind also aus der gleichen Ursubstanz geschaffen und bedingen sich gegenseitig. Sie brauchen einander.
Wenn von der Erschaffung Adams die Rede ist, so als dem Menschen an sich – das Geschlecht ist dabei nebensächlich. Als Gott den Engeln sich vor dem neu geschaffenen Mensch zu verneigen befiehlt, dann nicht als dem Mann, sondern als dem Mensch, dem er soeben von Seinem Geist eingehaucht hat und den er die Namen der Dinge gelehrt hat.13 An verschiedenen Stellen taucht die Erzählung von der Schaffung des Menschen auf. Da ist von der Erschaffung „eines sterblichen Menschen“ aus „tönendem Lehm, aus dunklem, verwandeltem Schleim“14 die Rede – es geht um die Schaffung des Menschen an sich. Wenn an verschiedenen Stellen im Koran von den bani Adam, den Kindern Adams, die Rede ist, dann immer als Synonym für die Menschen.
Im Unterschied zur Bibel findet sich im Koran kein Hinweis darauf, dass Eva aus der Rippe Adams geschaffen worden sei. Auch daraus lässt sich also kein hierarchisches Verhältnis begründen. Allerdings ist das Rippenbild unter Muslimen trotzdem verbreitet. Ausgerechnet die Geschichte Evas, von der mich begeistert hatte, dass sie keine Projektionsfläche bietet, die Frau an sich abzuwerten oder in ein bestimmtes negatives Eck zu stellen, wird durch außerkoranische Quellen ergänzt und dadurch in ihrer klaren Aussage verwässert, ja völlig umgedeutet. Eva als „Prototyp“ des Weiblichen kann so doch wieder als „schlechte Kopie des Mannes“, als die Zweitgeschaffene und damit zweitrangige angesehen werden.
Denn in der Sunna kommt dieses Motiv zur Sprache. Da dem Propheten Vorbildcharakter zukommt, bilden diese Zeugnisse der Sunna die zweite Quelle der Theologie gleich nach dem Koran. Viele Fragen der religiösen Praxis wären ohne die Sammlung der Sunna gar nicht zu beantworten. Klassisches Beispiel ist hier das Gebet, dessen ritueller Ablauf vor allem durch das Vorbild des Propheten Muhammad erklärt wird. An der großen Bedeutung und der Unverzichtbarkeit für die Auslegung besteht also kein Zweifel, wenn es um die Sunna geht. Die Sunna wird durch viele Einzelberichte (Hadithe) überliefert.
Dennoch sind Fragen nach der Auslegungstradition aber auch nach dahinterstehenden Interessen angebracht, eine Höherwertigkeit des Mannes zu behaupten und diese durch eine bewusste Auswahl bestimmter Texte und Unterdrückung anderer Texte zu „beweisen“. Der „Rippenhadith“ ist unter Muslimen weit verbreitet und hat eine entsprechende Wirkungsmacht entfalten können. Erstaunlich ist dabei, dass er so klar in Widerspruch zu koranischen Aussagen steht. Viele Muslime nehmen ihn als dermaßen gesichert in seiner Überlieferungskette der Tradenten an, dass sie Scheu haben am Inhalt zu zweifeln. In der Einleitung wurde ja schon beschrieben, wie ein Rütteln am matn, dem Inhalt eines Hadith, viel mehr Skrupel hervorruft, als beim isnad, den Überlieferern, anzusetzen. Es besteht in der Auslegung aber eine Art „blinder Fleck“, gerade wenn es um das Verhältnis der Geschlechter geht. Wer sich hier Denkverbote auferlegt, konserviert traditionelle Sichtweisen, die einer Revision bedürfen.
Für den christlich-muslimischen Dialog ist die Parallelstelle in der Bibel (Genesis 2, Verse 22 bis 24) besonders interessant. Tatsächlich steht zu vermuten, dass Koranexegeten wie Ibn Kathir, der in seinem tafsir eine Überlieferung bringt, die an die Bibelstelle erinnert, nicht unbeeinflusst davon waren. Die so genannten Israeliyat, also Texte der älteren Buchreligionen, vor allem aus dem Judentum, waren damals bekannt und wurden in der Auslegung herangezogen. Es wäre nur fair, wenn dann auch die christlichen Interpretationen dazu unter Muslimen bekannter gemacht würden. Diese gehen nicht immer von einem hierarchischen Gefälle zwischen Mann und Frau aus – wie das oft im Mainstream als selbstverständlich angenommen wird. Ganz im Gegenteil wird Genesis 2, Vers 24, wo Mann und Frau „ein Fleisch werden“, als Beleg für die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau gesehen. Christliche Frauen zitieren gerne ergänzend Genesis 1, Vers 27: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie“ ‚um die Gleichwertigkeit von Mann und Frau zu untermauern. Muslime werden bei diesem Vers stutzig. Im Islam gilt schließlich über Gott: „Nichts ist Ihm gleich.“15. Umso interessanter ist es dann, eine christliche Sicht dazu zu hören: „Die biblische Aussage über den Menschen als Ebenbild Gottes bedeutet keine Gleichartigkeit von Gott und Mensch und schreibt dem Menschen keineswegs etwas Göttliches zu.“16
Im Dialog unter christlichen und muslimischen Frauen ist das Ringen mit den Texten eine spannende Erfahrung und auch ein Prozess. Zu Beginn eines Arbeitskreises kann es vorkommen, dass als frauenfeindlich empfundene Stellen den Teilnehmerinnen der anderen Konfession unter die Nase gerieben werden. Während der Zusammenarbeit kommt dann die Erkenntnis, wie albern es eigentlich ist, solch eine Bestätigung, auf der „besseren“ Seite zu stehen, zu suchen. Am schönsten ist die Erfahrung ehrlicher Freude, mit einer plausiblen Auslegung wieder ein Stück Geschlechtergerechtigkeit gewonnen zu haben – die schließlich allen Frauen zugutekommt. Wie ähnlich oft die Suche nach einem angemessenen Textverständnis ist, kann zudem sehr inspirierend sein.
Generationen muslimischer Frauen bekamen von klein auf zumindest scherzhaft zu hören: „Als Mädchen bist du aus einer krummen Rippe gemacht!“. Welchen Dämpfer solche Herabsetzungen auf das Selbstwertgefühl bedeuten, zeigt sich im Alltag. Schlimmstenfalls internalisieren Mädchen die eigene „Minderwertigkeit“. Besonders im Gedächtnis ist mir die geradezu körperliche Reaktion einer Frauengruppe bei einem Vortrag über den „Rippenhadith“ geblieben. Sie wuchsen, während sie zuhörten. Als wäre das Krumme überwunden, von dem sie so lange bei sich ausgegangen waren, richteten sie sich im Sitzen zu voller Größe auf. Es gab viel Redebedarf, weil alle ins Nachdenken kamen, wie lange sie sich selbst doch künstlich klein gemacht hatten. Erst jetzt wurde ihnen bewusst, dass die Rippengeschichte sie mehr als je angenommen beeinflusst hatte. Die Rolle der Religion wurde heftig diskutiert. Sie sollte uns doch innerlich stärken und nicht verbiegen! Selbstkritisch vermerkten die Frauen auch, dass es wohl mehr Bereitschaft geben müsse, religiöse Behauptungen in Frage zu stellen.
Der pakistanischen Islamwissenschaftlerin Riffat Hassan kommt besonders Verdienst zu, sich der Interpretation des Hadith angenommen zu haben: „Es ist eine zwingende Notwendigkeit für die muslimischen Töchter Hawwas (Evas) zu erkennen, dass die Geschichte ihrer Unterwerfung und Erniedrigung durch die Hände der Söhne Adams mit der Geschichte der Erschaffung Evas begann und dass ihre Zukunft nicht anders als ihre Vergangenheit sein wird, wenn sie nicht zum Ursprung zurückkehren und die Authentizität jener Hadithe in Frage stellen, die sie ontologisch als minderwertig, untergeordnet und verbogen darstellen.“17
Der „Rippenhadith“ liegt in sechs ähnlich lautenden Versionen vor, wobei hier jene nach Bukhari zitiert sei: „Die Frauen wurden aus einer Rippe geschaffen, und das am stärksten gebogene Teil einer Rippe ist das obere. Wenn du versuchst, sie gerade zu biegen, wirst du sie zerbrechen. Überlässt du sie aber sich selbst, dann bleibt sie gekrümmt“.18 Nicht nur steht der erste Teil in einem klaren Widerspruch zur koranischen Aussage, dass Mann und Frau aus der gleichen Ursubstanz geschaffen seien. Der zweite Teil liest sich ausgesprochen misogyn. Die Wertung einer Frau als „krummes Wesen“, das jeder Erziehung widerstehe und zum Krummsein verurteilt sei, steht vielleicht in noch eklatanterem Widerspruch zu Aussagen im Koran und einem darin verankerten egalitären Geschlechterbild. Auch das Verhalten des Propheten Muhammad passt nicht zu einer derartig frauenfeindlichen Aussage. Er steht für einen respektvollen Umgang mit Frauen; keinesfalls bezeichnete er sie intellektuell als minderbemittelt. Im Übrigen lassen sich auch im Hadith selbst Aussagen finden, die mit dem Bild der „verbogenen Rippe“ nicht zusammenpassen. So heißt es in einer Überlieferung nach Aisha etwa, Mann und Frauen seien Zwillingswesen.19 Diese Kritik setzt am matn, am Inhalt des Hadith, an, der kontradiktorisch zum Koran ist – eine Methode, die, wie bereits aufgezeigt wurde, nicht von allen Muslimen gleichermaßen unbefangen angewendet würde.
So soll auch der Ansatz vom isnad, der Überlieferungskette, her versucht werden. Alle Versionen des „Rippenhadith“ gehen auf den Gleichen Tradenten Abu Hurairah zurück. Andere Personen, die das gleiche berichten, gibt es nicht. Abu Hurairah wurde bereits zu Lebzeiten trotz seiner großen Hingebung zum Propheten auch kritisch gesehen. An seinem Lebenswandel gefiel zum Beispiel nicht, dass er es ausschlug, eine Arbeit anzunehmen. Aisha, eine Gattin des Propheten, auf die viele Hadithe zurückgehen, reagierte sehr ungehalten, wenn er den Propheten in einer Weise zitierte, die offensichtlich nicht stimmen konnte. Oft ging es dabei um Themen, die Frauen betrafen, wobei Abu Hurairah angeblich an mangelndem männlichen Selbstwertgefühl litt und entsprechend zu einer gewissen Frauenfeindlichkeit neigte.20 Der große Gelehrte und Begründer der hanefitischen Auslegungstradition, Abu Hanifah, war darum vorsichtig bei der Heranziehung von Hadithen dieses Tradenten. Es soll auch nicht verschwiegen werden, dass bis in die Moderne ganze Bücher zur Verteidigung beziehungsweise Diskreditierung von Abu Hurairah geschrieben wurden, auch weil sich daran zusätzlich Trennlinien (schiitische contra, sunnitische eher pro) auftun. In diesem Fall wird es nicht leichter, zumindest was die „Fans“ von Abu Hurairah betrifft, den isnad, die Herkunft der Überlieferung, in Zweifel zu ziehen.