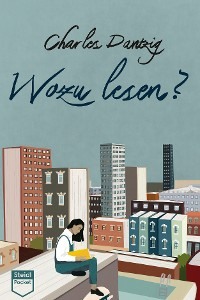Kitabı oku: «Wozu lesen? (Steidl Pocket)», sayfa 2
Lesen verändert uns nicht
Es ist eine beruhigende und zugleich traurige Erfahrung, bei Werken, die man ein zweites Mal liest, die Randbemerkungen der ersten Lektüre mit den aktuellen Anmerkungen zu vergleichen. Ich habe es getan, anfangs eher beiläufig – denn ich bin weder ein so großer Freund noch ein so erbitterter Feind meiner selbst, dass ich beim erneuten Aufschlagen eines Buches sofort prüfe, was ich früher hineingekritzelt habe –, später dann aus Neugier.
Ich stellte fest, dass ich auch nach Jahren noch annähernd dieselben Passagen unterstreiche. Leider bleiben wir uns selbst immer gleich. Das Lesen verändert uns kaum. Vielleicht veredelt es uns ein bisschen, aber ein Drecksack ist und bleibt ein Drecksack, auch wenn er Racine gelesen hat. Aus einem ungebildeten Drecksack ist dann allenfalls ein aufpolierter Drecksack geworden. Umgekehrt wird ein guter Mensch durch die Lektüre eines bösen Buches nicht zu einem schlechten. Dass Bücher einen schlechten Einfluss haben könnten, ist eine ebenso dumme Mär wie die von ihrem guten Einfluss. Die Vorstellung, Literatur sei moralisch (oder unmoralisch, was aufs Gleiche hinausläuft), ist vielleicht notwendig für deren Überleben in einer Welt, die seit Menschengedenken nur das Nützliche liebt.
Was glücklicherweise auch bleibt, ist die Frische des Talents, die uns immer wieder Jubelrufe entlockt, selbst wenn wir ein Buch noch so oft gelesen haben.
Lesen, um sich selbst zu finden
(ohne sich gesucht zu haben)
Ein Buch ist nicht für die Leser gemacht, es ist nicht einmal für den Autor gemacht, es ist für niemanden gemacht. Es ist dafür gemacht, zu existieren. Ein für die Leser gemachtes Buch betrachtet seine Leserschaft als Publikum. Folglich wurde es in einer bestimmten Absicht geschrieben, um zu gefallen oder zu überzeugen, herablassend ist beides. Zum einen gegenüber dem instrumentalisierten und somit weniger guten Werk, weil der Autor seinen Gegenstand aus den Augen verloren hat; zum anderen gegenüber den Lesern, die es kränkt, wenn sie merken, dass man ihnen ihre Urteilskraft abspricht. Welch unverfrorene Demagogie! Man will uns mit Sentimentalitäten ködern? Wir schmuggeln uns lieber heimlich in den Kopf des Autors hinein und holen uns selbst das, was wir wollen. Wenn wir uns in einem Buch wiedererkennen, umso besser, aber darum lesen wir es nicht. Egoistisch heißt nicht narzisstisch. Die Freude ist dann umso größer, wenn uns etwas plötzlich rührt. Man muss immer ein wenig diebisch sein, sonst ist das Lesen zu tugendhaft.
Als ich im Flugzeug diese Zeilen schrieb, machte ich eine Pause, um Thomas Bernhard zu lesen: Der Untergeher, 1983. Übersetzung ins Französische 1986. 1986! Ich hätte sie gleich bei Erscheinen lesen können. Stattdessen tat ich es vierundzwanzig Jahre später, vierundzwanzig Jahre. Vierundzwanzig! Wenn ich an all die grandiosen Dinge denke, die ich im Augenblick meines Todes verpasst haben werde! Was ist die Lektüre doch für ein kapriziöses Geschäft, kapriziös und grausam für die Autoren! So viele übersehene Talente wegen mangelnder Lektüre! Gute Leser müsste man einsperren, damit sie lesen! Man würde ihnen ein Gehalt zahlen, und sie täten nichts anderes als lesend Literatur retten! Vierundzwanzig Jahre! Nun gut, genug Dramatik. Als ich mich nun nochmals mit diesem Schriftsteller befasste, den ich seit langem nicht mehr gelesen hatte, war ich verblüfft über die Vielzahl von Sätzen, die in völlig unveränderter Form mein »Selbstporträt, gezeichnet durch Thomas Bernhard« ergeben würden.
»Im Grunde hasse ich die Natur, sagte er immer wieder. (…)
Die Natur ist gegen mich, sagte Glenn (…)«
»Wir können aber aus diesem Geburtsort weggehen, wenn er uns zu erdrücken droht, von dem Wegund Fortgehen, das uns umbringt, wenn wir den Augenblick des Wegund Fortgehens übersehen. Ich habe das Glück gehabt und bin …«
… aber ich bin es ja gar nicht. Es geht hier nicht um mich, um uns. Es hat etwas Selbstgefälliges, wenn wir in Büchern zu sehr nach dem suchen, was uns gleicht. In Bernhards Beton von 1982 findet man auch folgende Passage:
»Wenn ich ein Buch in der Hand hatte, verfolgte sie mich solange, bis ich das Buch weglegte, sie hatte ihren Triumph, wenn ich es ihr voller Wut ins Gesicht schleuderte.«
Und so etwas habe ich – der Gott der Lektüre kann es bezeugen – niemals selbst erlebt. Jeder Mensch ist einzigartig, das lernt man, wenn man lange genug liest und dabei immer wieder nur Fragmente seiner selbst entdeckt. Es ist nicht unser Abbild, das uns von einem Buch einnimmt, sondern das Talent. Nicht den Figuren oder Gedanken möchte man gleichen. Man möchte dem Talent gleichen.
Der Gott der Lektüre
Der Gott der Lektüre? … Aber den gibt es doch gar nicht. Der Mensch hat sich davor gehütet, ihn zu erfinden. Die Leser wussten nur zu gut, wie gefährlich es gewesen wäre, sich auf diese Weise aufzuspielen. Ein Werk, das Esprit und Sensibilität vereint – wie schrecklich!
Da sich die Spezies der Leser im Übrigen durch steten Rückzug aus dem praktischen Leben unsichtbar gemacht hat, ist es durchaus verständlich, dass sie bis heute keines eigenen Beschützers bedarf.
Gott ist auf der Bibliotheksleiter.
Lesen, um sich auszudrücken
Nach Beendigung seiner Lektüre wird der Leser keinesfalls in den unberührten Zustand einer leeren Datei zurückversetzt. Nein, er wurde bereichert um eine Vielzahl von Sätzen. Faszinierenden Sätzen! Sätzen, die davonflattern wie ein Halstuch im Wind und denen er bis ans Ende der Welt folgen würde. Meine Jugend wurde begleitet von einem Heine-Vers. »Ich weiß nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin«. Ja, wirklich, Die Lorelei, ständig und unermüdlich sprach ich diese Worte auf Deutsch vor mich hin, berauscht davon, ein so schönes Gewand für die Traurigkeit gefunden zu haben, die ich empfand und die ich genoss. Mit der Wahl unserer Lektüre kleiden wir unsere Emotionen ein, legen uns Wörter in unsere stummen Münder, verleihen dem Grummeln unserer Gedanken Eloquenz.
Kaum ein Satz hat mich in diesem Alter mehr beeindruckt als der von Prospero in Shakespeares Sturm (IV, 1): »We are such stuff / as dreams are made on, and our little life / Is rounded with a sleep« – »Wir sind aus solchem Stoff / wie Träume sind, und unser kleines Leben / ist von einem Schlaf umringt.« Überall schrieb ich ihn nieder, murmelte ihn vor mich hin, versuchte, den Sinn zu ergründen, der mich erleuchtet hatte. Oder dies: »Die Nuance, Feindin der Finesse«, von Balzac. Beim Blättern in einem Taschenbuch war ich darauf gestoßen, als ich im Sommer in einem Buchladen arbeitete. Dummerweise hatte ich das Buch zugeklappt und weggestellt, nur um schon zwei Minuten später und für die nächsten zwanzig Tage vergeblich nach der Textstelle zu suchen. Im Grunde zwanzig Jahre lang, denn ich habe sie bis heute nicht wiedergefunden, zumal ich nach einer Weile vergessen habe, um welches Buch von Balzac es sich eigentlich handelte. Oh, du Phantom, wirst du dich vielleicht an meinem Lebensabend offenbaren und mir aus einem seiner Bücher unverhofft entgegenlächeln? Und so werde ich dann, noch bevor ich den Satz zu Ende gelesen habe, meine letzte Ruhe finden.
Ein Tanz im Verborgenen
Bücher sind mehr als Gegenstände, in denen Dinge stehen, die wir suchen und gedankenlos verschlingen. David Grossman spricht in Die Kraft zur Korrektur (2008) von »Büchern, die ihn gelesen haben«. Da ist schon etwas dran: Als Leser ist man den Büchern ausgeliefert.
Bücher leben von ihren Lesern. Sie müssen von ihnen besprochen werden. So verbreitet sich in Teilen des öffentlichen Bewusstseins eine bestimmte Sichtweise, die eben das ist, was die Literatur beisteuern kann. Ideen sind nicht das, was Literatur ausmacht. Es sind die Beobachtungen aus einer so persönlichen Perspektive, dass von ihnen ein ganz eigener intellektueller Reiz ausgeht, dem begeisterte Leser erliegen.
Solche Leser spazieren durch die Straßen, und man merkt ihnen äußerlich nichts an; könnte man jedoch in sie hineinschauen, so sähe man … bei ihr, ja … bei ihm auch … er, nein, er ist undurchsichtig. Und bei dem da ist auch nichts zu sehen, der ist vollgestopft mit Zahlen. Aber er, ja … Und sie … Könnte man in sie hineinschauen, sähe man einen selbstvergessenen Tanz tausender Büchernarren auf der ganzen Welt.
Lesen belebt neu
Wir lesen aus purem Egoismus, bewirken damit jedoch ungewollt etwas Altruistisches. Denn durch unsere Lektüre hauchen wir einem schlafenden Gedanken neues Leben ein. Was ist ein Buch, wenn nicht Dornröschen, was ist ein Leser, wenn nicht ihr Märchenprinz, selbst wenn er eine Brille trägt, kaum noch Haare auf dem Kopf hat und achtundneunzig Jahre auf dem Buckel? Ein geschlossenes Buch existiert, aber es lebt nicht. Es ist ein Quader, wahrscheinlich mit einer feinen Staubschicht bedeckt und nichts als eine leere Schachtel. Man könnte sagen, jede Lektüre ist eine Wiedererweckung. Mallarmé hat übertrieben, als er behauptete, der Leser sei der Schöpfer eines Gedichts. »Wiederbeleber« hätte genügt. Wir sind erwachsen genug, um den Leser, so wichtig er auch sein mag, nicht mit dem Schöpfer eines Werkes zu verwechseln.
Lesen, um die Leichen nicht ruhen zu lassen
Der Leser ist keineswegs so passiv, wie er glaubt. Dem Anschein nach ein Monolog, ist die Lektüre eine Form der Konversation. Im Übrigen ist das, was man gemeinhin als Konversation bezeichnet, in aller Regel nur ein brillantes Selbstgespräch, dem ein begeistertes oder geduldiges Publikum Gehör schenkt. Beim Lesen wird ein lethargisches Denken wachgerüttelt durch ein scheinbar passives. Dabei wirken zwei Stimulanzien: die Sensibilität und die Erinnerung. Diese entscheiden darüber, welche Passagen uns berühren und wo wir die empfindsame Seite der Literatur finden. Sie und die Lektüre, ihre magere Kusine, haben das Beben gemeinsam. Ein geschriebener und gelesener literarischer Satz unterscheidet sich von denen anderer Textformen durch eben dieses Beben, das wiederum in der Unreinheit der Literatur ihren Ursprung hat.
Ich neige ein wenig dazu, Wörter in ihrem ursprünglichen Sinn zu verwenden, ohne Rücksicht auf die Konnotationen, die ihnen der Sprachgebrauch verliehen hat, und das ist ein Fehler. Der Sprachgebrauch schiebt einen bunten Filter vor die meisten Wörter. Wenn ich nicht darauf hinweise, dass ich Wörter ohne diesen Filter verwende, werden sie aller Welt in Farbe erscheinen und keinem so wie mir. Dabei möchte ich behaupten, dass die Verwendung von Wörtern in der Bedeutung, die ihrer Entstehung am nächsten ist, Sätze erzeugt, die den Leser stutzen lassen und seine Neugier wecken; wenn er ihren Sinn begriffen hat, wird er Geschmack daran finden, mehr zu verstehen als andere. Auf diese Weise ließe sich ein Club der Connaisseure gründen. Manchmal, etwa im Fall von Proust, werden solch elitäre Zirkel zu Massenveranstaltungen.
Zu wissen, dass man am Anfang nur eine Gruppe von Tausend war, reicht für das Selbstverständnis aus. Was für eine versnobte und naive Idee. Nun ja, sagen wir, sie hat etwas Japanisches: Wir sind die kleine Schar derer, die gewillt sind, eine Sache zu bewahren, die fragil und wertvoll und größer ist als wir selbst.
Wie dem auch sei, das Wort »Unreinheit« habe ich soeben im Sinne von »gemischt« verwendet, so wie auch eine Flüssigkeit unrein sein kann. Die Unreinheit der Literatur rührt nun daher, dass sie dem Denken lachhafte Emotion beimischt. Von daher ihre besondere Form. Ich verallgemeinere: Die Literatur ist etwas Geschriebenes, in das sich Emotionen mischen. Ich glaube nicht an den »Stil« als eine eigene, unverwechselbare Ausdrucksweise jedes guten Schriftstellers. Egos halten sich oft für einmalig. Dabei gehören sie einem Typus an. Die menschliche Person ist heilig, aber die Persönlichkeit gehört einer Gruppe an. Natürlich gibt es Nuancen, was jeden einzigartig und unersetzbar macht (übrigens das stärkste Argument gegen den Mord), aber sie reichen nicht aus, um zu behaupten, man könne an einem einzigen Satz den Schriftsteller erkennen. Man kann den Typ erkennen (den Enthusiasten, den Nörgler, den Rächer …), was natürlich ein Anhaltspunkt ist, aber um die Person zu erkennen, braucht man auch die Gedanken. Uff, ein guter Schriftsteller ist also ein Schriftsteller, der denkt. Das ist auch der Grund, warum besonders gehaltvolle Autoren wie Proust unendlich viele Kommentare nach sich ziehen. Extrem unterschiedliche Leser kommen bei ihm auf ihre Kosten. Jeder Kommentar zieht weitere Kommentare nach sich, und so heiligt sich die kreative Lektüre in der Exegese.
Hier droht ein Buch zur Bibel zu werden. Doch man liest nicht als Gläubiger, und ein Schriftsteller ist kein Gott. Man kann ihn lieben und verletzen, und ich denke, man hat sogar die Pflicht dazu. Ich bin nicht dafür, die Leichen in Frieden ruhen zu lassen. Eine Leiche, die man in Frieden ruhen lässt, ist endgültig tot.
Bombardiert die Friedhöfe!, betteln die Skelette, wenn sie nachts die Gräber verlassen, und strecken flehend ihre Fingerknochen den Flugzeugbäuchen entgegen, die blinkend in andere Gefilde verschwinden.
Man liest nur aus Liebe
Um es vorab zu sagen – wobei ich vermeintlich klärende Einleitungen, die doch nur Zweifel säen, genauso ablehne wie Schlussworte, die nichts abschließen – um es also vorab zu sagen: Wer viel liest, liest aus Liebe. Anfangs ist man in die Figuren verliebt; dann verliebt man sich in den Autor; und am Ende in die Literatur. Sie ist die Prinzessin, nach der wir ewig suchen, wenn wir dem Gefühl von Reinheit und Frische nachspüren, das wir beim Lesen unserer ersten Bücher empfanden und nun nicht mehr empfinden, was uns vielleicht zu Unrecht traurig stimmt. Wir haben unsere Naivität verloren, aber auch unsere Unwissenheit. Bevor wir lasen, schien uns noch das kümmerlichste Talent ein Pavarotti zu sein. Es ist wie bei einem Forschungsreisenden im Dschungel, der beim ersten Tausendfüßler, der ihm über den Weg läuft, in Entzücken gerät; wenn er nach monatelangen Märschen eine Lichtung erreicht, auf der zum Gesang von Leierschwänzen Feen tanzen, ist er auch hierfür keineswegs unempfänglich. Selbst wenn man viel liest, kann die Quantität der Lektüre ihrer Qualität nichts anhaben.
Der Zauber der Literatur wirkt häufig in der Kindheit. Viele streifen ihn nie ab. Das sind die Menschen, die aus Romanen Bestseller machen: Frauen, die wie kleine Mädchen von der Liebe träumen, lassen Schund, der sie darüber hinwegtröstet, dass sie einen Rüpel geheiratet haben, der beim Essen die Ellbogen auf den Tisch legt, die 300.000er-Marke erklimmen, und Männer, die immer noch spleenige Teenager sind, verlassen das von Privatsendern übertragene Fußballspiel nur, um von apokalyptischen Idioten geschriebene Zukunftsromane zu lesen.
Manchmal gesellen sich zu den Rössern der heißen Liebe die Schneepferde des eisigen Wissens, und der weiße Atem, der aus ihren gläsernen Nüstern quillt, nimmt uns unsere Unbefangenheit. (Ah, welch diebisches Vergnügen, schlecht zu schreiben und sich vorzumachen, es sei gut!) Deshalb werden große Leser immer anspruchsvoller: Weil sie gelesen und gelesen und immer weniger empfunden haben, suchen sie in der Rarität die Würze. Sie sind wie Verdurstende, deren Durst selbst mit Tankschiffen voll frischem Wasser nicht zu stillen wäre. Trinken! Trinken!, rufen sie, während sie mit rabiater Geste die edelsten Champagnerflaschen und Liköre von sich weisen.
Lesen aus Hass
Manche Menschen lesen aus Hass. Es sind Schriftsteller, die eifersüchtig auf ihre Kollegen, oder Kritiker, die eifersüchtig auf jeden sind. Bei den Erstgenannten heißt es: »Man liest sich nicht gegenseitig, man überwacht sich.« Wie großzügig. Ich nehme an, diese Leute verachten Malraux, der sich, als er einmal das Manuskript eines jungen Autors las, das dieser an den Verlag Gallimard geschickt und das man an Malraux weitergeleitet hatte, auf die Schenkel klopfte und rief: »So ein Freundchen! So ein Freundchen!«. (So hat es zumindest Emmanuel Berl erzählt.) Dass dieser junge Autor genauso schlecht schrieb wie Pierre Drieu La Rochelle steht auf einem anderen Blatt. Drieu hatte eine Art, die Malraux gefallen konnte, zudem war er ein Kind seiner Zeit, und so etwas wirkt modern, wenn es erscheint. Malraux hat in Die Zeit der Verachtung geschrieben – man könne die Welt in Menschen einteilen, denen die bittere Genugtuung, jemanden zu verachten, Freude bereitet, und Menschen, die nicht einmal daran denken. Die Letzteren leben in Gefahr. Man kann sie auch in Malraux-Hasser oder -Nichthasser einteilen. Der Hass auf Malraux war lange Zeit symptomatisch für einen bestimmten Typus Mensch. Irgendwann war es damit wieder vorbei. Wie bei Camus. Camus nicht zu mögen, konnte 1955 bedeuten, dass man unmenschlich war (Faschist oder Stalinist). Im Jahr 2010, da der politische Streit, in dem Camus Position bezogen hatte, längst vergangen ist, gilt das höchstens noch in den Köpfen derer, die diese Zeit miterlebt haben und daran festhalten, weil sie sich keinen literarischen Grund vorstellen können, der gegen Camus spräche. Obwohl, es gibt auch kluge 85-Jährige.
Welch ein Klüngel, diese Schriftsteller! Ein Fußbad der Missgunst. Ich glaube, ich werde Bühnenautor, die hassen sich weniger, wenn man Paddy Chayefsky glauben darf, dem Autor von The Latent Heterosexual (1968), was ich übrigens noch lesen muss. Antonia Fraser schreibt darüber in Musst du wirklich schon gehen? (Must you go?, 2010), dem Tagebuch ihrer Ehe mit Harold Pinter, sehr interessant, and so chic, etwas zu schick vielleicht. Auf zwei Seiten liefert sie ein Resümee dessen, was rückblickend in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Westen die kleine verschworene Gemeinschaft der »Kaviar-Linken« ausmachte: Die englische Gruppe empfängt aufgeregt einen südamerikanischen Revolutionär, der sich inzwischen zu einem lokalen Führer gemausert hat, Daniel Ortega aus Nicaragua. Die Treuherzigkeit dieser Leute ist nicht unsympathisch, denn sie entspringt dem Bedürfnis, richtig zu handeln, wohingegen der systematische Widerstand gegen den Fortschritt manchmal der Verachtung entspringt.
Auf der Suche nach einem Beispiel für eifersüchtige Kritiker – so viele sind es nicht – habe ich tagelang eine Zeitschrift durchforstet, von der ich glaubte, dass ich darin fündig werden würde. Ich wurde fündig, aber nicht glücklich. Es ist so, als hätte man in Mülleimern gewühlt. Ich habe eine Frau entdeckt, eine strenge Richterin über anderer Leute Stil, die selbst wie eine gehässige Gymnasiastin schreibt und sich, bloß weil sie ihre Platitüden in rabiate Worte fasst, für scharfsinnig hält. Sie liebt es, Schriftsteller anzugreifen. Diese Leute, die uns angreifen, haben nicht immer Talent. Deshalb suchen sie Zuflucht im Vulgären. Um die Schwäche ihrer Argumentation wettzumachen, schreibt diese Frau in der Wir-Form. »Wir«, das Feuilleton ihrer Zeitschrift. Auf diese Weise zieht sie Menschen in ihre Machenschaften hinein, denen ihr sektiererisches Auftreten unangenehm ist. So schreibt jemand, der sich, noch feucht hinter den Ohren, schon für eine Prophetin hält. Es gibt also eine Art des Lesens, die kriecht und geifert. Da ich aber nicht die geringste Lust auf Dinge habe, die mir keine Freude bereiten, überlasse ich es den Moralisten, diese weiter zu untersuchen.
Und jetzt ein bisschen frische Luft.
Darf ich bitten?
Während es noch vor fünfzehn Jahren das Buch der Bücher war, steht seit 2010 fest, dass Die Schöne des Herrn von Albert Cohen ein schlechtes Buch ist. So lautet ein unumstößliches Gesetz. Im Fernsehen reitet ein Drehbuchautor in meinem Beisein eine Attacke gegen den Text. Wofür halten sich Drehbuchautoren eigentlich, du lieber Gott? Ich habe die Frage für mich behalten und versucht, auf seine Kritik einzugehen. (Wenigstens ein Talent hat dieser Mensch: anderen die Schuld für die eigene Unfähigkeit in die Schuhe zu schieben, aber auch das behalte ich für mich.) Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, aus Albert Cohens Roman eine Geschichte zu machen, erwidere ich, dann liegt dies wohl daran, dass dieser Roman nicht von seiner Handlung lebt, sondern von den Figuren, von Ariane und Solal, Solal, eine der wundervollsten Nervensägen der französischen Literatur. Und eine der nervigsten Figuren der französischen Literatur erfunden zu haben, das ist doch was! Zudem ist es ein satirischer Roman, in dem zugleich ein Mittelalter-Roman steckt. Weil Solal fürchtet, dass »das Gesellschaftliche«, wie er es nennt, seine Liebe zu Ariane töten wird, sperrt er sie ein: Mittelalter-Roman. All dies geschieht im mondänen Milieu der Madame Deume, einer prätentiösen dummen Gans, und ihres Sohns, eines ausgemachten Nichtsnutzes, der beim Völkerbund Bleistifte anspitzt. Die Schöne des Herrn ist wie ein Hanswurst auf einem Trampolin voller Narren. Es ist sehr viel mehr als eine Geschichte, es ist ein Bild. Ein Bild, das uns Cohen auf geschickte, geistreiche, zauberhafte Weise nahebringt. Man liest ein Buch nicht um der Geschichte willen, man liest ein Buch, um mit seinem Autor ein Tänzchen zu wagen.