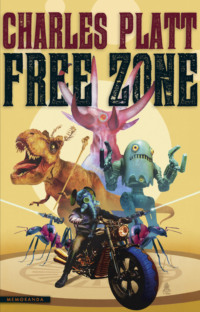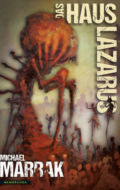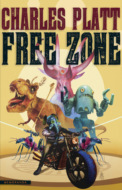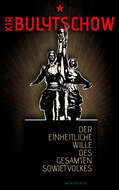Kitabı oku: «Free Zone»

Deutsch von Robert Wohlleben

* Unilogie: ein aus einem Band bestehendes literarisches Werk.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1989
unter dem Titel Free Zone bei Avon Books, New York.
© 1989 by Charles Platt (Roman)
© 2018 by Charles Platt (Vorwort)
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
Deutsche Erstausgabe
© 2020 dieser Ausgabe: Memoranda Verlag Hardy Kettlitz
Titelbild: Michael Marrak
Gestaltung: benSwerk [www.benswerk.com]
Lektorat: Melanie Wylutzki
Korrektur: Christian Winkelmann
Alle Rechte vorbehalten
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12 | 12053 Berlin
Kontakt: verlag@memoranda.eu
www.memoranda.eu
ISBN 978-3-948616-46-5 (Buchausgabe)
ISBN 978-3-948616-47-2 (E-Book)

Inhalt
Impressum
Danksagungen
Warum – Ein Vorwort von Charles Platt
Personen in der Reihenfolge ihres Erscheinens
1. Partytime im Paradies der Heiden
2. In der Hölle sollen sie schmoren, die sündigen Promis
3. Latinobanditen im überfluteten Speckgürtel
4. Albtraum mit schleimigen Aliens
5. Zur gleichen Zeit in Atlantis
6. Vorstadtanarchisten arbeiten an einem besseren Morgen
7. Eichhörnchen zu Besuch bei der Teufelsbrut des libertären Dogmas
8. Gottes Verwaltung verfügt Neufassung der politischen Ziele
9. Gott ist Sex, behauptet durchgeknallte Christin der tätigen Unzucht
10. Unterwegs mit der Queen der Freeps
11. Maskierte Entführer im Keller der Wunder
12. Mutanten in LoveLand
13. Roboter der Zukunft
14. Aug’ in Auge mit einem fetten schwarzen Dreckskerl
15. Lass uns dorthin fahren, wo es richtig nett ist
16. Der Söldner
17. Der marsianische Klongebieter des Dritten Reichs
18. Abenteuer, Liebeleien & die Begegnung mit dem Schicksal
19. Das schreckliche Geheimnis des FBI-Glamourgirls
20. Zutritt verboten! Unbefugte werden erschossen!
21. Dinosaurier der Tiefe
22. Flüchtige Begegnung in Lolitas Häuschen
23. Geistesgegenwärtiger Roboter rettet Erdbebenopfer
24. Die Rache der Killerhunde
25. Spazierfahrt am Jüngsten Tag
26. Liebespaar geht tanzen, und L. A. brennt
27. Massaker über Massaker
28. Das wiedergewonnene Utopia
Anhang
Anmerkungen zur Übersetzung
Bücher bei MEMORANDA

Danksagungen
Der vorliegende Roman bedient sich freizügig zahlreicher von Autoren wie H. G. Wells, Robert A. Heinlein, C. M. Kornbluth, Alfred Bester, Philip K. Dick und J. G. Ballard gestohlener Motive. Verpflichtet bin ich überdies David Langford, dessen Idee zu meiner beitrug; der Libertarian Party; Rudy Rucker, dessen revolutionäres Konzept transrealistischen Erzählens mich ermutigte, draufloszuschreiben, ohne zu wissen, wie die Geschichte weiterzugehen hätte; Richard Kadrey und John Clute für ihren ermunternden Zuspruch während der Arbeit am Roman; Cherie Wilkerson, die mir die Aussicht vom Griffith-Observatorium zeigte und manche irrigen geografischen Vorstellungen korrigierte; Hal Pollenz für seine wertvollen Hinweise zu Riesenameisen; Tom Disch für seine Deutschstunden; Simon Francis für seine Motorradkenntnisse; der Scientology-Kirche für ihren mechanistischen Psychojargon und John Douglas, der gnädig und mutig genug war, auf einen nur knappen Entwurf hin das Buch in Auftrag zu geben. Ihnen allen gilt mein Dank.

Warum – Ein Vorwort von Charles Platt
Zwischen 1985 und ’87 trugen die beiden Studenten Rob Meades und David B. Wake, die der Science Fiction Society der Universität Birmingham angehörten, eine kuriose kleine Sammlung mit dem Titel The Drabble Project zusammen (Abb. 1). Sie enthielt 100 Erzählungen von 100 Autoren, jede bestand aus 100 Wörtern. Wie die Herausgeber in ihrem Vorwort erklärten, sei eine 100-wortige Erzählung als »drabble« bekannt.
Warum?
Gräbt man tiefer in Monty Python’s Big Red Book von 1971, stößt man dort auf den Vorschlag für ein Gesellschaftsspiel, bei dem jeder Teilnehmer versucht, in so kurzer Zeit wie möglich einen Roman zu schreiben. Um das Spiel praktikabel zu halten, ist jeder »Roman« auf höchstens 100 Wörter zu beschränken. Die Pythons benutzten das Wort »drabble« zur Benennung dieser bahnbrechenden literarischen Form.
Aber warum?
Vermutlich ist das Wort eine Anspielung auf die britische Schriftstellerin Margaret Drabble, ich bin mir dessen allerdings nicht sicher. Drabbles zu schreiben wurde jedenfalls gut zehn Jahre später ein oft betriebenes Spiel bei den Birminghamer Fans, und sie beschlossen, auf eigene Faust einige ihrer Lieblingsstücke zu veröffentlichen. Um das Buch aufzufüllen, baten sie Außenstehende um Beiträge, darunter Isaac Asimov, Larry Niven, Terry Pratchett und, ja, sogar mich.
Mein Drabble
Die Einladung ehrte mich, doch hatte ich keine Idee, was ich schreiben könnte. Eine herkömmliche Geschichte in 100 Wörter zu quetschen schien nicht gerade besonders herausfordernd zu sein. Man braucht nur die drei Grundbestandteile: ein Problem, eine Entwicklung und ein überraschendes Ende. Das wäre leicht; es ließe sich in drei Sätzen bewerkstelligen.
Ich beschloss, die Bedingungen etwas zu verschärfen, indem ich mir vornahm, 50 verschiedene Begriffe aus der Science Fiction in meine 100 Wörter zu stopfen.
Nur um zu sehen, ob es sich machen ließ, nehme ich an.
Ich wählte den Titel »Skiffygram«. Der Ausdruck »skiffy« ist die buchstabengetreue Aussprache von »sci-fi«, wie mir Alfred Bester damals erklärte.
Ein Drabble ist so kurz, dass ich meinen Beitrag hier in voller Länge wiedergebe:
Immortal telepathic zombie time travellers from a nonAristotelian parallel universe, Atlantean hive minds, and invisible levitating psionic robots traversed hyperspace to attack mutants, mad scientists, humanoids, Martians, computers, clones, Dianeticians, and asteroid miners on an overpopulated utopian space colony terraforming Jupiter. Starfleet Captain Smith grokked the symbiotic alien invaders with his tachyon sensitized holographic video implant, emerged from hypnosleep, downed food pills, donned ion-driven antigrav waldoes, blasted off, and fired his atomic powered Venusian laser. Antimatter quantum effects inverted the beam! “It’s a disaster story,” his translation unit croaked as his subatomic particles dispersed on the solar wind.[1]
Anmerkung für Pedanten: ›nonAristotelian‹ zählt als ein Wort, ›ion-driven‹ zählt als zwei Wörter, und ›it’s‹ zählt als ein Wort.
[1] Unsterbliche telepathische Zombie-Zeitreisende aus einem nicht aristotelischen Paralleluniversum, androide Kollektivintelligenzen von Atlantis und unsichtbare levitierende psionische Roboter durchquerten den Hyperraum, um Mutanten, verrückte Wissenschaftler, Humanoide, Marsianer, Computer, Klone, Scientologen und Asteroidenbergleute auf einer überbevölkerten utopischen, mit dem Terraforming von Jupiter befassten Raumkolonie anzugreifen. Dank seiner umfassenden Intuition bemerkte Smith, Kapitän der Sternenflotte, die symbiotischen Alien-Invasoren mit seinem tachyon-empfindlichen holografischen Videoimplantat, erwachte vom Hypnoschlaf, schluckte Nahrungspillen, legte ionengetriebene Antigrav-Telemanipulatoren an, düste los und feuerte seinen atomar betriebenen venusianischen Laser ab. Antimaterie-Quanteneffekte invertierten den Strahl! »Eine Katastrophengeschichte«, krächzte seine Übersetzungseinheit, als der Sonnenwind seine subatomaren Partikel verwehte. (Anm. d. Ü.)

Abb. 1. Beccon Publications, 1988.
Metafiktion
Nachdem ich mein Drabble an Meades und Wake in England abgeschickt hatte, kam ich dazu, es mit kritischem Blick anzusehen. Einige seiner 50 Begriffe schienen ein bisschen marginal zu sein. Asteroidenbergleute zum Beispiel kommen in nicht gar so vielen Science-Fiction-Erzählungen vor. Andere Begriffe gehören mehr in die Wissenschaft als in die Science Fiction: beispielsweise der Sonnenwind. Und wenn ich ein paar Planetennamen anführte – zählen sie wirklich zu den Science-Fiction-Begriffen?
Diese Überlegungen brachten mich auf die Frage, wie viele wahrhaft elementar wichtige Begriffe in der Science Fiction existieren – also Ideen, die in zahlreichen Büchern vorkommen und derart verbreitet sind, dass sie jetzt zum Standardfundus gehören, auf den alle Autoren des Genres zugreifen. Ich tat mich in der Encyclopedia of Science Fiction um, die eine Liste von »Themen« enthält, doch sie war nur begrenzt hilfreich, da sie äußerliche Erscheinungsformen der Science Fiction (etwa Anime) wie auch inhaltliche Konzepte einschloss.
Am Ende beschloss ich, mich auf mein Gedächtnis in Kombination mit den Romanen in meinen Regalen zu verlassen. So kam ich zu einer Liste von 43 Begriffen, die ich als hinreichend wichtig ansah – wie zum Beispiel Aliens, Telepathie, Antischwerkraft und Unsterblichkeit.
Als ich nun meine Liste zusammenhatte, stellte sich die Frage, was damit anzufangen sei. Nun gut, statt einer Erzählung von 100 Wörtern könnte ich einen Roman schreiben, der all diese Begriffe enthielte. Das wäre viel herausfordernder, weil es einen Plot benötigte, in dem die Begriffe koexistieren könnten.
Warum würde ich das tun wollen?
Weil mich Metafiktion seit jeher fasziniert hat. Im wörtlichen Sinn bedeutet der Begriff »über die Fiktion hinaus«, wie Metaphysik »über die Physik hinaus«. Metafiktion regt den Leser an, aus dem Erzählten heraus sich zu erheben, um es von oben zu betrachten, einschließlich der Struktur, des Kontextes und des Prozesses, durch den es zustande kam.
Eine von Google gefundene Definition ist da strenger, deshalb gebe ich sie hier wieder: »Fiktion, in der der Autor bewusst das Artifizielle oder Literaturhafte eines Werks deutlich macht, etwa durch Parodieren oder Abweichen von literarischen Konventionen (speziell Realismus) und traditionellen erzählerischen Verfahren.«
Die Romane, mit denen ich in den 1950ern und ’60ern groß geworden bin, taten das nie. Wenn ein Autor ein neues Buch plante, begann er (oder – damals nur sehr gelegentlich – sie) vielleicht mit Notizen zu Figuren und Plot und sah sich vielleicht an, wie eine Idee schon früher benutzt worden war. Doch wenn der Autor dann wirklich mit dem Schreiben anfing, erzählte er schlicht eine Story, und der Entstehungsprozess blieb verborgen.
William Gibson sagte mir einmal, dass Fiktion wie ein farbenprächtiger chinesischer Drache auf einem Straßenfest sei. Die Kinder in der Menge werden durch die sich windende und dahinwogende Gestalt des Drachen belustigt, der lebendig zu sein scheint. Doch darunter stecken eine Menge verschwitzter Kerle, die Stangen und Hebel bewegen, um den Effekt zustande zu bringen. Die Arbeit des Autors bestehe darin, einer dieser Kerle zu sein und den Leser zu beeindrucken, dabei zugleich den Arbeitsvorgang zu verbergen.
Gibson hatte natürlich recht; doch für mich ist die Weise, in der der Drache in Bewegung gebracht wird, mindestens ebenso interessant wie seine Außenwirkung. Ich finde den Arbeitsvorgang ebenso interessant wie das Produkt, weshalb ich auch am »Drabble Project« interessiert war, wie auch daran, es weiterzutreiben. (Ein Drabble ist wohl insofern eine simple Form von Metafiktion, als dem Leser von Anfang an klargemacht wird, dass der Form die äußerliche Grenze von 100 Wörtern aufgezwungen ist. Das ist ja der springende Punkt.)
In der zweiten Hälfte der 1960er war das Science-Fiction-Magazin NEW WORLDS voll von Experimenten zu erzählerischen Verfahren. John Sladek, J. G. Ballard, Brian Aldiss, D. M. Thomas und viele andere schrieben Metafiktion.
Ballard verfasste, was er »kondensierte Romane« nannte, in denen er auf all die Charakteristika gewohnter Erzählweise verzichtete und das Werk lediglich als Folge von Szenen präsentierte, wie Fotografien. D. M. Thomas schrieb ein Gedicht, das sich in zwei Dimensionen entwickelt, wie ein Kreuzworträtsel. John Sladek schrieb eine Erzählung, die aus isolierten Sätzen besteht, die in Tausenden verschiedenen Anordnungen gelesen werden können. Nur drei von vielen Experimenten.
Manche Leser fanden solche Sachen unbefriedigend oder gar anstrengend. Theoriebasierte Fingerübungen wollten sie nicht lesen. Sie wollten eine unkomplizierte Geschichte, die ihnen eine von Zweifel unbehelligte Lektüre ermöglichte. Ich kann ihre Einstellung gut verstehen, denn einige meiner Lieblingsromane sind sehr konventionell geschrieben. Doch reizte mich eben auch das Spiel mit den Verfahren des Schreibens – und ich dachte mir, es sollte möglich sein, beides zu tun. Warum also nicht Metafiktion, die zugleich eine gute, lesbare Story ist?
Das Erzählverfahren ausloten
Mein erster Roman, Garbage World, war kein ambitioniertes Buch, doch es mischte die traditionelle Erzählweise insofern mit etwas bewusster Selbstbeobachtung, als es humorvolle Anspielungen auf Traditionen der Science Fiction und zwanghaft Bücher sammelnde Fans brachte.
Ein anderer Roman von mir, betitelt Planet of the Voles, war sogar noch weniger ambitioniert. Dies Buch schien nur eine schlichte Abenteuergeschichte zu sein, doch hatte ich Spaß daran, es mit freudianischer Symbolik vollzustopfen, die jahrzehntelang bewusst oder unbewusst in der Science Fiction benutzt worden war und von den Gestaltern der Magazin-Cover ausgeschlachtet wurde.
Die Warum-Fragen tauchen immer wieder auf, weil das »Warum« ein häufiger Einwand gegen Metafiktion ist. Warum schraubt jemand am Erzählverfahren herum? Was soll das?
Ein paar Begründungen habe ich schon angeführt, es folgen noch einige mehr:
Für manche Autoren und Leser wird geradliniges Geschichtenerzählen mit der Zeit langweilig. Ballard sprach gern verächtlich vom »leidigen Verfahren«, Figuren herumzubewegen und sie miteinander reden zu lassen.
Einige Autoren haben Spaß an Spielereien. John Sladek, dessen Werk ich überaus schätze, ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Doch auch dessen alten Freund Thomas M. Disch verlockte es in die Richtung, und er strukturierte seinen Roman 334 nach einem von Sladek angeregten System.
Was mich angeht, so bin ich einfach fasziniert von den verschiedenen Weisen, in denen Autoren tun, was sie tun. Ich möchte immer wissen, wie Erzählen funktioniert und wie eine Erzählung aufgebaut ist. Ich veröffentlichte sogar zwei Bücher (Dream Makers und Dream Makers II), in denen ich Autoren nach ihrem Vorgehen beim Schaffen von Erzähltexten befragte.
Ich war überzeugt, ich könnte einen Roman schreiben, der die gesamte Liste meiner 43 Begriffe enthält, und auch davon, dass dieser einen doppelten Zweck erfüllen könnte. Obschon manche Leser nicht willens zu sein schienen, sich mit Metafiktion abzugeben, würde es sie sicherlich interessieren, wie das Buch so disparate Ideen wie Zeitreisen und Alternativwelten zusammenbringt. Und ich hoffte, sie dadurch zu gewinnen, dass ich eine actiongeladene und unterhaltsame Geschichte erzählte.
Das einzige Problem war, für ein solches Projekt einen geeigneten Verlag zu finden. Ich konnte mir nur einen vorstellen, der davon versucht sein könnte: John Douglas, der 1988 bei Avon Books tätig war.
Ein Roman mit allem drin
John und ich hegten beide eine innige Liebe zur Science Fiction und waren zugleich mit all ihren Traditionen und Klischees sehr vertraut. Ich rief ihn an, um mich selbst zu einem Business-Lunch einzuladen. »Ich habe eine Idee, der du, glaube ich, nicht wirst widerstehen können.«
In einem chinesischen Restaurant in der Innenstadt, an einem runden Tisch mit weißem Tischtuch, gab ich John meine Liste. »Ich habe vor, all diese Begriffe in einem Roman unterzubringen«, sagte ich. »Wir können ihm den Untertitel ›Der einzige Science-Fiction-Roman, den Sie jemals lesen müssen‹ geben. Weil alles drin sein wird.«
In der folgenden halben Stunde versuchte John aus Spaß, irgendeinen Begriff zu finden, der mir für meine Liste entgangen war. Ich glaube, er kam auf zwei oder drei. Er strich auch ein paar meiner Begriffe, die er für nicht wichtig genug hielt. Als wir unsere Glückskekse bekamen, waren wir der Meinung, eine schlüssige und vollständige Liste zu haben.
»Aber du kannst es nicht den einzigen Science-Fiction-Roman nennen, den man jemals lesen muss«, sagte er.
Ich war bestürzt. Ich dachte, genau das wäre das schlagende Verkaufsargument.
»Wir bringen vier Titel im Monat heraus«, erläuterte John. »Die anderen Autoren sind wohl nicht glücklich, wenn wir den Eindruck vermitteln, dass man ihre Bücher nicht lesen muss.«
Na ja, damit könnte er recht haben. Also gut, vergiss den Untertitel. Die Konzeption des Buchs war immer noch einzigartig und bestechend.
John war sich da nicht so sicher. Er wollte ein Exposé sehen.
Der beleidigende Vorschuss
Das Exposé zu schreiben war schwierig, aber nicht unmöglich. Eine Woche später hatte ich es fertig. Bald darauf war John gewillt, ein Angebot zu machen.
»Eins, was ich in diesem Geschäft gelernt habe«, sagte er, »ist, dass ich, wenn ich ein idiosynkratisches Buch rausbringe, nicht viel Geld hineinstecken sollte.« Also bot er mir 2000 $. Ich glaube, das war das Minimum eines gegen Tantiemen aufzurechnenden Vorschusses, das Avon damals für Erstlingsromane zahlte.
Selbst für das Jahr 1988 war es ein beleidigend niedriges Angebot und völlig absurd, wenn man bedenkt, dass man voraussichtlich vier bis sechs Monate brauchte, um einen Roman zu schreiben. Ich erzählte ihm, dass die Konzeption meines Buchs so überaus originell sei, dass es garantiert viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen werde. Das Publikum würde neugierig gemacht und fasziniert sein. Kritikern wäre es eine Freude, die Liste meiner Begriffe durchzugehen. Wir würden reichlich Exemplare absetzen.
John war immer noch skeptisch.
Ist das zu glauben, 2000 $? Er musste einfach in der Lage sein, mehr als das zu zahlen. Selbst wenn es nur 500 $ extra wären! Nachdem ich ihm eine oder zwei Wochen lang etwas vorgemault hatte, lenkte er endlich ein. Ich würde 2500 $ bekommen.
Ich hatte noch andere Einkommensquellen, daher konnte ich es mir leisten, das Buch zu schreiben. Schlicht aus Liebe zur Sache.
Die Zutaten
Da das Buch bereits idiosynkratisch war (um Johns Ausdruck zu verwenden), beschloss ich, ein paar Situationen und Figuren einzumischen, die noch idiosynkratischer wären, einfach weil sie mir gefielen. Ich interessierte mich zunehmend für libertäre Ideologie, das Buch würde also ein libertäres Utopia beschreiben – was per se ein wiederkehrendes Motiv in der Science Fiction ist.
Die Handlung wäre in einem Teil von Los Angeles angesiedelt, den ich entdeckte, als ich einer Autorin namens Cherie Wilkerson begegnete, die zwischen dem Hollywood Freeway und dem Golden State Freeway wohnte. Zu der Zeit war es eine bescheidene, gepflegte Gegend. Ich fand sie sympathisch und stellte mir vor, dass sie sich vom Rest der Stadt abspaltete, als die USA auf das Jahr 2000 zutaumelten (das Buch wurde, notabene, 1988 geschrieben).
Ich wählte eine muskulöse Bikerbraut als Protagonistin und gab ihr einen nerdigen, fügsamen Freund zur Seite, allein aus Spaß daran, Stereotype umzukehren.
Weil ein libertäres Utopia keine Gesetze zu opferlosen Straftaten hätte, stellte ich mir vor, dass die Universal-Studios (am nördlichen Ende des Gebiets) in einen der Mafia gehörenden Vergnügungspark mit Jugendverbot umgewandelt wurden.
Ich fügte auch ein paar Motive hinzu, die mehr zur Fantasy als zur Science Fiction gehören, wie beispielsweise Barbaren aus dem hohlen Erdinnern. Damals war der Fantasyautor John Norman populär, und mir war danach, seine Bücher zu parodieren.
Das Schreiben machte eine Menge Spaß.