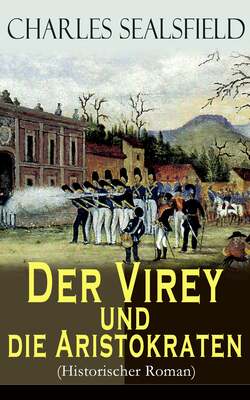Kitabı oku: «Tokeah», sayfa 23
»Hören Sie einmal, Herr Gieb,« versetzte Herr Prenzlau, »Ihren Dicken würden sie bald expedieren. Auf stutzigen Pferden ist schlecht reiten; würden ihn über die Achseln ansehen, und er müßte sich›s noch zu einer Ehre rechnen, wenn sie ihm die Hand reichten. Bin ja dabei gestanden, wie sie, ohne den Hut zu rücken, mit dem Gouverneur sprachen; kaum daß sie ihm sagten: › Kut morning, saehr koverner Guten Morgen, Herr Gouverneur.‹ Ja, um die zu zeitigen, da gehört ein Mann dazu, der Autorität hat; der Unsrige würde sie Mores lehren.«
»Vergeben Sie, Herr Prenzlau,« fiel ihm Herr Merks ein, »da haben Sie aber unrecht; sie sagen nicht Saehr koverner, sie sagen immer nur Saehr.«
»Ja, sie mögen sagen, wie sie wollen«, meinte Herr Prenzlau, der ein wenig unwillig über die Zurechtweisung des Hausierers geworden war und deshalb ihn Herrn zu titulieren vergessen hatte. »Ihr Dicker —«
»Ja,« fiel ihm Herr Gieb beschwichtigend ein, »aber was sind das auch für Koverner, Herr Prenzlau. Schaun ja nicht besser aus, als wie unsereiner. Wo soll denn da der Respekt herkommen? Das muß geboren werden; ‹s liegt schon im Blute. Herrje, wenn ich so an den Unsrigen denke, wie alles gezittert. Es ist einem gewissermaßen, schauerlich geworden, wenn man ‹n angesehen; und nun gar, wenn er aus der Ecke herübergerufen; hören Sie, bis zur Hauptwache hat man ihn gehört. Es war nicht anders wie vor einem brüllenden Löwen, so hat alles gezittert.«
»Ja, Herr Gieb,« entgegnete Herr Prenzlau, »da könnte ich Ihnen etwas anderes sagen. Der Unsrige – ja – und dann der liebe junge Prinz! Ach Herrje! Wenn Sie ihn so gesehen hätten! Wie ein junger Herrgott, freundlich lächelnd und, die Reitpeitsche in der Hand, mit den Herrn Offizieren schäkernd; und die Hüte alle ab, wer immer ihn nur sieht; und er so mir nichts dir nichts, ganz gemein und doch so hoch; – ja, wer sich für den nicht mit tausend Freuden totschießen läßt, der muß ja gar kein Deutscher sein.«
Die guten Deutschen wurden in ihren Herzensergießungen über die Herrlichkeiten ihres, und das Elend unsers heillosen Landes, dem es so ganz an aller Hoheit ermangelt, durch einen in die Stube tretenden Milizsergeanten unterbrochen, dessen Uniform und flittergoldene Epauletten den Herrn Prenzlau mit seinen drei Landsmännern plötzlich von ihren Sesseln aufprallen und zugleich mit den Händen nach ihren Kappen und Mützen fahren machten. Des Herrn Prenzlau schärferes Auge hatte jedoch die flittergoldenen Epauletten am ersten bemerkt, und, sich setzend, ermahnte er, ein gleiches zu tun. »Setzen Sie sich doch, meine Herrn,« sprach er, »und behalten Sie auf. Wir sind ja in einem freien Lande, und das ist ja nur ein Sergeant, der Ihnen nichts zu befehlen hat.«
Des Herrn Prenzlau treu gemeinte Vorstellung hatte die etwas erschrockenen guten Deutschen wieder beruhigt; der scharfe und musternde Blick des Sergeanten schien ihnen jedoch alle Lust zu fernern politischen Debatten benommen zu haben, und sie tranken nun still und ruhig ihre Gläser aus, worauf sie sich, unter oftmals wiederholten Wünschen »einer guten, geruhsamen Nacht« trennten.
Mit dem Sergeanten, der die Mexikaner und Franzosen nach der Reihe angesehen und abgezählt hatte, verloren sich auch die übrigen Gäste, und mit diesen schien plötzlich den olivenfarbigen Wirt die frohe Stimmung verlassen zu wollen, die ihn bisher in der Bedienung seiner Kunden so rührig gemacht hatte. Es fing in ihm zu zucken an, und eine gewisse Unsicherheit und Verlegenheit war an ihm wahrzunehmen. Er verließ die Stube, eilte zur Haustüre, sah sich forschend um – kehrte langsam zurück, und sein Blick, sowie er in die dunkle Ecke fiel, wurde zusehends verstörter. Auf einmal erschallte es aus dieser »Benito!« Der Mann schrak zusammen und rüttelte sich, als ob ihn ein Fieberschauer ergriffen hätte. Als wäre er von einer unsichtbaren, feindlichen Macht getrieben, schwankte er dem Tische zu.
»Benito!« sprach der mit dem verbundenen Kopfe. »Kennst du mich nicht mehr?«
»Wollte die heilige Jungfrau! Ich hätte Euch nie gekannt. Seid Ihr es oder ist›s Euer Geist?«
»Beides«, erwiderte der Vermummte und brach dann in ein lautes, widerliches Gelächter aus, in das alle einstimmten, den Wirt ausgenommen, der mit jedem Augenblicke unruhiger zu werden anfing.
»Setze dich, Benito! habe dir etwas zu sagen.«
»Still! kein Wort. Dies ist hier nicht mein Name.«
»Ich glaube, du hast so viele Namen, wie wir Flaggen, nur mit dem Unterschiede, daß wir die unsrigen öfters aufziehen, du aber die deinen für immer ablegst. Bist doch ein wahrer Hasenfuß.«
»Was wollt Ihr mit mir? Hat Euch der Böse auch hierhergebracht? Ist man vor Euch nirgends sicher?« »So hat er, und zugleich hat er mir eine kleine Sendung mit auf den Weg für dich gegeben.«
Der Wirt zuckte wie Espenlaub zusammen. »Bedenkt, ich habe Weib und Kind und bin ehrlich geworden.«
Alle schlugen ein lautes Gelächter auf.
»Wer nimmt dir deine Ehrlichkeit, Narr!« fuhr der Verbundene fort. »Nur einen kleinen Freundschaftsdienst mußt du uns erweisen.«
»Sucht Euch einen andern.«
»Wenn wir das wollten, so wären wir nicht zu dir gekommen. Ich will dich nicht länger auf die Folter spannen, armer Wicht.«
»Was soll ich wieder?«
»Narr! nichts. Nur unsern armen Doktor Pompey aus dem Loch befreien. Er ist mit uns gekommen und, von seinem vormaligen Herrn erkannt, im Gebäude mit dem Wachtposten logiert worden.«
»Seid Ihr rasend?« winselte der Wirt. »Ihr wollt einen Neger aus der Baumwollenpresse herausholen, wenn, nicht dreihundert Schritte davon, im Gasthause eine Versammlung abgehalten wird, wo über fünfhundert Bürger beisammen sind?«
»Was zu tun ist, wirst du am besten wissen. Nur so viel sage ich dir, daß wenn der Neger noch morgen früh hier ist, er uns und dich in seiner Dummheit verrät, und du uns folglich bei der großen Trauung Gesellschaft leisten mußt.«
Der Mann krümmte sich wie ein Wurm. »Habt Barmherzigkeit mit mir, einem verheirateten Mann, der Weib und Kind hat.«
»Ist sie jung?« fragte der Verbundene.
»Beim heiligen Jakob!« fuhr der Spanier giftig heraus, »wenn Ihr mir da zu nahe kommt – — —«
»Halt›s Maul, Hasenfuß! – haben andere Dinge im Kopfe, als deine Seespinne von Weib zu amüsieren, wenn›s die ist, die ich gesehen. Verdammter Narr! Wer wird sie dir nehmen?«
Der Wirt lief in der Stube wie ein Rasender hemm.
»Bist doch ein erbärmlicher Wicht, Benito! Haben dich die zwei Jahre unter den Republikanern so zum Hasenfuß gemacht?«
»Lacht nur,« sprach Benito; »aber wenn man einmal den Satan abgestreift und Weib und Kind hat und von allen Seiten beobachtet wird! Wenn sie das mindeste spüren, so bin ich auf immer ruiniert. Man muß hier ehrlich sein.«
»Genug des Geschwätzes,« sprach der Verbundene; »kein Wort weiter.«
»So muß ich denn?«
»Glaubst du, ich scherze oder sei des Spaßes wegen gekommen? – Fort mit dir!«
Der arme Benito fuhr schaudernd zusammen und zog sich ächzend zurück und durch die Türe hinaus, aus der ihm ein höllisches Hohngelächter nachhallte. Es war schon spät in der Nacht, als er, in einen Mantel gehüllt und ein Bündel in der Hand, wiederkam.
»Wenn die Regulären in der Kottonpresse sind, dann kann ich absolut nichts tun«, sprach er in einem Tone, dem man es ansah, daß er sich Gewalt antat, entschlossen zu scheinen.
Der Vermummte trank sein Glas aus, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
»Es sind ihrer zwei mit einem Sergeanten und Leutnant da, die die Milizen einexerzieren.«
Der Verbundene schwieg noch immer.
»Ich sag› es Euch nochmals,« fuhr der Wirt fort, – »ich will es versuchen; aber nur auf den Fall, als diese sich entfernen. Und wer wird mich begleiten, und was wollt Ihr mit dem Neger?«
»Ihn über den Mississippi bringen, wo er auf dem Wege, den wir von Nacogdoches kamen, wieder zurück muß.«
»Um der heiligen Jungfrau willen! Was denkt Ihr? Ihr wollt über den Mississippi? Ihr seid nicht in drei Stunden zurück. Und wenn die Milizen aus der Versammlung zurückkehren? Es schlafen ihrer vier oben in der Stube neben Euch.«
Der Vermummte schenkte sich wieder ein und trank, ohne aufzublicken.
»Ihr kommt nicht von Nacogdoches,« fuhr Benito fort, »Ihr habt Arges mit dem armen Neger vor; dazu will ich mich bestimmt nicht hergeben.«
»Höre, Benito,« sprach nun der Vermummte, »ich habe dein Geschwätz satt; du kennst mich. Ich gebe dir vier unserer besten Männer mit; sie sind verwundet, werden aber den Neger über den Strom schaffen.«
»Und Ihr bleibt zurück?« brummte der Wirt.
»Narr, um deiner Frau die Cour zu machen. Glaubst du, man denk› an solche Lappalien, wenn einem der Tomahawk einen Zoll tief im Kopfe gesessen?«
Benito schlich jedoch zur Seitentür und zog den Schlüssel ab. »So kommt in Teufels Namen!« sprach er. Es sind doppelte Wachen des Spions halber aufgestellt; es wird schwer halten. Heiliger Jakob, steh› uns bei! Seid Ihr auch sicher, daß er unten in der Kottonpresse ist?«
»Wir haben ihn alle dahin abführen gesehen«, erwiderte der Vermummte. »Benito, nimm dich zusammen. Ich gebe dir meine besten Freunde mit. Wenn du einen dummen Streich machst, so sind wir und du verloren.«
»Teufel!« murmelte Benito. »Warum laßt Ihr mich nicht in Ruhe! Unser Kontrakt ist zu Ende!«
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Es war Mitternacht, als die fünf Spanier und Mexikaner das Haus mit einer leichten Leiter verließen. Der dichte Nebel, der über dem Strome gleich einem endlosen Grabtuche schwamm, stieg bereits über die Ufer hin und zog sich wie eine ungeheure Rauchwolke flach über die Niederung her, durch die der Morgenwind in einzelnen Stößen zu pfeifen begann, und der sich nun die fünf nächtlichen Abenteurer behutsam auf dem längs des Ufergebirges hinabschlängelnden Wege näherten. Vor dem Gasthause stand eine zahlreiche Gruppe, die, an der Türe und an den hellerleuchteten Fenstern zusammengepreßt, in tiefer Stille den Rednern im Saale zuhorchte.
Einer der Mexikaner hatte sich an die Versammlung herangeschlichen, während die übrigen dem Ufer des Bayou zugetappt waren, wo ein zweiter an den Wasserrand hinabkroch, und nachdem er eines der Boote vom Pfosten gelöst, dieses leise dem Hauptstrome zuzog. Seine Schuhe in der Rocktasche und sorgsam auf die schimmernden Baumwollflocken tretend, hatte sich auch der Spanier vom Gasthause seinen Genossen zugestohlen, die, die Augen starr auf den Wache stehenden Milizen gerichtet, ohne sich zu regen, dagestanden waren.
Eine gute Viertelstunde mochte verflossen sein, als dieser abgelöst wurde, worauf ein Pikett von drei Mann auf den Gasthof zuschritt und, mit der daselbst abgelösten Wache zurückkehrend, die Runde gegen den Mississippi zu machte, von der es wieder zum Wachtposten zurückkehrte.
Dieser befand sich in einem ziemlich großen Gebäude, das, einem Kornboden oder einer großen Scheune nicht unähnlich, mit Brettern überkleidet war, von denen mehrere losgerissen, im Windstoße schnarrend und knarrend hin und her schwankten.
»Alles ruhig, Tom«, sprach der Führer des Piketts, als er von der Runde zurückgekehrt war.
»Hört doch einmal!« erwiderte die Wache, »was ist doch das für ein Geknarre?«
»Der Windstoß, der vom Balize heraufkommt,« erwiderte der Führer; »diese Musik werdet Ihr noch öfter hören.«
»Hol der Henker diese Musik und Euer Militärleben«, erwiderte der Milize mit einem verächtlichen Blicke auf das Bajonett, das an seiner Seite hing. »Müssen da Wache stehen, während die drüben das größte Meeting halten, das je gewesen ist.«
»Es muß nun einmal sein,« tröstete ihn der Führer, »in vier Wochen ist alles vorüber; die Reglars können doch nicht immer Wache stehen; haben sich heute genug abgezappelt. Und was im Meeting geschieht, werden wir auch hören.«
»Ei, wollte das Ganze wäre schon vorüber; stehen da wie die Narren, um die Kottonpresse zu bewachen. Eine saubere Christnacht!«
»Ei, Johnny,« sprach ein aus dem Hause kommender Milize, »wollte, du sprängest hinüber in die Taverne und brächtest uns Nachrichten, was sie drüben tun und ließest den Krug da füllen.«
»Mike! Mike! könnt Ihr denn die Stunde nicht aushalten und habt doch die Wache vor der Tür des Spions, und Leutnant Broom ist drüben beim Kapitän und hat befohlen, ein wachsames Auge auf den Gefangenen zu haben.«
»Ja, den wird Euch niemand stehlen; für den ist das Hanfkraut schon gedreht,« versetzte Mike; »hätte auch seine Reglars herstellen können, braucht sie nicht alle auf seiner Stube.«
»Er muß doch hören,« versetzte der Führer lachend, »wie weit wir›s in der Zucht gebracht, um auch rapportieren zu können. Was aber den Spion anbetrifft, so wollte ich nicht, daß der uns entginge. Es wird die allerloyalsten Subjekte seiner britischen Majestät ganz herrlich wurmen, wenn wieder einmal einer ihrer Gebrüder bei uns mit der Hanfbraut getraut wird.«
»Eben deswegen wird ‹n Euch niemand davontragen«, versetzte der wachunlustige Mike.
Die fünf Mexikaner stahlen sich nun behutsam hinter das Gebäude, von woher nach einer Weile ein scharfer Luftzug und dann wieder ein lautes Knarren und ein Rumpeln, wie das eines an der Bretterwand herabgleitenden schweren Körpers gehört wurde.
»Müssen doch sehen, was das ist«, sprach der Führer, der mit einem Milizen, die Laterne in der Hand, hinter das Gebäude ging. Die losgerissenen Bretter schwankten immer stärker.
»Da liegt es«, sprach er. »Ein ganzes Brett; der Wind ist doch nicht so stark.«
»Ja, hier unten,« entgegnete sein Begleiter, »aber da droben haust er. Es ist in gleicher Höhe mit dem Mississippi und hört nur, wie der braust.«
»Schau doch einmal hinein zum Spion«, sprach der Führer.
Der Milize ging in das Innere des Gebäudes und kam mit der Nachricht zurück, daß er gesund schlafe. »Möchte doch gerne wissen,« meinte er, »wer den eigentlich trauen wird; den Scherif geht er nichts an, er ist kein Bürger.«
»So glaubt Ihr, der Scherif ist bloß für uns«, lachte der andere. »Wenn nun ein Ausländer im County gehangen wird, muß es der Scherif nicht auch tun?«
»Habt recht«, versetzte der Milize. »Wollte, er hätte alle die zwanzigtausend seiner Landsleute unterm Kragen, wären wir doch der Sorgen los.«
Er begleitete seinen Einfall mit einem lauten Lachen, während welchem das Knarren der Bretter stärker denn je gehört wurde.
»Hört Ihr das?« sprach Johnny, der soeben mit einem Kruge Whisky zurückkam. »Da hinten haust es, als ob der Orkan vom Balize heraufkäme.«
»Haben schon gesehen, hat nichts zu bedeuten. Habt Ihr etwas vom Meeting gehört?«
»Prächtige Nachrichten,« versetzte Johnny, »Oberst Parker spricht wie ein Gott, und der alte Floyd wie ein Engel. Kommt, Ihr sollt Eure Wunder hören.«
Und mit diesen Worten schritten alle der Wachtstube zu. Der Wachestehende hatte sein Gewehr unmutig auf die Erde gestoßen und sah eine Weile durch das Fenster in die Stube hinein; dann lehnte er dieses auf den Querpfosten und trat gleichfalls ein, um seinen Anteil an den Neuigkeiten von dem Meeting und vielleicht auch vom Kruge – nicht zu verlieren.
Gleich darauf hörte man wieder ein langes Knarren, ein Rasseln und dann einen scharfen Luftzug, aus dem Fußtritte zu vernehmen waren, die schnell dem Mississippiufer zusprangen.
» Carraco! zum Geier!« zischte eine Stimme den Ankommenden entgegen. »Wo bleibt Ihr so lange?«
» A vencer o a morir, siegen oder sterben«, wisperte ein anderer mit unterdrücktem Gelächter. »Wir haben ihn.«
»Wohl, so kommt.«
Zu den fünf Mexikanern oder Spaniern, die sich hinter der Kottonpresse verloren hatten, war ein sechster gekommen, die alle, mit Ausnahme zweier, über das Ufer dem Boote zukrochen, das am Einflusse des Mississippi hielt. In demselben Augenblicke wurde ein zweites Boot sichtbar, das leise von dem Bayou herauf gegen den Strom zu kam.
» Que diablo! der Teufel!« murmelte die Bande, »was ist das?«
Das Boot hatte sich genähert, und es war ein Mann darin bemerkbar. » Que es este, was gibt’s«, wisperten die Mexikaner wieder, und einer derselben sprang rasch hinüber in das fremde Fahrzeug, aus dem dumpfes Kettengerassel zu vernehmen war.
Der Mexikaner stierte dem unwillkommenen Ankömmling ins Gesicht.
»Ah Massa Miguel! Pompey nicht im Jail bleiben; Pompey nicht die Ninetail lieben«, grinste ihm der Neger entgegen.
» Que diablo! zum Teufel!« murmelte der Mexikaner, »da ist Pompey! Wen habt Ihr da? Wir sind sieben statt sechs. Was hat das zu bedeuten?«
» Diablo! Teufel!«
» Carraco! zum Geier!«
»Santo Jago!« zischten die Mexikaner zusammen. »Wer bist du?« murmelten sie, indem sie auf den soeben mit ihnen angekommenen und, wie es schien, überflüssigen siebenten zusprangen.
»Nichts spanisch, altenglisch«, erwiderte dieser.
» Santa Vierge! Heilige Jungfrau! Wie kommst du hierher?«
»Das müßt Ihr wissen, die Ihr mich hierhergebracht.«
Die sechse prallten zurück und wisperten miteinander in spanischer Sprache. »Komm denn!« sprach einer.
»Keinen Schritt, ehe ich weiß, wer Ihr seid und wohin es geht?«
»Narr! Wer wir sind, geht dich wenig an. Wohin es geht? Wo immer es hingeht, ist›s besser für deinen Kragen, als wo du bist; hier gebe ich dir keinen Real dafür.«
» Dejalo! Dejalo! umbringen!« murmelten die übrigen. »Laßt ihn! Laßt ihn!«
»Macht, daß Ihr fort und wieder zurückkommt,« zischte ihnen der Wirt zu, »oder Ihr seid verloren. Und wenn Ihr unten Unrat merkt, so vergeßt nicht die obere Landung.«
»Halt!« flüsterte der Brite, »ich gehe mit Euch.«
Der Neger war bereits in das Boot der Mexikaner hinübergesprungen und hatte das seinige mit dem seiner Rasse eigenen Leichtsinn den Wellen überlassen.
»Engländer!« murmelte einer der Mexikaner, »hier sitzest du!« indem er ihm seinen Platz im Vorderteile des Fahrzeuges neben dem jungen Mexikaner anwies.
»Und Pompey kommt in die Mitte und nun frisch auf.«
»Halt!« flüsterte der Brite, »können wir uns nicht in die zwei Boote teilen?«
»Ah Massa, nicht über den Sippi gerudert,« kicherte der arbeitsscheue Neger; »Massa nicht in sechs Stunden drüben sein und bei Point Coupé ans Land kommen.«
»Hush, Pompey!« murmelte sein Nachbar, und das Boot, von sechs Händen bewegt, flog nun schnell in den Strom hinein.
»Ah Massa Manuel zuerst Pompey seine Ketten abfeilen lassen,« brummte der Neger, »Pompey im obern Gefängnis sein – klug gewesen,« lachte er in sich hinein, »eine Feile mitgenommen und sich selbst geholfen – Massa Parker schauen, wenn Pompey ausgeflogen.«
»Halt›s Maul, Doktor,« befahl eine Stimme von hinten, »und warte mit deinen Ketten, bis du drüben bist.«
Der Neger schüttelte unwillig den Kopf. »Massa Filippo auch nicht gerne im Halsbande sein« – brummte er, steckte jedoch seine Feile wieder ein, und während er mit der einen Hand das Ruder handhabte, ergriff er mit der andern die Kette, die, vom Fuß bis zum Halseisen laufend, in der Nähe des letztern abgefeilt war. Dieses Halseisen bestand aus einem fingerdicken, beinahe zwei Zoll breiten Ringe, der um den Hals lief und aus dem drei lange, daumendicke, auseinanderstehende Haken über den Kopf hinausragten. Die lange Kette hatte er mit einer Art kindischer Verwunderung abwechselnd in der Hand gewogen und wieder angestiert, dann warf er sie in das Boot hinab, das nun rasch der Mitte zuflog.
»Arme Lolli, traurig sein,« hob er nach einer Weile wieder an, »wenn Pompey nicht in die Stadt hinab kommen, sie in St. John wohnen, unter der Kathedrale.«
»Pompey!« rief der vorne neben dem Briten sitzende Mexikaner, »deine Ketten und Fußeisen liegen mir just auf den Knöcheln.«
»Bleib ruhig, Pompey,« zischelte ihm sein Nachbar in die Ohren, »ich will sie zurückziehen.«
»Ah Massa armen Pompey nicht gut tun«, rief dieser seinem Nebenmanne zu, der die Ketten um beide Füße des Negers herumgewunden und sie nun mit einem plötzlichen Rucke so scharf anzog, daß dem Schwarzen das Ruder entsank und er rücklings ins Boot stürzte.
Der junge Brite war aufmerksam geworden. »Was gibt es? Was treibt Ihr mit dem armen Neger?«
»Massa, um Gottes willen mit dem armen Pompey nicht so spaßen«, stöhnte der Neger dazwischen.
»Nichts, Pompey, vergiß nur nicht den Weg zur Rechten nach Nacogdoches«, erwiderte der Hintermann.
»Um Gottes willen, Massa, nicht würgen«, stöhnte der Sklave dringlicher.
»Nichts, nichts; denk› an deine dicke Lolli hinter der Kathedrale und vergiß den Weg nach Nacogdoches nicht«, tröstete ihn der Hintensitzende, der die Ketten von seinem Vordermanne erfaßt, diese durch das Halseisen durchgezogen und so den armen Neger in einen Knäuel zusammengeschnürt hatte.
»Massa-Mass-Ma!« stöhnte der Neger, dem der Atem zu vergehen anfing.
Das Ganze war das Werk eines Augenblickes gewesen; nur das Gestöhn und Schlucken des im Todeskampfe röchelnden Negers war zwischen dem Rauschen der Wogen und den Ruderschlägen hörbar gewesen.
»Alle Teufel!« rief der Brite, sich umsehend, »was ist das?«
Im nämlichen Augenblicke hob sich das Brettchen, auf dem er saß, und er fühlte sich mit aller Gewalt von seinem Nebenmanne gestoßen, der ihn mittelst des überschlagenden Brettes beinahe in den Strom gestürzt hätte.
»Ihr seid wirklich Mörder!« rief der schaudernde Brite, der gerade noch so viel Zeit übrig hatte, sich schnell zu drehen und seinen Nachbar anzufassen. Dieser hatte sich ein wenig erhoben, um das Brett unter seinem Sitze zurückzuschieben und umzuschlagen, war aber in seiner schwankenden Stellung, vom Faustschlage des Briten getroffen, über die Bootswand in den Strom hinabgestürzt.
» Buen viaje a los infiernos, glückliche Reise in die Hölle«, brüllten die Hintensitzenden mit einem höllischen Gelächter.
» Go to hell yourselves, schert euch selber in die Hölle«, schrie der Brite, der das Ruder erfaßt hatte und dem hinter ihm Sitzenden einen Hieb versetzte, der ihn an die Seite des Negers rücklings stürzte.
» Santa Vierge! Que es este? Heilige Jungfrau, was gibt’s?« riefen die beiden Hintersten.
» Este Inglese, der Engländer«, brüllte einer und suchte vorzudringen, fiel jedoch über die zwei Liegenden ins Boot hin, das durch den rasenden Kampf gewaltig zu schwanken begann.
»Ma-Ma«, stöhnte der Neger nochmals, und seine Augen, im furchtbaren Todeskampfe, funkelten wie gräßliche Irrlichter in der stockfinstern Nacht und traten aus ihren Höhlen, und die krampfartig lallende Zunge fing an aus dem Munde zu fallen.
»Beim lebendigen Gott! ich stürze euch alle in den Strom, wenn ihr den armen Neger nicht befreit«, schrie der Brite.
» Maledito Inglese! verfluchter Engländer!«
» Picarjo Gojo! niederträchtiger Hund!«
» Dejalo! Dejalo! Santa Vierge! Umbringen, umbringen! Heilige Jungfrau!« schrien die drei Mexikaner untereinander, während der Brite einen verzweiflungsvollen Hieb auf den gegen ihn Zukommenden führte, der ihn brüllend ins Boot zurückstürzte.
» Dejalo! Dejalo! Umbringen! Este diablo, dieser Teufel«, riefen die beiden Mexikaner, und einer schob ihm den armen Neger zu.
»Steht zurück!« schrie er, »und nehmt ihm das Halseisen ab. Wenn ihr ihn erwürgt, so sterbt ihr alle.«
» Este diablo! dieser Teufel!« schrie der Mexikaner, der den in einem Klumpen gefesselten Neger hinschob und ihm die Kette aus dem Halseisen riß.
Die Glieder des armen Sklaven fielen wie Stücke Holz auseinander. Nur ein leises Röcheln verkündete, daß der Lebensfunke noch nicht ganz von ihm gewichen war.
»Steht zurück!« schrie der Brite wieder, der, zum Schwarzen herabkauernd, es nun versuchte, ihn durch Reiben mit der Wolldecke, ins Leben zurückzurufen.
Das Boot war, im Kampfe auf Leben und Tod dem Spiele der Wogen überlassen, schnell vom Strom fortgerissen worden und schwankte nun mitten unter den ungeheuern Baumstämmen, die dieser zu Tausenden mit sich führt. Die Mexikaner hatten sich aufgerichtet und fingen an aus Leibeskräften stromaufwärts zu rudern. – Nicht ferne von dem gebrechlichen Fahrzeuge, auf dem unter der Nebelschichte erglänzenden Wasserspiegel, war ein kolossaler Baumstamm zu sehen, der geradezu auf das Boot kam. Der Brite hatte kaum Zeit gehabt, den Mexikanern zuzurufen, als der Baumstamm an ihnen vorbeischoß. Ein unnatürlicher Laut schlug zugleich an ihre Ohren. Schaudernd wandte sich der Jüngling, und er sah noch einen Kopf und eine Hand, die um einen der Äste des Baumes geschlungen war. » Misericordia! Erbarmen!« stöhnte es, » Misericordia per Dio! Erbarmen um Gottes willen!« Es war der Mexikaner, der nahe dem Baumstamme in den Strom gestürzt, sich an diesen gerettet und angeklammert hatte.
»Wendet das Boot!« rief er den Mexikanern zu, »euer Landsmann ist noch am Leben.«
» Es verdad| Ist’s wirklich!« kreischten die Mordgenossen und wandten das Boot stromabwärts.
Der Neger war allmählich zu sich gekommen und kauerte nun zu den Füßen seines Retters. Auch er stierte in den Wasserspiegel auf den Elenden hin.
»Um Gottes willen, Massa!« kreischte er, das Ruder des Briten ergreifend, »das Miguel sein, Massa ihn totschlagen; Miguel sehr böse.«
»Laß das sein, Pompey!« rief ihm dieser zu, der aus Leibeskräften anlegte, um dem Mexikaner beizustehen. Das Boot schwamm dicht neben dem Baumstamme, und der Mexikaner hatte gerade noch so viele Kraft übrig, um seine Hand herüberzustrecken, die der Jüngling erfaßte.
»Um Gottes willen, Massa! die Seeräuber uns beide totmachen«, rief der Neger.
Der Mexikaner hatte die Hand des Jünglings im Todeskampfe erfaßt, während einer der Hintensitzenden an ihn herangekrochen war. In diesem Augenblicke erhielt das Boot einen furchtbaren Stoß, eine Welle schlug hinein und warf den Mexikaner an die Bootswand, über welcher er nur mit halbem Leibe mehr tot als lebendig lag.
»Fasse den Mexikaner!« rief der Brite dem Neger zu.
»Ah, Pompey kein Narr sein – Pompey Massa zu lieb haben. Die hinten nicht rudern; – Schau Massa, die nur warten, Massa totzumachen.« »Hört ihr!« sprach der Brite zu den Mexikanern, indem er dem Nächsten einen Stoß mit dem Ruder versetzte – »der erste, der einen Ruderschlag ausläßt – ihr versteht mich!«
Das Boot schwankte auf dem ungeheuern Wasserspiegel inmitten der Baumstämme, jeden Augenblick bedroht, von einem derselben zerschellt oder vom Strome verschlungen zu werden; die Mexikaner lauerten in stiller verbissener Wut; tückische Mordlust grinste aus ihren schwarzen, rollenden Augen; der Neger hatte den Strick des Bootes um den Leib des Mexikaners herumgeschlungen, der, » Misericordia!« stöhnend, beide Hände an das Boot geklammert, wie ein Gespenst nachfolgte.
»Ah, Massa! Miguel ein guter Schwimmer sein, die Taufe ihm nicht schaden. Massa«, brummte der nie ruhende Schwarze nach einer Weile, »Massa nicht vergessen, sein Ruder mitzunehmen.«
»Und Pompey nicht vergessen, das seinige ein wenig fleißiger zu handhaben«, entgegnete ihm dieser.
Der Neger fuhr eine Weile kräftig in der ihm aufgegebenen Richtung fort, dann stierte er den Jüngling an, der bedenklich über den Wasserspiegel hinhorchte.
»Ah, Massa nicht sorgen, die Milizen gut schlafen, der Sippi nur lärmen. Pompey wissen die Wege, Massa Parker ihn nicht kriegen.«
Wieder verfloß eine Viertelstunde, die Kräfte der Rudernden fingen an von der stundenlangen Anstrengung zu ermatten.
»Massa nun bald die Ufer sehen. Wir schon im stehenden Wasser«, rief der Neger.
Noch dauerte es eine Viertelstunde, und dann erblickten sie das Ufer; der Brite sprang aus dem Boote, und der mit seinen Ketten belastete Neger kroch ihm nach, als die drei Mexikaner zugleich an beide herankamen.
»Vergeßt euer Boot nicht«, rief er ihnen drohend entgegen. Statt der Antwort schwirrte ein Dolch herüber, der, mit sicherer Hand geworfen, ihm an die Brust fuhr, aber am Lederwamse der Indianerin hängen blieb. ‹
»Elende Meuchelmörder!« schrie der Getroffene, der die flache Hälfte seines Ruders abgebrochen und mit der andern auf die Banditen losstürzen wollte, sich aber aus Leibeskräften vom Neger erfaßt sah.
»Massa kein Narre sein, die Seeräuber noch mehr Dolche haben, gerne sehen, wenn Massa nahe kommen, ihn dann leicht totmachen.«
»Du hast recht, Pompey«, versetzte dieser, halb lachend, halb ärgerlich über den zähnefletschenden Neger. »Die Hunde sind nicht wert, daß ein ehrlicher Mann sie totschlägt.«
Eine Weile hielten die drei Mordgesellen noch an, brüllten dann ein » Buen viaje a los infiernos! glückliche Reise in die Hölle!« herüber und sprangen in ihr Boot, in das sie ihrem Genossen halfen, und verschwanden in Nacht und Nebel.