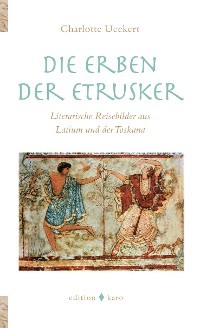Kitabı oku: «Die Erben der Etrusker»
Charlotte Ueckert
Die Erben der Etrusker
Literarische Reisebilder aus Latium und der Toskana
Le eredità degli Etruschi
Immagini di viaggio letterarie dal Lazio e dalla Toscana
Reiseerzählung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. Charlotte Ueckert, Die Erben der Etrusker Verlag Josefine Rosalski, Berlin 2013
1. Auflage 2013, © edition ♦ karo
im Verlag Josefine Rosalski, Berlin
www.edition-karo.de, alle Rechte vorbehalten Umschlagfoto außen: Etruskische Wandmalerei, um 470 v. Chr., © akg-images, Berlin Fotos Porträt und Frontispiz: © Charlotte Ueckert
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2013
ISBN 9783937881959

Etruskische Sarkophage im Hof des Nationalmuseums von Tarquinia
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Die Erben der Etrusker
Weitere Reiseerzählungen unseres Verlages
Eine von vielen bin ich, die es in den Süden zieht. Reisen nach Italien im Laufe der Jahre sind für jeden Nordländer fast eine Selbstverständlichkeit. Reisen in eine Gegend, die fähig ist, Bedürfnisse nach Fremde und Heimat zugleich zu erfüllen. Ich habe mich dem Versuch gestellt, mir das Fremde vertraut zu machen und dabei entdecken müssen, wie verschieden es ist von dem, was ich kenne. Je mehr ich erfahre, je mehr ich verstehe, umso besser erkenne ich die Differenzen.
Wenn ich neuen Bekannten erzähle, dass ich einige Monate im Jahr in Italien verbringe, dann mit einer leichten Beschämung, weil es überhaupt nicht originell ist, als Künstlerin oder Schriftstellerin so zu leben. Ich beuge mich einem Klischee, dem viele verfallen sind, das ist mir klar, aber ich beuge mich mit großem Vergnügen!
Wo in den Museen alter Kunst und Archäologie gibt es etwas zu lachen? Meist schaudert der Besucher vor feierlichem Ernst oder imposantem Grauen. Da fällt es umso mehr auf, wenn man in geheimnisvoll lächelnde Gesichter blickt. Das etruskische Lächeln strahlt sogar von Grabskulpturen und erhaltenen Grabmalereien. Selig verzogene Lippen bei Männern und Frauen, Paaren und sogar Kriegern. Ging es denen so gut, dass sie dies mit ihrem Lächeln zeigen wollten? Seht her, wir wissen, wie gut gelebt werden kann! Die schönste Utopie: sich glücklich zu fühlen. Oder können wir euch lehren, trotz allem zu lächeln?
Berühmt als Original im Museum der Villa Giulia in Rom, als Postkarte, Poster oder beliebtes Buchcover ist das Ehepaar, das in halb aufrechter Haltung vereint und zufrieden lächelnd auf einem Sarkophag ruht, der in Cerveteri, der etruskischen Metropole Caere, gefunden wurde. Sie lehnen sich aneinander und strecken beide erwartungsvoll die Hände aus, heiter und gelassen der Ewigkeit entgegenblickend.
Etwas ernster, in leidenschaftlicher Seligkeit umfangen und einander zugewandt, liegt ein Paar auf einem Alabastersarkophag, der in Vulci, ebenfalls einer der etruskischen Hauptorte, ausgegraben wurde und nun im Museum of Fine Arts in Boston zu sehen ist. Mann und Frau, vereint in Form einer Vase. Plötzlich verstehe ich die Erotik der Vasen, die in vielen Gräbern überdauert haben, vollständig oder aus Scherben restauriert: parallele Gebilde, einander ergänzende Formen. Mann und Frau, ebenbürtig dargestellt, vor oder nach der Leidenschaft in Innigkeit verbunden, eine fein gemeißelte Kunst, die unmittelbar ins Herz geht und die Betrachter zu gefühlsmäßigen Erben der Etrusker verwandelt.
Ihre Kunst- und Alltagsgegenstände füllen die bedeutenden Museen der Welt. Als eines der geheimnisvollsten Völker der vorchristlichen Antike sind sie bekannt: die Etrusker, die in der Mitte Italiens lebten. Rom-Touristen strömen in die Via Giulia und das gleichnamige Museum, wenn ihr Weg sie in die ewige Stadt führt. Und Florenz, ebenfalls eine der am meisten besuchten Städte Italiens, hütet neben dem Erbe der Renaissance die antiken Schätze, in denen diese wurzelt. Das Kernland der Etrusker aber, die Gegend zwischen beiden Metropolen, ist oft unbekannt. Die alten Namen Etrurien oder das italienische Tuscia sind vergessen oder nicht geläufig. Der Name Rasna, wie die Etrusker sich selbst nannten, ist kaum bekannt.
Auf der Suche nach den Spuren des antiken Volkes verirren sich zwar immer wieder Touristen in die Felsenstädtchen oder die ausgedehnten Grabanlagen, aber etwas in der Unübersichtlichkeit und Rauheit der Landschaft sperrt sich gegen Vereinnahmung. Und die Menschen dort?
Wer die Gesichter in den großartig bemalten Gräbern in Tarquinia mit den heute lebenden Menschen im Etruskerland vergleicht, kann darin eine Ähnlichkeit entdecken, die ahnen lässt, wie sich das geheimnisvolle Verschwinden des etruskischen Volkes erklären könnte: durch eine erfolgreiche Vermischung mit den ansässigen Volksstämmen, vor allem den siegreichen Römern, durch eine Integration, die dennoch das Erbe bewahrt hat. Ein grober, etwas bäuerlicher Zug in den Gesichtern, der sich von der typisch italienischen Bellezza des Florentiners oder Römers durch charakterliche Prägnanz unterscheidet. Die grazilen Figuren finden sich auf den aus Gräbern geborgenen Vasen und Trinkgefäßen in Hülle und Fülle. Der griechischen Kunst nachempfunden, während die Skulpturen auf den Sarkophagen oft plump aussehen, sogar mit missmutigen Zügen und heruntergezogenen Mundwinkeln. Erstaunlich viele Pummelige, kein Wunder bei dem Luxusleben, das sie angeblich führten. Sie kannten natürlich wie wir jede Stimmung, nicht nur die heitere, lebenslustige, die ihnen immer nachgesagt wird.
»Gibt es sie noch, die Erben der Etrusker?«, fragte ich und begab mich auf die Suche nach ihnen in eine Landschaft, die sich von Rom bis in die Toskana und darüber hinaus erstreckt, bis in die Poebene. Im Kernland selbst weisen die Leute natürlich gerne darauf hin, dass sie direkt von den Etruskern abstammen. Zum Beispiel dadurch, dass sie auf ihre Ohrlöcher hinweisen, die besonders groß sind, so groß, dass problemlos ein Finger hineinpasst. Etruskerohren.
Eine Sehnsuchtslandschaft liegt dort, die seit dem 17. Jahr-hundert vor allem Kunstreisende und Künstler aus dem Norden anzog, ein europäischer Zentralpunkt. Und heute? Kann es noch ein Bedürfnis nach Arkadien geben, wenn jeder Tourist sich die Reise hierher so einfach leisten kann? Wenn jeder die schöne Aussicht, das leichte Leben, das südliche Licht genießen darf, nicht nur der adelige Bildungsreisende auf Grand Tour, nicht nur der Künstler, der die Ansichten des Südens auf seinen Gemälden gewinnbringend in den Norden transportiert?
Was ist heute ›das gute Leben‹, das zum Beispiel der englische Schriftsteller D. H. Lawrence sich bei den Etruskern erträumte? Für ihn waren die ›langnasigen, feinfüßigen, bedeutungsvoll lächelnden Etrusker‹ das Gegenbild zum strengen, soldatischen Rom, das diese lasterhaft nannten, einem genussvollen Schlendrian ergeben.
»Man sagt, die Starken überleben,
Aber ich beschwöre die Geister der Verlorenen.
Jener, die nicht überlebten, der geheimnisvoll Verlorenen,
Um ins Leben ihre Bedeutung zurückzuholen,
Und unantastbar verhüllten in sanfte Zypressenbäume,
Etruskische Zypressen.«
Sein Gedicht Zypressen bündelt alle Phantasien und trotzt mit Frechheit jeder bigotten Betrachtung südlicher Sehnsüchte.
In diesem Gedicht aber findet sich auch etwas, das wir alle erträumen und das wir mit der Antike, mit Arkadien, mit den Etruskern und sogar noch mit den heutigen Italienern verbinden: Der Traum vom entspannten Leben, vom dolce vita, von einer Seinsweise, die der unsrigen, wie immer wir sie auch gestalten, entgegengesetzt zu sein scheint.
Und wie immer in Italien geht es dabei um Kunst. Schon 1282 schrieb Ristoro d’Arezzo, dass die ersten Funde von etruskischen Gegenständen und bemalten Vasen eine Begeisterungswelle auslösten und Kenner vor Vergnügen außer sich gerieten: »Wenn dergleichen Scherben in die Hände von Bildhauern, Zeichnern oder anderen Kunstverständigen kamen, so bewahrten sie sie fast wie Heiligtümer auf …«
Auch wenn dieses Erbe der Etrusker seiner Fülle wegen gefährdet ist – unmöglich alle Stätten zu finden, restaurativ zu bewahren und zu besuchen – hat die Verehrung in Italien bis heute Tradition. Deshalb sollten wir versuchen, dieses Erbe zu bereisen, solange gerade die verborgenen Orte noch in einer die Sinne betäubenden Wirklichkeit Bestand haben.
Etrurien, das bedeutet, von einer Höhe ins Tal zu blicken. Die Berge sind flach auseinandergezogen, die Täler gehen tief hinunter und auf ihrem Grund schlängelt sich ein Flüsschen. Wälder ziehen sich über die Abhänge oder, dort wo Menschen ihre Hand bearbeitend angelegt haben, weite Weideflächen und Felder, oft leer, denn das Land dehnt sich aus. Endlos biegen sich die kleinen Straßen, besonders, wenn sie unbefestigt sind.
Auf den schroff hochragenden Felsen hocken die Städtchen, deren Mauern aus der Etruskerzeit stammen, ihnen gegenüber, oft gleichberechtigt hoch, die Totenstädte, in Sichtweite der Lebenden als Mahnung und Zeugnis des Überlebens.
Eines Tages kam auch ich nach Etrurien und bin seitdem diesem Land verfallen. In jedem Jahr zieht es mich für einige Zeit hierher und die Frage, woher die Etrusker kamen, wird mir, je länger ich in ihrem Land verweile, immer unwichtiger. Natürlich verstehe ich die Archäologen, die glauben, dass es überwiegend eingeborene italische Stämme waren, die den Kern des Volkes bildeten. Dafür spricht die Villanova-Kultur, deren plumpe, dunkle und archaische Gefäße in allen Museen als Zeugen der ersten Anfänge des etruskischen Volkes ausgestellt sind. Die eleganten griechischen Vasen waren meist als Exportware gefertigt und zwar für den ›barbarischen‹ Geschmack. Damit waren die Etrusker gemeint. Von mir aus waren es auch die klugen, mystisch geschulten Leute aus dem Osten, vielleicht Kleinasien, wo die griechische Kultur ihren Höhepunkt erreichte, eine Elite, die alle anderen Urvölker der Region beeindruckte, so dass sie sich mit ihnen vermischten, wie später mit den Römern. Sie tauchten auf und sie verschwanden und sie faszinieren bis heute. So mancher Italiener bezieht seine Lebensart auf sie und das kann ich nachvollziehen. Auch wenn ich dafür über Gräberfelder stolpern, in ausgehauene Felsen kriechen und halsbrecherische Flusstäler durchsteigen muss. Auf den Höhen Reste einer Stadt oder auf die Reste einer Stadt gebaute mittelalterliche Ruinen, in den eingeschnittenen Tälern darunter die dunklen Eingänge, gemeißelte Quader und Scheintüren. Scheintüren? Ja, damals sehr beliebt. Und mir bleibt unklar, ob unerwünschte menschliche Eindringlinge, Diebe der Preziosen, abgewehrt werden sollten oder vielleicht böse Geister, die den Toten stehlen und die Seele mitnehmen könnten, dahin, wo es keine Unsterblichkeit gibt. Für die Etrusker offenbar eine schreckliche Vorstellung, ohne Spuren zu verschwinden.
Da keiner genau weiß, woher die Etrusker kamen, könnte auch der Mann aus dem Norden Italiens, den es hierher verschlagen hat, zu denen gehören, dessen Vorfahren hier einst siedelten. Aber ich blieb nicht nur seinetwegen.
Sprichwörtlich attraktiv wirken italienische Männer auf Frauen aus dem Norden. Es ist ihre Unbedingtheit des Habenwollens, die sie von einer frühkindlichen Bezogenheit auf ihre Mutter auf andere Frauen übertragen. Aber nach der Eroberung kommt oft die Ernüchterung. Vor allem für die Frau.
Susanne, geschieden, hatte einen guten Job in einer norddeutschen Stadt, eine schöne Wohnung in der besten Gegend, gute Freunde, aber die Suche nach der großen Liebe hatte sie sich noch nicht abgeschminkt. Als sie einen Italiener kennenlernte, einen Musiker, funkte es. Er imponierte ihr durch seine Großzügigkeit und eben sein unbedingtes Ihr-Verfallen-Sein. Sie kurvten mit Champagner auf dem Rücksitz an die Nordsee und er sang ihr Arien vor. Susanne, eine kluge Frau, krempelte im Alter von über 40 Jahren ihr Leben um: Sie kündigte ihren Job, gab die Wohnung auf und folgte ihrem Geliebten in den Süden. Ein paar Wochen ging alles gut, aber eines Tages sprach der Mann nicht mehr, saß im abgedunkelten Zimmer und verpasste Engagements. Es dauerte, ehe Susanne begriff, dass sie einem Manisch-Depressiven in seiner Hochstimmung aufgesessen war und dass sie nichts für ihn tun konnte. In der nächsten manischen Phase verließ er sie wegen einer anderen. Die mediterrane Lebensfreude hat auch ihre Kehrseite. So wie die farbe- und freudestrahlenden Fresken in den Gräbern oft von gräulichen Monstern gekrönt werden. Doppelschwänzige Wesen.
Wieder einmal bin ich angekommen. Diesmal mit dem Auto, weil ich eine Begleitung habe, mit der ich mich am Steuer abwechseln kann. Ein bisschen umständlich ist jede Form des Reisens. Im Auto muss ich an die Entfernung denken, die Lastwagen, die Zwischenübernachtung. Lieber nicht an die Spritpreise. Im Zug ärgere ich mich, wenn ein Anschluss nicht klappt oder ich kein Bett im Schlafwagen ergattere. Die schnellste Verbindung ist zugleich die stressigste: das Fliegen. Kein Problem, rechtzeitig am Flughafen zu sein. Kein Problem, anzukommen. Aber dann muss ich das Warten und Drängeln bei der Gepäckausgabe aushalten, was mich dazu bringt, möglichst mit Handgepäck zu reisen. Und ich muss alle meine Flüssigkeiten herzeigen, meinen Computer, meine Uhr.
Auch blieb es mir nicht erspart, einmal ohne Gepäck anzukommen. Der Koffer war zwar klein genug, aber zu schwer. So musste ich ihn abgeben, vergaß in der Hektik, was alles darin war an wichtigen Unterlagen, das Ladegerät fürs Handy, eine Kreditkarte, alle Kosmetika, ein Manuskript. Und wartete dann vergeblich – fünf Tage lang. Mein Koffer landete unter falschem Namen in einer weit entfernten Stadt, wie auch immer das passiert war. Dass so etwas geschehen kann, wusste ich. Aber wie scheußlich es ist, nicht. Nur mit meiner Handtasche fuhr ich weiter, kaufte mir in Orvieto erst einmal ein paar Schminkstifte, Cremes und Unterwäsche. Die Kreditkarte musste ich sperren lassen, ein Handy-Ladegerät kaufen und meine Nerven in Telefongesprächen strapazieren. Als der Koffer endlich kam, wusste ich einiges mehr über meine Beziehung zu Besitz und Verlust.
Da ich bei der Ankunft mit dem Flugzeug nie weiß, ob und wann ich den Zug nach Roma Termini oder Roma Tiburtina erreiche, fange ich an zu hetzen: es könnte ja sein, dass ein Zug gerade weg ist, weil ich noch einen Café getrunken habe. Und dann kommt wieder die Warterei. Auch die Züge nach Norden gehen nicht ständig, einen der schnellen Eurostars kann ich nicht nehmen, denn sie halten nicht dort, wo ich aussteigen will. Also beginne ich zu laufen, der Koffer trudelt hinter mir, die Handtasche rutscht, ich stoße überall an und manchmal erwische ich in letzter Minute den Zug, dessen Ziel erst zwei Stunden später wieder im Fahrplan steht.
Immer Gedrängel, auch in den Gängen, wer muss, spart sich den teuren Eurostar in die nördlichen Städte. In Orvieto erwartet mich ein Auto von Freunden und bringt mich ans Ziel. Wenn nicht, muss ich mein Handy zücken und ein Taxi rufen.
Bei jeder Ankunft entschädigt mich das Entzücken über den Blick von der Höhe ins Tal. Die ganze Weite des Tibertals und die schön geschwungenen Rundbögen des Apennins, eine natürliche Grenze bildend. Dann füllt es mich aus, dieses Gefühl, zu Hause in der Fremde zu sein.
Dort wo die wilden unzugänglichen Täler des Etruskergebietes anfangen, westlich von der Autobahn nach Rom, liegt Civita Castellana, eine verborgene Kostbarkeit, wie so viele Städtchen hier. Man fährt endlos enttäuscht durch Industriezonen und moderne Vorstädte, bis plötzlich Schluss ist. Es gibt zwar eine Brücke in die Altstadt, aber nur für Einheimische zugänglich. Wir parken davor und staunen erst einmal über die Aussicht. Vor uns majestätisch und ganz für sich allein der Monte Soratte, der heilige Berg, den wir noch ersteigen wollen. Hinter uns eine ebenso eindrückliche Burg, auch ein Kirchturm. Dom und Burg, so wissen wir bereits, sind die sehenswerten Baudenkmäler dieser Stadt – wie überall. Das etruskische Gräberfeld verborgen, schwer zu finden oder nur von weitem, in die Felsen gehauen, zu sehen.
Aber die Burg, Forte Sangallo, in Auftrag gegeben von Alexander Borgia, dem grausamen Papst der Renaissance, der durch seine Kinder Cesare und Lucretia mehr von sich reden machte als durch seine Politik, enttäuscht uns nicht. Wir müssen warten bis zur vollen Stunde, aber außer uns kommt niemand in den Raum, wo die Eintrittskarten verkauft werden. Dann führt die Beschließerin mit imposantem Schlüsselbund uns schweigsam beobachtend durch die prächtigen Höfe. Ein kleines Museum ist dort untergebracht, neun Säle, klein, überschaubar, gefüllt mit Vitrinen und deren kostbarem Inhalt, gesammelt im 19. Jahrhundert von der gräflichen Familie Feroldi. Neben bemalten griechischen Vasen sieht man einheimische Gefäße, die sich durch ihre flächigere, für uns modernere Malerei auszeichnen. Wunderbare Giebelfiguren neben geflügelten Niken, Schmuck, Votivgaben in Form von Augen, Beinen, Vulven und kleinen Penissen. Auch Darstellungen innerer Organe, die genaue anatomische Kenntnisse verraten. Natürlich jede Menge Waffen aus Bronze, rührend zerbrechlich, bestimmt nur durch das Alter, nicht durch ihren grausamen Gebrauch.
Hier haben westlich des Tibers die Falisker gelebt, einer der Stämme Italiens, die sich mit den nahen Etruskern schnell verbündeten, die mit ihnen gemeinsam eine vom 8. bis ins 2. Jahrhundert vor Christus in Mittelitalien dominierende Kultur schufen.
Wir, wer immer das ist, der Freund oder ein wechselnder Besucher, wir gehen um die Burg herum und sehen auf die dunklen Löcher im gelblichen Tuffstein auf der anderen Seite der Schlucht. Die Totenstadt liegt dort, entfernt und doch in Sichtweite für die Lebenden.
Etwa sechs Kilometer weiter befindet sich ein anderer Wohnort der Falisker, er heißt nach den Urbewohnern Falerii Novi. Im Jahre 241 vor Christus wurde er zum neuen Wohnsitz aller aus Castellana, früher Falerii Veteri, von den Römern vertriebenen Menschen. Erst im Mittelalter zogen die Einwohner zurück in die geschützt liegende alte Stadt, wo die etruskischen Stätten alle überbaut wurden und deshalb nicht unmittelbar zu sehen sind, wie in der verlassenen Ebene, zu der uns das Auto in wenigen Minuten bringt.
Aber wie kamen damals die Bewohner der eroberten Stadt in ihr sechs Kilometer entferntes Exil? Der Platz wurde ihnen von den Siegern zugewiesen, sie mussten sicher zu Fuß dorthin gelangen, vielleicht mit holprigen Wagen, auf denen sie ihren Hausrat getürmt hatten. Alte Männer, Frauen, Kinder, auf der Suche nach einem Zufluchtsort, auf dem Weg, ein neues Leben zu beginnen. Die jungen Männer waren gefallen oder gefangen. So wie überall auf der Welt nach einem Krieg.
Wir suchen vergeblich einen Parkplatz an diesem Ort, der im Mai allen Zauber des Frühlings entfaltet hat, ihn aber für sich behält und Besucher nicht erwartet. Neben einer Schlammpfütze hat das Auto gerade Platz, wir gehen zu Fuß durch das Jupiter-Tor, einen etruskischen Torbogen. Rundbögen virtuos zu bauen war eine Spezialität dieses Volkes, die sie Römern und mittelalterlichen Baumeistern vorbildhaft vermittelten. Das Tor wird gekrönt vom Kopf eines Gottes. Dahinter liegt ein bewirtschafteter Hof mit Hunden und Hühnern. Wir sehen noch die Mauern, welche die Stadt einst schützten. Reliefartig umgeben sie, verfallen und bewachsen, ein Areal, in dem nur einige Trümmerreste liegen. Auch eine Kirche aus dem Mittelalter mit anschließendem Klosterhof gehört dazu. Dort stehen hinter einem Fenster Pflanzen. Auf den Wiesen Schafe, ein Misthaufen und werkelnde Männer. Ein Teil der Kirche ist eingerüstet. Ein bei aller Stille, aller Verfallenheit lebendiger Ort. Und hartnäckig: die riesigen Eichen stehen bestimmt schon seit Jahrhunderten und wenn sie nicht mehr grünen könnten, würden die meterdicken Stämme noch lange von ihnen zeugen.
Ein Ort, in dem Vergangenheit lebt, Zukunft erahnt wird und die Gegenwart erfüllt ist von singenden Vögeln und dem nie zu heißen, aber auch nie tieferen Licht, als der Frühling es schenkt.
Ich liebe es, mich im April und Mai, wenn es für meine Nordhaut noch möglich ist, am frühen Morgen in die Sonne zu legen und sie einzusaugen. Dann weiß ich, warum ich so gern hier bin. Es ist dann alles, alles in Ordnung.
Dieses Licht, das die Maler nach Italien rief, das auch für Goethe strahlte, welches uns alles andere vergessen lässt und eine Ahnung von Unendlichkeit gibt.
Ach Goethe, er übernachtete einst am 28. Oktober 1786 in Civita Castellana. Von hier aus fuhr er nach Rom und hatte nichts anderes im Kopf.
Wie konnte er nur Tuscania auslassen, Tarquinia, Cerveteri! Wie an einer naheliegenden tausendjährigen Basilika vorbeifahren. Uralte Kultorte interessierten ihn weniger als antike römische Trümmer. Die Basilika Castel S. Elia liegt an einem Ort der Verehrung, einem faliskischen Heiligtum, dem Felsengott Falacro geweiht. Verständlich, denn über der Schlucht erheben sich nackte rote Felsen. Ein paar dunkle Löcher zeugen von frühen Einsiedlern, die sich um das Jahr 520 zusammenschlossen, um ein Benediktinerkloster zu gründen. Der Ruhm Benedikts von Nursia, Gründer eines der ersten Klöster am Fuße des Subiaco, südlich von Rom und den Sabinerbergen, der den Mönchen eine ihnen gemäße Lebensordnung gab, war auch in ihre weltabgekehrten, von den Etruskern übernommenen Felsengräber gelangt. Der Tempel der Jagdgöttin Diana, den die Römer an Stelle des uralten Heiligtums gebaut hatten – auch das passend zur Landschaft, denn über die Felsen ziehen sich Wälder, im Tal rauscht ein für die Jagd verheißungsvoller Bach – diesen Tempel gab es später nicht mehr. An seiner Stelle konnte Kirchlein auf Kirchlein gebaut werden, bis zu dem, das heute noch mit seinen Fresken und langobardischer Flechtband-Ornamentik dort steht und die Toten des unterhalb liegenden Friedhofs bewacht.
Vielleicht hätte Goethe der Diana-Tempel interessiert, aber ähnliche Römerreste fand er dann in Rom.
An einem aber musste auch er vorbeifahren: am heiligen Berg Soracte, oder Soratte, wie er heute heißt. Der ist von weither so sichtbar, so einzigartig, so charakteristisch für die ganze Gegend, dass er die Menschen anzieht, die ahnen, dass sie von oben einen Wahnsinnsblick haben – fast bis nach Rom.
Rom? Das ist eine der Städte, die Goethe prägte, die auch heute alle, die im Etruskerland ihre innere Heimat fanden, sofort dorthin eilen lässt, wo die besten Exponate aus allen Gräbern in der Villa Giulia ausgestellt sind. Ihre Herkunft über das Etruskerland verstreut gibt Zeugnis von der Geschichte des Volkes. Zu Goethes Zeiten, das muss man zu seiner Ehre zugeben, war das meiste noch unbekannt.
Kunst ist voller Bedeutung für sich, aber die Landschaft, in der sie entsteht, ist das Prägende. Ohne sie zu sehen und zu erfahren, sind die Gefäße und Statuen für mich weniger eindrucksvoll.
Dem Autofahrer verweigert sich der Berg Soratte, heute ein Naturschutzgebiet. Man muss eine gute Stunde aufwärts gehen, um den weiten Rundblick zu genießen. Durch Wälder mit altem, durch die isolierte Lage besonderem Bewuchs. Jeder Moment hält Geschichte gegenwärtig, Überlieferungen werden greifbar, die auf Dichter wie Horaz und Vergil zurückgehen.
Verehrt wurde hier der Lichtgott Apollo Soranus. Die Menschen, die sich ihm weihten, lebten als sogenannte ›Wölfe‹ auf dem Berg. Wolfsmenschen, vielleicht zurückgehend auf die Wölfin, die Romulus und Remus, die Gründer der Stadt Rom im 7. Jahrhundert, säugte, aber sicher auch Kult eines noch älteren Mythos. Davon zeugen vielleicht die Höhlen am unbewohnten Osthang des Berges, wo Ablagerungen auf schweflige Gase hinweisen. Wolfsmenschen – Werwölfe? Die Vereinigung eines düsteren Kultes mit dem Lichtgott Apoll? Der Versuch einer Aufhebung von Gegensätzen, wie in den auf gleicher Höhe liegenden Städten der Lebenden und der Toten, nahe beieinander.
Nein, Goethe hat nichts über den Berg geschrieben, aber dafür viele andere Dichter.
»Du siehst den Soracte, weiß von hohem Schnee«, dichtete Horaz. Später schrieb der englische Italien-Besucher Lord Byron:
»(...) Du, Soracte
der einsam ragt und nimmer den Mantel
aus Schnee dir über die Hüften breitest
du bannst mir den Blick, die Gedanken.
Denn du erhebst dich hoch aus dem Tal
Gleich der windgeschlagenen Welle,
die sich lockt und ein Wimpernblinzeln lang
schwebend steht, ehe sie bricht.«
Sehr nachvollziehbar, der Vergleich mit der Welle. Und Lord Byron bezeugt, dass wohl in den letzten Jahrhunderten kein Schnee den 691 Meter hohen Berg geziert hat, Zeugnis eines Klimawandels? Im strengen Winter 2011/12 lag Schnee in Rom. Bestimmt auch auf dem Soratte.
Kein Reisender konnte ihn übersehen, den isoliert wie ein mächtiges Ungetüm ruhenden Kalksteinfelsen inmitten eines weiten Tales, durch das der Tiber fließt. Er ist nicht so stark der Erosion ausgesetzt, wie die Tuffsteinfelsen an den Talhängen, in die der Wind bizarre Formen geschliffen hat, wo nur im Frühjahr grüner Bewuchs zu sehen ist und nur, wenn der Winter feucht war. Im Pliozän, vor zwei bis sechs Millionen Jahren, muss er eine wirkliche Insel im Meer gewesen sein, darauf lassen seine sand- und tonhaltigen Böden schließen. Das wissen Geologen, die sich mit Jahrmillionen beschäftigen, wogegen die etwa 2 800 Jahre, die mich jetzt beschäftigen, nicht mehr als ein Augenblick sind. Noch kürzer, aber schrecklich genug, war die Zeit der deutschen Besatzung von Oktober 1943 bis Juli 1944. Ein strategisch wichtiger Punkt war der Monte Soratte, der von den Alliierten bombardiert wurde. Reste der Militäranlagen sind immer noch zu sehen.
Eine der Zwölferstädte ist Veio, Rom am nächsten und eine der ersten, die sich 396 vor Christus unterwarf. Wie Vulci konnte es seine Unabhängigkeit noch hundert Jahre länger bewahren, nämlich bis 280 vor Christus, als letzter etruskischer Ort. Wie auch Norcia und Castel D’Asso liegt sie auf der Ebene eines Bergrückens, welcher weit in die Tiefe fällt, zerklüftet von einem Fluss, der sich seinen Weg durch die Felsen bahnte.
Es gibt hier besondere geologische Formationen im Fels, aber die größte Besonderheit ist der Apollotempel, dessen Fundamente von einer filigranen Metallkonstruktion erhöht werden, gekrönt mit Masken und der Statue des berühmten Apolls, heute eines der Glanzstücke in der Villa Giulia in Rom. Er lächelt freundlich und hat so für unser Bild den vermuteten Charakter der Etrusker mitgeprägt. Auch in Veio können wir einen größeren Rundgang machen, der uns zu verschiedenen Gräbern führt. Zweimal kommen wir, mehr durch Zufall, zum Auto auf dem Parkplatz zurück, wo schon seit unserer Ankunft im Schatten eines großen Baumes neben uns ein anderer Wagen aus Deutschland parkt. Zuerst scheint er leer zu sein, aber als wir dort aussteigen, erhebt sich eine Frau auf dem Fahrersitz. Sie kramt im Wagen und ich sehe sie schwer atmen, beinahe prusten. Beim zweiten Treffen steht sie neben der offenen Wagentür, läuft schwerfällig um beide Autos herum.
»Geht es Ihnen nicht gut?«, frage ich. »Können wir helfen?«
Sie kann kaum sprechen, ihre Stimme klingt gebrochen, rau, asthmatisch. Sie ist vielleicht fünfzig, ein abgearbeitetes Gesicht, krummer Rücken, die Füße stecken in dreckigen Sandalen. Sie bewegt sich wie eine ganz alte Frau.
»Leben Sie hier?«, fragt sie zurück. Als ich verneine erklärt sie, sie wohne in der Nähe, das Klima nehme ihr die Stimme, auch die Atmosphäre des Ortes. Ihr italienischer Mann, von dem sie allerdings schon lange getrennt gewesen sei, wäre inzwischen gestorben. Ihr Auto habe sie in Deutschland gemeldet, weil es dort billiger wäre.
Wir grüßen, gehen weiter den nächsten Weg. Als wir wiederkommen läuft sie immer noch somnambul schwankend und vor sich hin starrend neben den beiden Autos hin und her. Drogen? Eine dieser im Traumland gestrandeten Deutschen? Ich überlege, wie ihr zu helfen ist, aber mir fällt nichts ein, was ihre Souveränität nicht verletzt.
Wir gehen noch einmal zum Wasserfall, der in der Sonne glitzert. Daneben stehen die Mauern einer alten Mühle, über und über mit roter Schrift bekritzelt.
›Eleonora Puttana‹ steht dort und ich denke plötzlich an die Frau. Wartet sie auf dem Parkplatz auf Freier? Schafft sie das, so zerstört wie sie aussieht? Als wir zum Auto gehen, fährt ein anderes mit einem einzelnen Fahrer weg. Zum Abschied winkt sie uns und ich wünsche ihr: »Gute Besserung.« Ja, sie habe sich gerade die Brust eingerieben, es werde bald wirken, sagt sie mit fast verlöschender Stimme.
Die Via Cassia hinauf ist unser nächster Halt Sutri, wo wir das Amphitheater durch die Gittertür sehen – das Wärterhäuschen, wo es außer den billietti auch den Schlüssel zum Mithras-Heiligtum geben soll, steht verschlossen. Ich wollte meinem deutschen Besucher zeigen, wie aus einer etruskischen Grabanlage zuerst ein Mithras-Heiligtum und dann eine christliche Kirche hervorgegangen war, der Madonna zu Ehren. Die Entwicklung der Spiritualität authentisch nachempfinden. Wie so oft in Italien, blieb nur der Blick von außen.
Anders als die berühmten römischen Theater ist dieses stufige Halbrund nicht freistehend errichtet, sondern in einen Tuffsteinhügel gebaut, der außen von Gräbern unterhöhlt ist. Es soll noch aus der Etruskerzeit stammen, wie auch die Sitte der Gladiatorenkämpfe Gefangener, die bei den Etruskern nach Begräbnissen ihrer im Krieg gefallenen Kämpfer stattfanden. Erst etwa ab 100 vor Christus setzten auch die Römer Gladiatoren-kämpfe zur allgemeinen Belustigung ein.
Derartige Brutalitäten lassen sich in der heutigen Toskana kaum noch ahnen. In der Nähe von Grosseto liegen die Ruinen von Roselle, auch eine der Zwölferbundstädte. Schon auf dem Weg dorthin fiel mir auf, wie picobello die Häuser überall renoviert sind, wie viele Agritourismusschilder die Straßen säumen, wunderbare Anwesen mit gepflegten Auffahrten und Swimmingpool. Selbst die Straßen haben dort weniger Schlaglöcher. So gepflegt auch die Ausgrabungsstätte von Roselle. In der Etruskerzeit lag die Stadt, gegenüber der Schwesterstadt Vetulonia, an einer inzwischen verschwundenen Lagune. Vorbildlich ausgeschildert und beschriftet, die etruskischen von den römischen Fundamenten unterschieden, die zwei verschiedenen Wege zum Forum und zu den zyklopischen Mauern aus etruskischer Zeit markiert. Mehr als drei Kilometer zieht sich die Mauer um das Areal, das leider aktuell nicht ganz zu umrunden ist. Von den Römern im Jahr 294 vor Christus erobert, lebte die Stadt auch zur Zeit der ersten Christen, die dort eine Kirche bauten und zum Schrecken der Heiden ihre Toten rund um die heilige Stätte bestatteten, weiter. Erstaunlich, wie die traditionelle Trennung der Lebenden von den Toten sich bis heute erhalten hat. Schönes Wohnen am Friedhof, wie bei uns beworben, weil es dort grün und ruhig ist, bleibt undenkbar hier. So hat sich wieder eine Etruskertradition bewahrt, trotz des späteren Christentums. Roselle, in einer Senke zwischen einem Nord- und einem Südhügel gelegen, mit weitem Blick in die Ebene, verlor seine Bedeutung endgültig, als der Bischofssitz von Papst Innozenz II. ins aufblühende Grosseto in die Ebene verlegt wurde. Das Amphitheater, mit einigen grünen Plastikstühlen versehen, aber ebenso grasüberwachsen wie in Sutri, wirkt hier in der sauberen Toskana ganz harmlos. Die Vorstellung von Gladiatoren oder mit Löwen kämpfenden Christen stellt sich nicht ein. Strahlend weiße Kopien von römischen Statuen blenden uns als Fotokontraste vor den rostroten Ziegeln.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.