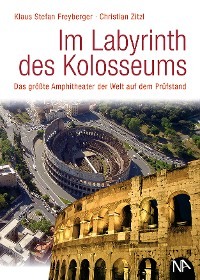Kitabı oku: «Im Labyrinth des Kolosseums», sayfa 2
Die Verteilung der Sitzplätze
Jeder Bürger besaß eine Eintrittsmarke, auf der die Nummern der Arkade (vgl. Abb. 4), des Ranges, des Zuschauersektors und der Stufe angegeben waren. Der Platz in einem Rang der cavea spiegelte die soziale Stellung seines Inhabers wider. Laut Sueton (Augustus 44, 3–4) ließ Augustus die Sitzordnung hierarchisch regeln, indem die verschiedenen sozialen Schichten bei öffentlichen Aufführungen ganz bestimmte Ränge und Plätze einnahmen. Die Senatoren nahmen die erste Reihe der Tribüne ein. Ihnen folgten die hohen Offiziere in der ersten Reihe des ersten maenianum. Auf Treppenstufen eingravierte Inschriften forderten zur Beachtung der Rangordnung auf. Sie geben das Amt, die Priesterklassen, die Stände und die Volksgruppen an. Reservierte Plätze für Botschafter und ausländische Diplomaten (hospites) sind durch Inschriften kenntlich gemacht. Ferner sind Reservierungen für Personen aus bestimmten Orten bezeugt, beispielsweise für die Einwohner von Cadiz (Gaditanorum). Andere Inschriften erwähnen eigene Plätze für die Lehrer (pedagogi puerorum) oder die noch nicht Volljährigen, die nach ihrer Kleidung, der toga praetexta, praetextati hießen. Ein epigraphisches Zeugnis aus dem Jahr 80 n. Chr. enthält eine Liste mit reservierten Plätzen für die Mitglieder des Priesterkollegiums der Arvalen (CIL VI 2059 = 32363), die entsprechend ihrem Rang innerhalb des Kollegs in unterschiedlichen Sektoren des Zuschauerraums von der Tribüne bis zu den hölzernen Treppenstufen Platz nehmen mussten. Einige der marmornen Blöcke, die ursprünglich zur Brüstung (pluteus) des Podiums gehörten, sind mit den Familiennamen von Senatoren versehen. An einer der Brüstungen ist auf der Vorderseite eine Ehreninschrift für den Präfekten von Rom Flavius Paulus angebracht, der um die Mitte des 5. Jhs. n. Chr. eine Restaurierung des Zuschauerraums durchführen ließ. Auf der Rückseite finden sich in entsprechender Position zu den dahinter folgenden Sitzplätzen Inschriften mit den Namen mehrerer Senatoren, die ihren Platz in der ersten Reihe hatten. In anderen Fällen waren die Namen am oberen Rand der Treppenstufe eingraviert. Die Namen verstorbener Senatoren wurden entfernt und durch die Namen neuer Personen dieses Standes ersetzt. Die noch lesbaren Namen beziehen sich auf Senatoren aus dem späten 5. Jh. n. Chr., einem Zeitpunkt, der das Ende der Spiele im Amphitheater markiert.

Abb. 8: Rom, Kolosseum, Grundriss, Erdgeschoss
Unteres Niveau: a) Haupteingänge auf der Längsachse; b) Service-Türen; c) Fenster; d) Zugang zum Podium; e) Treppen zum maenianum primum; f) Treppen zum obersten Bereich der cavea; g) Kanäle; h) Travertin-Pfeiler zur Anbringung von Absperrschranken; i) Platea. A: Räume unter den Logen (sacella?) XXXVIII bis LIIII: Eingangsnummern über dem Scheitel der Arkaden.

Abb. 9: Rom, Kolosseum, Grundriss, Untergeschoss
1. Plan des Souterrains. A: Zentraler Gang unter der Arena; B: Seitengänge unter der Arena; C, D: Unterirdische Ringgänge; E: Endgänge ohne Ausgang; F: Durchgang zum Ludus Magnus; G: Unterirdischer Verbindungsgang zum pulvinar, angelegt während der Herrschaft des Kaisers Commodus; H: Hauptgang auf der Querachse.
a) Überwölbte Service-Räume; b) Service-Treppen; c) posticae auf zwei Ebenen; d) Windensteine zur Befestigung des Drehlagers der Winden.
2. Querschnitt. A: Zentraler Gang auf der Längsachse; B: Seitengänge; C, D: Ringgänge; d) zentral postierte posticae auf zwei Ebenen und Lastenaufzüge; H: Hauptgang auf der Querachse; h) Travertin-Pfeiler zur Anbringung von Absperrschranken; i) Konsolen als Halterung für die Masten der Sonnensegel.

Abb. 10: Rom, Kolosseum, Schnitt durch die cavea mit Glossar
Nr. 1: Erstes ambulatorium (Deambulatorium); Nr. 2–4: Zweites bis viertes ambulatorium; Nr. 5: Podium (Tribüne); Nr. 6: Maenianum primum (Zweiter Rang); Nr. 7: Maenianum secundum imum (Dritter Rang, unterer Bereich); Nr. 8: Maenianum secundum summum (Dritter Rang, oberer Bereich); Nr. 9: Maenianum summum in ligneis; Nr. 10: Arena; Nr. 11: Podiumsmauer; Nr. 12: Brüstung (pluteus); Nr. 13–15: Umlauf (iter praecinctionis).
Die Arena und das Untergeschoss (vgl. Abb. 2, 8, 9)
Die zwei auf der Ost-West ausgerichteten Längsachse des Amphitheaters gegenüberliegenden Eingänge gewährten Eintritt in die Arena. Diente die porta triumphalis auf der Westseite als Eingangsportal für die Gladiatoren, so war das Pendant auf der Ostseite, die porta libitinaria, für den Abtransport der Toten bestimmt. Der Name des Torbaus bezieht sich auf Venus Libitina, die in Rom als die Schutzheilige der Grabstätten galt und in einem heiligen Hain bei den Nekropolen am Esquilin verehrt wurde. Von beiden Eingängen aus konnte man über steile Treppen direkt in die unter der Arena gelegenen Räume gelangen, in denen die Tiere gehalten und die für die Spiele notwendigen Ausrüstungen und Ausstattungen aufbewahrt wurden (vgl. Abb. 2, 9). Das gesamte unterirdische Geschoss war in vier Segmente unterteilt, die sich durch die Kreuzung der Längs- und Querachse ergaben. Entlang der Außenmauer verliefen weitere Räume, die dem Betrieb der Spiele dienten. Ursprünglich überwölbt, wurden sie später in kleine zweigeschossige Zellen umgebaut. Um in der Arena die umfangreiche und schwere Bühnenausstattung zu bewegen, gab es ein System von Gegengewichten und schiefen Ebenen im Unterbau, von dem noch die Löcher im Fußboden der Gänge zeugen. In diesem Bereich waren die Winden zur Bewegung der Gegengewichte in Windensteinen verankert, die auch im Großen Amphitheater in Capua bezeugt sind.12 Charakteristisch für die Windensteine ist das Oberlager mit einem runden Loch im Zentrum und zwei sich gegenüberliegenden schwalbenförmigen Vertiefungen, in denen das metallene Drehlager der Winden verankert war.
Der Zentralgang, der sich unter dem Osteingang fortsetzte, verband die unterirdischen Räume des Amphitheaters mit dem Ludus Magnus, der nahe gelegenen Gladiatorenkaserne (Abb. 11).13 Heute sind noch die Spuren von Umbauarbeiten, Restaurierungen und Wiederaufbauten zu sehen, die durch Brand- und Naturkatastrophen sowie durch Abnutzungen erforderlich waren. Der Zerfall des Untergeschosses markierte das Ende der Gladiatorenspiele und führte schließlich zur Aufgabe des gesamten Gebäudes.

Abb. 11: Rom, Ludus Magnus, Grundriss.
10
Graefe 1979, 56–61 Abb. 62–68 Taf. 55–63.
11
Ebd., 61 Taf. 63,3; Hufschmid 2009, 416 Abb. 155 links.
12
Hufschmid 2009, 468 Abb. 239.
13
Coarelli 2001, 147–151 Abb. 1–4; Bosso – Moesch 2001, 320 Nr. 8 mit Abb.; Coarelli 2003, 204–207 mit Plan.

Bauphasen des Kolosseums:
Archäologische Befunde
Ausgrabungen rund um die Meta Sudans
Auf den Ruinen von älteren, vermutlich durch den neronischen Brand zerstörten Häusern nordsüdlicher Ausrichtung entstanden ab 64 n. Chr. östlich und nördlich der späteren Meta Sudans äußerst stabile Substruktionen aus opus caementicium. Bei den Grabungen wurden 17 Räume ganz oder teilweise freigelegt. Diese Strukturen zu beiden Seiten einer schmalen Straße werden einer Terrassenarchitektur der Domus Aurea zugerechnet.14 Nachdem der Schutt des neronischen Brandes weggeschafft war, schüttete man das Gelände bis zu 4 m hoch auf. Diese Maßnahme wirkt wenig überzeugend. Wenn das Gelände tatsächlich um 4 m erhöht wurde, hätte man den Brandschutt einplanieren können. Es wurde aber nur eine dünne Schicht davon gefunden. Diese Niveauerhöhung brachte man in Verbindung mit dem aus der schriftlichen Überlieferung bekannten künstlichen See auf dem Gelände der Domus Aurea.
Statt das Gelände aufzuschütten und dann in diese Aufschüttung das Wasserbecken hinein zu graben, hätte man den See einfach direkt im Gelände ausheben können.
Die Substruktionskammern von 7 × 4 m Größe sind nach Westen und Osten geöffnet.15 Deren Stirnseiten bestanden auf der Ostseite aus feinem Ziegelmauerwerk, in dem auch wiederverwendete Fragmente von tegolae zu erkennen sind. Als Beischlag für den Kern des opus caementicium diente ebenfalls Ziegelbruch. Die bis in eine Tiefe von 6 – 7 m reichenden, in eine Schalung gegossenen Fundamente bestehen dagegen aus caementicium mit gemischten Beischlagstoffen. Die Kammern zeigen an den Wänden keine Spuren einer Verkleidung, ebenso sind keine Partien von Fußböden feststellbar.
In den 1986 ausgehobenen Gräben für neue Gasleitungen an der Westseite des Kolosseums zeigten sich Baureste, die angeblich eine Fortsetzung dieses Substruktionssystems nach Norden belegen. Weitere Mauerzüge nördlich des Amphitheaters wurden 1992 angeschnitten.16 Die Rückwände der nördlich der Meta Sudans gelegenen Räume 1–10 traten westlich des Kolosseums noch einmal zu Tage.17 Östlich der Kammerreihen zeigte sich in den Gasleitungsgräben ein anderes Substruktionssystem mit größeren Räumen. Als westlicher Abschluss dieser Struktur diente ein auf der Forma Urbis verzeichneter Mauerabschnitt in Nord-Süd-Richtung. Die Anhaltspunkte für diese weiter östlich liegenden Substruktionen sind allerdings gering. Von den vier rekonstruierten Pfeilern wurden nur Reste von zwei Objekten gefunden. Diese setzte man in Zusammenhang mit zwei Mauerzügen. Es ergeben sich Räume, welche die dreifache Spannweite in Ost-West-Richtung aufweisen wie die südlich der Meta Sudans ausgegrabenen Kammern. Aufgrund der schwächeren Struktur erscheint es sehr fraglich, ob überhaupt von Substruktionen gesprochen werden kann. Es können jedenfalls nicht beide Architektursysteme in einem Atemzug genannt und als Terrassenunterbauten definiert werden.18
Die Kammerreihen bei der Meta Sudans tangieren nicht das Kolosseum, sondern streichen westlich von diesem vorbei. Das östliche Raumsystem in der vorgeschlagenen Rekonstruktion scheint dagegen von dem Amphitheater gestört zu werden. Die Beweislage für diesen Sachverhalt ist allerdings schwach. Über die Zeitstellung der östlichen Räume ist nichts bekannt. Nicht zwangsläufig müssten diese Strukturen und das Amphitheater auf eine zeitliche Abfolge schließen lassen. Der Grabungsbefund gestattet auch die Interpretation, dass die Räume an ein bestehendes älteres Amphitheater angebaut sein könnten, denn eine Berührung zwischen dessen Außenfassade und dem postulierten Gebäude wurde nicht gefunden. Die später mit den östlichen Substruktionen verbundenen Mauerreste im Nordwesten des Kolosseums setzen deren Raumsystem nicht fort.19 Die Orientierungen der Mauern bleiben gleich, aber in diesem Bereich fanden sich weder die für das südöstliche Raumsystem kennzeichnenden Mauerpfeiler, noch ähnliche Raumgrößen. Vermutlich wurde von den neuen, nicht weiter erläuterten Leitungskünetten für die 1992 erneuerten Gasleitungen ein anderes Gebäude angeschnitten. Wie auch immer die beiden Substruktionssysteme und die anderen Mauerzüge zu interpretieren sind, so reichen die ausgegrabenen Reste keinesfalls für die Rekonstruktion des von Sueton erwähnten künstlichen Sees aus. Trotzdem wird an seiner Existenz und an den postulierten Maßen festgehalten.20 Für ein Wasserbecken mit einer Fläche von ca. 40.000 qm gibt es keinerlei archäologische Beweise; es wurden auch keine Wasserzu- oder -ableitungen gefunden, die für eine Anlage dieser Dimension ebenfalls reichlich ausgelegt gewesen sein müssten.
Ausgrabungen in der Arena des Kolosseums
Bei den Ausgrabungen in den Jahren 1986, 1995 und 1998/1999 im Bereich der Arena kamen in fünf der acht Schnitte ältere Baureste zum Vorschein.21 Die Strukturen wurden in das jüngere Bauwerk integriert oder von ihm gestört. In den Grabungsfeldern von 1, 19 und 27 aus den Jahren 1986 und 1995 wurden Tuffmauern freigelegt. An ihnen ist eine Ost-West orientierte Verbauung des Geländes ablesbar, die in die Zeit vor der Herrschaft Neros zu datieren ist. In Schnitt 1 legt sich ein Boden in opus signinum darüber. Dieser ist den Fußböden der Domus unter dem Tabularium und der Kammern des von Portiken umgebenen oberen Hofs des Heiligtums von Praeneste ähnlich. Aufgrund der Übereinstimmungen mit den verglichenen Böden sind die Bodenreste unter dem Kolosseum entweder in die letzten Jahrzehnte des 2. oder spätestens in die 1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. zu datieren.22 Auf dem Boden befindet sich ein Brandschutt, der wie fast alle Brandschichten im Bereich des Kolosseums in Verbindung mit dem neronischen Stadtbrand gebracht wird.
Im Schnitt 1995 zeichnen sich drei ältere Bauphasen ab. Über der ältesten freigelegten Quadermauer zeigten sich Spuren eines jüngeren Mauerzugs und schließlich ein Stampfboden. Aus der unregelmäßigen Anordnung der Mauerreste und der Existenz mehrerer älterer Bauphasen wird auf eine lebhafte Bautätigkeit in der späten Republik geschlossen. Auf der Tuffmauer US 18 ruht unmittelbar die als flavisch angesehene Bodenplatte aus opus caementicium23, die sogenannte Masicciata, die auch die Peperinmauer US 1915 in Schnitt 19 überdeckt. In die als Masicciata bezeichnete Schicht wurden die einzelnen Tuffquader der aufgehenden Mauern um einige Zentimeter eingetieft. Nur in Schnitt 27 liegt zwischen der Quadermauer eine Planierschicht mit Travertin- und Tuffbrocken sowie umgelagerten Keramikfragmenten aus dem 3. – 1. Jh. v. Chr.24 Diese Planierung kam auch in Schnitt 6 zum Vorschein25, die beim Abriss der Vorgängerbebauung und der Einebnung des Geländes in Niveauhöhe von 15,50 – 15,71 m entstand. Von diesem Niveau aus wurden die Fundamentgräben der Tuffmauern ausgehoben, die sich unter der Masicciata fortsetzten. Es zeigten sich keine Anzeichen für ein künstliches Wasserbecken. Dieser Befund führte zu der Annahme, dass ein solches zwar existiert hatte, aber bei der Herstellung des sogenannten flavischen Bauniveaus völlig zerstört wurde. Die aus opus caementicium errichteten Fundamente des Kolosseums bestehen aus zwei ellipsenförmigen Ringen von 6 m Höhe.26 Der untere Ring wurde nur sehr beschränkt durch Grabungen und Bohrungen nachgewiesen, der obere Ring ist sichtbar. An der Südseite des Amphitheaters kam die äußere Ringmauer des jüngeren Fundaments mit einer Breite von 1,20 – 2,50 m zum Vorschein, welche die Baugrube begrenzte. Die Fundamente setzen sich stufenförmig über die älteren Baureste hinweg.
Im Jahr 2000 wurden sechs Bohrungen im Bereich der Arenaeinbauten ausgeführt.27 Vier von ihnen stellten die Fundamenttiefe der Tuffmauern mit 3,25 m fest. Die Bohrkerne wiesen unterschiedliche Ausführungen der Fundamente nach, die auf das unregelmäßige Gelände zurückgeführt werden. Da die Tuffblöcke der Mauern nicht direkt auf den Streifenfundamenten, sondern auf der Grundplatte der Masicciata ruhen, besaß das Untergeschoss der Arena demnach eine Bodenoberfläche, die zunächst ohne Mauern genutzt wurde. Die Blöcke des opus quadratum aus Monteverde-Tuff erreichten Maße bis zu 2,40 × 1,30 × 0,90 m.
Zwischen den Befunden der spätrepublikanischen Zeit und der vermuteten flavischen Bauzeit des Kolosseums besteht eine chronologische Lücke. Daraus folgt zwingend, dass nach den beschriebenen Befunden das Kolosseum spätestens in die spätrepublikanische Zeit und zwar in den Zeitraum vom Ende des 2. Jhs. bis in die 1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. datiert werden muss.
Nach der Planung und Ausführung der Fundamente während der Herrschaft des Kaisers Vespasian wurden im Jahr 80 n. Chr. die Einweihungsspiele von dessen Sohn Titus veranlasst. Das aufgehende Mauerwerk stammt angeblich aus der Regierungszeit des Titus und Domitian.28 Angesichts der für ein Bauwerk dieser Dimension auffallend kurzen Zeitspanne vom Entwurf bis zur Einweihung (ca. zehn Jahre) und der chronologischen Lücke im Fundmaterial überrascht vor allem die Tatsache, dass aus dem vermeintlich flavischen Bauniveau keine flavischen Funde erwähnt wurden.
Die Holzabdeckungen in der Arena
In den Untergeschossen der Arena wurden Reste einer Bauphase vorgefunden, die noch vor der Errichtung der Tuffmauern in Benutzung stand. Ein System von Quadern aus Travertin mit quadratischen Pfostenlöchern trug senkrechte und darüber waagrechte Holzbalken, die in die Umfassungsmauer der Arena einbanden. Zueinander halten sie einen Abstand von 1,50 m ein.29 Man nimmt an, dass diese Konstruktion für eine der Einweihungsfeiern 79 oder 80 n. Chr. entstand. Mit ihr war es möglich, die noch unbebaute Fläche des Untergeschosses für Naumachien (Seeschlachten) zu nutzen. Diese sind von Martial (Liber spectaculorum 24–26, 30) und Sueton (Domitian 4) schriftlich bezeugt. Die durch große Nischen und Steinkonsolen belebte Umfassungsmauer hätte bei diesen Veranstaltungen eine Art Bühnenhintergrund geboten.
Für die Abdeckung der Arena in vespasianischer Zeit ersetzte man die einzelnen Pfostenhalter aus Travertin durch Ost-West orientierte Mauerzüge aus Tuff, die das Untergeschoss in die 2 – 4 m breiten Korridore A bis H unterteilten. Diese Mauern waren 0,90 m tief und 6,30 m hoch. Man geht davon aus, dass sie zu schwach bemessen waren und nachträglich verstärkt werden mussten. Die Holzabdeckung der Arena ist anhand der Spuren auf den Oberlagern der erhaltenen Tuffmauern rekonstruierbar (Phase A).30 In den schwalbenschwanzförmigen Aussparungen auf den Mauerkronen lagen kurze Querhölzer, die parallel zu den Mauern verlaufende Pfetten unterstützten. Diese trugen Querbalken, die den betreffenden Korridor überspannten und auf denen die Bohlen des Bretterbodens auflagen.
Allen Phasenbeschreibungen am Kolosseum ist anzumerken, dass die chronologische Prämisse eines Neubaus auf der grünen Wiese bzw. im See in flavischer Zeit Probleme aufwirft. Die Bauabfolge muss auf einen sehr kurzen Zeitraum zusammengedrängt werden. Der Entwurf wird der Regierungszeit des Kaisers Vespasian zugeschrieben. Die Mittel für den Bau kamen aus der Beute des Jüdischen Kriegs und standen demnach wohl erst ab 71 n. Chr. zur Verfügung. Das Gebäude wurde aber laut der Überlieferung von Sueton (Domitian 4,1) erst während der Herrschaft des Kaisers Domitian fertiggestellt, der bereits wieder die hölzerne Arenaabdeckung für die Einweihungsfeier durch Titus mit Mauereinbauten erneuern musste.31 Es erscheint unsinnig, dass eine höchstens zehn Jahre alte Struktur schon wieder restauriert werden musste, da dieselben Tuffmauern noch heute bestehen. Zu der 24 Jahre währenden Herrschaft der flavischen Dynastie gehören demnach sowohl die Abdeckung der Arena mit den Blöcken aus Travertin als auch die Pfostenständer und der auf den Tuffmauern aufliegende Arenaboden der Phase A. Warum sollte man extra für die beiden Einweihungsfeiern 79 und 80 n. Chr. einen eigenen Arenaboden errichten, um bald danach Mauerzüge einzuziehen und eine völlig anders konstruierte Arenaabdeckung auszuführen?
Mit diesen Maßnahmen wurde die Nutzung für Naumachien aufgegeben. Es fragt sich, warum dem Spielbetrieb diese Einschränkung auferlegt wurde. Vielleicht hatte Nero, der für Naumachien mit Krokodilen schwärmte, an seinem „stagnum“ bauliche Veränderungen vornehmen lassen, welche die Weiterführung dieser Darbietungen erschwerten. Das zur Flutung der Arena nötige Wasser könnte in der Domus Aurea anderen Zwecken zugeführt worden sein. Die domitianische Datierung der Tuffmauern beruht auf der Annahme, dass nach der Errichtung der Naumachia Vaticana diese Funktion ausgelagert wurde. Ebenso erscheint es eigenartig, dass zwei Eröffnungsfeiern stattfanden, obwohl sich das Bauwerk angeblich erst in einem rudimentären Zustand befand.32 Es kann sein, dass es sich dabei nur um propagandistische Spektakel handelte, aber wahrscheinlicher ist die Annahme, dass die Strukturen eines älteren Amphitheaters weiter benutzt wurden.
14
Panella 1990, 62–70 Abb. 1, 2, 4–6, 27–34.
15
Ebd., 67–70 Abb. 34.
16
Panella 1996, 166 Abb. 154.
17
Panella 1990, 67 Abb. 1, 16, 28; Panella 1996, Abb 6, 7.
18
Panella 1996, 166 Abb. 154.
19
Medri 1996, 166 Abb. 152, 154.
20
Rea et alii 2002, 343 Abb. 1, 2.
21
Rea et alii 2000, 313–317, 337 f. Abb. 2, 4, 16, 30, 38–40.
22
Vorbehaltlich der Richtigkeit der Datierungen. Die Datierungsgrundlagen erscheinen größtenteils wenig tragfähig und lassen frühere Entstehungszeitpunkte möglich erscheinen.
23
Ebd., 316, 330 Abb. 37 US 628: Massicciata, 0,50 m stark.
24
Ebd., 322 Abb. 16 (US 2731), 324.
25
Ebd., 319 f. Abb. 11 (US 630).
26
Rea et alii 2002, 346–349 Abb. 4, 6, 7. Die Zeichnung Abb. 6 besitzt weder eine Angabe zur Lage des Aufschlusses noch zu den Himmelsrichtungen. Dasselbe gilt für Abb. 7, auf der unter den vielen Strukturen der obere Fundamentring nicht sicher zu erkennen ist.
27
Ebd., 354–361 Abb. 10, 12.
28
Beste 1998, 118.
29
Beste 2000, 115–118.
30
Beste 2011, 262–269 Abb. 2, 3.
31
Rea et alii 2002, 352 f.
32
Ebd., 346 noch ohne äußere Tragkonstruktion (?).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.