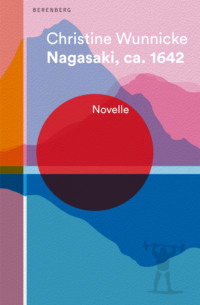Kitabı oku: «Nagasaki, ca. 1642»


Christine Wunnicke
Nagasaki, ca. 1642
Novelle

Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
1
»Ich habe seit geraumer Zeit eine offene Frage«, sagte Seki Keijiro zu seinem Schwiegervater. »Zwei Tage vor Frostbeginn fährt sie mir immer kalt in die Knochen.«
Sein Enkelsohn kletterte an ihm hoch. Keijiro hielt sich dessen Haarpinsel behutsam von der Nase fern.
»Du und deine Knochen.« Der Schwiegervater verdrehte die Augen. Es gab nie Frost am Tag des Frostbeginns, in der sonnigen Provinz Bichuu.
»Ich habe seit genau einundvierzig Jahren eine Rechnung offen«, sagte Keijiro.
Der Enkelsohn rutschte auf seinen Schoß hinunter und krabbelte über ein Knie zu Boden. Dann begann er wieder zu klettern. Keijiro wischte sich den Haarpinsel gemächlich aus dem linken Auge.
»Frage oder Rechnung?«, erkundigte sich der Schwiegervater.
Jetzt hatte der Enkelsohn die Zehen in Keijiros Gürtel gehakt und hielt sich an dessen Ohr fest. Keijiro schob ihn auf seine Schulter hoch, ließ ihn den Rücken hinunterrutschen, griff hinter sich und fing ihn, im Kopfstand in der hohlen Hand. Er drehte ihn um und setzte ihn auf seinen Schoß und zwirbelte den Haarpinsel besonnen zwischen Daumen und Zeigefinger.
»Nun«, sagte Seki Keijiro.
Der Schwiegervater entschuldigte sich und ging hinüber in den Westflügel. Es war unerquicklich, sich mit Keijiro zu unterhalten, zwei Tage vor Frostbeginn, wenn ihm die offenen Dinge seines Lebens in die Knochen fuhren.
2
Der junge Mann, der mit dem Schiffsaffen einträchtig in der Takelage der Middelburg hing und dort ein Lied sang, ein französisches, wie es schien, hatte flachsblondes Haar, blaue Augen, rosige Wangen, ein meistenteils luftiges Temperament, und es gebrach ihm an jeglicher Tauglichkeit außer der einen: Sprachen zu lernen wie ein Papagei, weshalb man ihn, statt seines Taufnamens Abel, oft Babel nannte oder auch Babbel, wenn er allzu arg schnatterte. Mynheer van Rheenen, ein Gesellschafter der Ostindien-Kompanie, hatte seinen zweitjüngsten Sohn für eine Handvoll Aktien hergegeben; falls man ihn brauchen konnte als Dolmetsch.
Er war gebürtig aus Rotterdam. Er hatte die Straße von Malakka durchquert und segelte gen Batavia. Er sprach Malaiisch und sogar Halifurisch, und niemand bedurfte seiner Künste, da doch alle Welt Portugiesisch konnte. Nur einmal hatte er bislang dolmetschen dürfen, in einem Strandbordell aus Schilf und trockenem Tang auf der Muskatinsel Run, und dort wäre man mit Handzeichen doch gewiss ebenso weit gekommen.
Er löste den Affen vom Seil und versuchte ihn auf den Bootsmann zu werfen, der unten über Deck ging. Der Affe blieb auf halbem Weg hängen. Abel sang weiter von Schäferinnen, jetzt auf Portugiesisch, und starrte in die Ferne. Sein Leben lag vor ihm wie der Ozean, unkartographiert, endlos und nicht geradehin von Sinn beseelt. Er hängte sich mit den Kniekehlen ins Seil. Die Middelburg fuhr nun im Himmel, vom Meer beschirmt, alles blau. Abel schaukelte. Wenn er nun fiele, überlegte er, ob ihn wohl einer finge?
3
Als der Monat des Frostes verstrichen war und der Monat der Eiligen Priester anbrach, fiel Schnee in Bichuu. Zu jedermanns größtem Erstaunen ließ Seki Keijiro eine Zielscheibe in seinen Vorhof tragen und schoss mit dem Kurzbogen darauf, im Sitzen, vom Haus aus, durch die offene Tür und quer über die Veranda.
Er sah dem Schnee gern zu, aber er stand nicht gern darin. Manche sagten, er stehe ohnehin nicht gern. Manche behaupteten, er habe seit der Belagerung von Osaka den Hintern nicht mehr gehoben, aus reiner Faulheit und weil er, dank seiner günstigen Verbindung mit der Tochter eines Brudersohns des ehrenfesten Itakura Shigemune, nicht musste. Sechsundzwanzig Jahre waren verstrichen, seit die goldene Burg brannte. Herr Seki war in der Tat der faulste Mensch der Welt.
Er ließ fünf Pfeile von der Sehne, dann schickte er einen Diener sie holen. Sie steckten in einem ordentlichen Kreis in der Scheibe. Er schoss einen sechsten ab, in die Mitte, knapp am Diener vorbei. Der starb fast vor Schreck. »Oh oh«, machte Keijiro.
Der halbe Haushalt lief zusammen. Es war ein seltenes Ereignis, wenn Herr Seki etwas tat, und ein großes Ereignis, wenn er etwas mit einer Waffe tat. Bevor ihn der Dämon der weltgrößten Faulheit besessen hatte, war er ein berühmter Mann gewesen, schon vor Osaka, und danach erst recht. Immer noch, wenn auch inzwischen recht selten, kamen junge Männer von weit her, mit langen Briefen und schönen Worten, die mit ihm kämpfen wollten, um ihre Kunst zu verbessern. Er ließ sie nicht über die Schwelle. Vorsorglich war beim Pförtner ein Papier hinterlegt für solche Fälle, mit einem »Nein danke« und Seki Keijiros schwungvoller Signatur. Und dazu gab es ein hübsches Stück Band. Wenn er nicht schlief oder aß oder trank – gerne reichlich – oder nachdachte oder mit seinem Enkel spielte oder seiner Frau zuhörte oder mit dem Schwiegervater plauderte, webte Keijiro Bänder auf einem kleinen Webstuhl, bunte Bänder aus Wolle oder Seide. Wenn sich die Muster einst wiederholten, sagte er, wolle er sich auf einen Berg tragen lassen und sterben. Das sei aber noch lange hin.
Der halbe Haushalt war zusammengelaufen. Sofort ließ Keijiro Bogen und Pfeile und Scheibe forträumen. Er setzte sich in die offene Tür und betrachtete den Schnee.
4
Es war brütend heiß am Heiligen Abend in Batavia, und brütend heiß auch in der Heiligen Nacht. Die Kanäle stanken zum Himmel. Wenn ein Kind hineinfiele, hieß es, löste sich sein Körper binnen Sekunden auf und schwömme dann oben wie ein Suppenauge. Ob es klug gewesen sei, in der Hitze von Batavia Brackwassergrachten anzulegen oder ob man Ostindien die niederländische Baukunst vielleicht doch besser anders nahegebracht hätte, darüber nachzugrübeln sei es ohnehin wohl zu spät, dachte Abel van Rheenen. Er wälzte sich im Hemd auf dem Dach des Speicherhauses, starrte in den Sternenhimmel und aufs Meer hinaus und sehnte sich nach Schnee.
Überall wimmelte es von Niederländern, in der großen weiten heißen Welt der Barbaren. Es wimmelte auch von Portugiesen. Spanier sah man desgleichen, und Engländer, gewiss, überall Engländer, gar nicht gut fürs Geschäft. Und die breite papistische Schleimspur, die sich hinter den Iberern herzog und partout nicht trocknen wollte, selbst wenn sie längst fort waren, ließ die Heiden ins Schlittern geraten. Sie wurden weinerlich und in Handelsdingen gierig und konfus.
Die Sache mit dem Schleim war nicht auf van Rheenens Mist gewachsen. Sie stammte vom Kapitän. Der Kapitän sagte nicht nur viel Garstiges, er wusste auch viel. Oft lief ihm Abel tagelang hinterher in der Hoffnung, dieser möge ihm etwas beibringen von all seinem Wissen. Da glomm doch ein kleiner Funke im Herzen des nutzlosen Dolmetschs. Hätte ihn doch nur einer angefacht. Aber der Kapitän schäkerte eher mit dem Affen, als dass er sich je umdrehte zu Abel van Rheenen.
Ein einziges Mal hatte er dolmetschen dürfen, als ein Sultan oder Pascha oder Bonze oder Khan oder weiß der Deibel was den Gouverneur van Diemen besuchte, und er wusste noch immer nicht, welche Sprache dieser Mann eigentlich gesprochen hatte.
Er versuchte einzuschlafen. Er wollte von Schnee träumen, er wollte träumen, dass er fünf Jahre alt wäre und ihm jemand etwas beibrächte, etwa Vater, etwa Schlittschuhlaufen, denn einem Fünfjährigen alle Unterrichtung abzuschlagen, wäre schließlich unchristlich und gemein. Doch er konnte nicht einmal ruhig liegen. Er kreiselte auf seinem Hinterteil um und um, und über ihm kreiselten die Sterne.
Abel sprang auf und hüpfte auf der Stelle und begann zu singen, den Nassauer Willem auf Halifurisch. Gestern hatte er begonnen, Japonesisch zu lernen, denn im Frühjahr würde man nach Formosa segeln und von dort mit den Monsunwinden in den japonesischen Archipel. Sein Lehrer war ein alter Portugiese mit nur einer Hand, der sich in Batavia eingenistet hatte. Er habe jahrzehntelang in Japonica gelebt, behauptete er, schiffbrüchig dort angeschwemmt und freundlich aufgenommen, nachdem man ihm im ersten Schreck, als er sich unter einer Planke plötzlich regte, die linke Hand abgeschlagen hatte. Es sei so schnell gegangen, erzählte der Portugiese, dass er es erst bemerkt hatte, als ihn der Täter darauf aufmerksam machte und er schon halb verblutet war. Dann erzählte er naturgemäß lang und breit von dem Wunder der japonesischen Klingen. Das konnte Abel nicht mehr hören. Jeder, der von Japonica kam oder von Japonica hatte reden hören, meistens das letztere, wusste zwei und immer nur zwei Fakten umständlich darzulegen: wie furchtbar scharf dort die Klingen seien und wie furchtbar hübsch die Huren.
»Es werden doch nur wieder verschleimte Papisten sein«, murmelte Abel vor sich hin. Wahrscheinlich hatte ein Haifisch dem Portugiesen die Hand abgebissen. Fort Decima hieß die niederländische Festung auf Japonica, wohl die zehnte Ostindien-Festung des ausgreifenden Königreichs, und das eingeborene Dorf dabei hieß Nangasaqui.
Die japonesische Sprache klang weich, ersterbend, devot. Er musste die Stimme heben und flach atmen, um dem Portugiesen solches nachzumaunzen. Eine Sprache wie geschaffen für Ave Marias. »Puh«, machte Abel van Rheenen. Er war plötzlich den Tränen nah. Und an die hübschen Huren glaubte er auch nicht.
5
Nach Neujahr schoss Keijiro mit dem Langbogen, und dann machte er Anstalten, sein anderes Schwert zu montieren.
Schon beim Langbogen war der halbe Haushalt zusammengelaufen, und kaum sprach sich herum, dass er vielleicht ans andere Schwert wolle, dass er vielleicht den Kasten geöffnet habe, in dem es lag, oder auch nur die Matte verschoben, worunter die Bodenplanke war, worunter der Kasten verwahrt wurde, lief der ganze Haushalt zusammen, Männer und Frauen und Kinder und Diener und irgendwelche Bauern, die aus irgendeinem Grund im Haus waren, und irgendwelche Kaufleute, mit denen irgendwelche Subalternen des Schwiegervaters irgendwelche Dinge verhandelten, alle liefen zusammen und hockten in allen Türen und belauerten Seki Keijiro, der doch nur still neben seinem Webstuhl saß und an etwas Winzigem herumschnitzte, das vielleicht ein Angelstift war, um die Klinge im Heft zu fixieren, aber vielleicht auch wirklich etwas ganz anderes.
Sie sollten im nächsten Leben allesamt Rindvieh werden, murmelte Keijiro vor sich hin, und er selbst eine Schmeißfliege. Dann hörte er auf zu schnitzen und fing an zu weben, bis endlich alle fort waren, und dann tat er mehrere Stunden lang überhaupt nichts, und dann hob er in der Tat die Matte über der Bodenplanke, und sofort waren alle wieder da.
Außer dem Schwiegervater wusste keiner, was es auf sich hatte mit dem anderen Schwert. Das machte das andere Schwert interessant. Um die Klinge zu pflegen, was er nun trotz aller Faulheit zuweilen tun musste, kroch Keijiro zur Stunde des Ochsen aus dem Bett, schlich im Finstern mit Öl und Puderkugel durchs schlafende Haus und erledigte dies heimlich; doch jetzt hätte er das Schwert in der Tat gerne montiert, und zwar in Ruhe und bei Licht.
Dann begann auch noch seine Frau »warum, warum« zu jammern, hinter der einzigen Tür, die nicht ganz aufging, und drängte sich dann durch die sehr kleine Öffnung hinein und kam langsam angerutscht, fast auf allen vieren, eine widerwärtige Angewohnheit von Frau Seki, die immer zum Vorschein kam, wenn sie streiten und dabei doch möglichst gut erzogen wirken wollte.
Seki Keijiro musste die Pförtnerfamilie aus dem Pförtnerhaus scheuchen und mit drei Wachen und seinem Kasten dorthin laufen, Drohreden ausstoßen, die Wachen aufstellen und die dichten Fenster einhängen, nur um in Frieden das andere Schwert montieren zu können; sehr viel zwecklose Geschäftigkeit.
Er brauchte drei Tage, um das Schwert zu montieren. Das war nicht normal. Die Wachen sagten, er habe das Schwert, als es denn montiert war, angeschaut, und sonst nichts. Drei Tage lang ein Schwert anzuschauen, war auch nicht normal. Herr Seki bekümmerte sich sonst nicht um Schwerter. Wenn er doch einmal ausging, etwa einmal im Jahr, und wohl oder übel eines führen musste, stopfte er es so schlampig zum Kurzschwert in den Gürtel, dass die jungen Männer das gar nicht mit ansehen konnten. Und jetzt schaute er allen Ernstes drei Tage lang eines an, und sonst nichts, und kam nicht einmal zum Essen? Kein Wunder, dass Frau Seki so miserabler Laune war.
»Das ist eine alte Liebesgeschichte«, sagte der Schwiegervater, als man ihn allzu sehr bedrängte, »und, findet er, eine offene Sache.«
6
»Habe ich euch eigentlich den Meteoriten gezeigt«, fragte Abel van Rheenen den Kapitän, als sie bei Fort Zeelandia vor Anker gingen, »der in der Straße von Malakka vom Himmel fiel und eine Delle ins Achterdeck schlug und einen Brandfleck machte?«
Der Kapitän gab keine Antwort.
»Um die lautere Wahrheit zu sprechen, ich verrichtete meine Notdurft, und dabei erschlug er mich fast!« Van Rheenen zog einen runden schwarzen Stein aus der Rocktasche. Doch der Kapitän war längst woanders.
»Ich sah eine Flamme, einen Schweif«, verkündete Abel und sprang hinüber zum Steuermannsmaat, »und dann zischte es, eine Handbreit von meinem Gemächt …«
Der Steuermannsmaat stöhnte und lief dem Kapitän hinterher.
»Es bringt Glück! Aber ich werde den Meteoriten einer naturkundlichen Sammlung schenken«, rief Abel dem Segelmeister zu. »Apropos Glück, habe ich euch einmal erzählt, wie ich zur Welt kam? Ich hatte eine vollends unversehrte Glückshaube auf dem Kopf, und jede Wehe der Mutter pumpte mehr Luft hinein, und als ich endlich geboren war, steckte ich in einem Ballon, der doppelt so groß war wie …«
Und der Segelmeister lief zum Besansegel.
Da gab es Abel wieder einmal auf. Immer versuchte er es, immer gab er es auf. Vermutlich hätten Hörner auf seiner Stirn sprießen oder er hätte auf Engelsflügeln den Mastkorb umschwirren oder auch die Silberinseln entdecken können, niemand hätte sich dafür interessiert. Er seufzte ein wenig und sang ein wenig, schon recht kunstreich, auf Japonesisch, und dann suchte und fand er seinen Portugiesen, den er kurzerhand aus Batavia mitgenommen hatte, und schob noch eine kurze Sprachlektion ein, bis man endlich an Land ging.
Das Japonesische war nicht schwer. Es hatte wenige Wörter und noch weniger Grammatik. Sehr viele Dinge und Sachverhalte, sagte der Portugiese, seien in Japonica von alters her unbenannt geblieben, und man mied sie als Gesprächsthemen entweder ganz oder schrieb sie schweigend in sinesischen Zeichen auf Täfelchen, die man einander dann umständlich zuschob. Abel wusste nicht recht, ob er das glauben sollte. Auch dass sich das Wörtlein »ich« auf siebzehn Weisen übersetzen lasse, von denen allerdings jede einzelne als Benimmfehler gelte, weshalb man stattdessen stumm auf seine Brust tippen müsse, wenn man denn unbedingt »ich« sagen wolle, überzeugte ihn nicht ganz. Dafür repetierte er, mit ersterbender Stimme im japonesischen Klageton, alle Körperteile und alle Farben und viele Tiere und alle Zahlen und den Beginn des Markusevangeliums und diverse Grüße und Bittworte und Dankworte und stückelte dann auch allerlei Silben an allerlei Verben an, bis sie von Vergangenheit und Zukunft sprachen und von Vielleicht und Wenn-dann und Gewissnicht. Der Portugiese lobte ihn, und Abel schenkte ihm seinen Meteoriten.
Die Zeit auf Formosa verging wie im Flug. Abel van Rheenen fand ein Mädchen, sein bestes Mädchen seit Rotterdam. Sie hatte ein Streifenmuster in die Wangen gebrannt, sprach Spanisch und trug Blumen im Haar. Zum Abschied wollte sie Kaffee und einen Kuss. Und dass er sie ansah und stillhielt dabei, volle zehn Atemzüge lang.
7
Zwei Tage nach dem Blumenfest rief Seki Keijiro den gesamten Haushalt zusammen, um kundzutun, dass er den Haarschneider bestellt hatte. »Ich habe ohnehin wenig Freude an ihm«, sagte er säuerlich, »und ich möchte mich nicht zu allem Überfluss auch noch im Pförtnerhaus einrammeln müssen, um mir die Haare machen zu lassen, und deshalb spreche ich eine förmliche Warnung aus, damit ihr euch rechtzeitig Beschäftigungen suchen könnt, die euch von diesem großen Ereignis ablenken, und ich gestatte mir ebenfalls die Warnung, dass ich schlechte Laune bekommen werde, wenn ihr wieder wie die Karpfen hinter allen Türen hervorgafft.«
Die Mitteilung wurde nicht gut aufgenommen, besonders nicht von Frau Seki. Bis der Haarschneider endlich kam, lag sie, unterstützt von einer Tochter und einer Dienerin, ständig ihrem Vater in den Ohren, Keijiro werde sich den Kopf scheren lassen und ins Kloster gehen und sie müsse mit und dort Gerstenbrei essen und beten und sterben. Es endete damit, dass Seki Keijiro und sein Schwiegervater sich anderthalb Tage lang zusammen im Pförtnerhaus versteckten und einander mürrisch anschwiegen.
Seit gut zwanzig Jahren hatte Keijiro keinen Haarschneider empfangen, da er dies, wie so vieles, nicht nötig hatte. Er trug seine Haare, wie Haare nun einmal wuchsen, und wenn alles ins Gesicht hing, drehte er einen neuen Knoten, und wenn sie zu lang wurden, schnitt er sie ab. Er sah aus wie ein Räuber. Und jung, sagten die Mägde. So gut erhalten, der edle Herr Seki, wie eingelegter Rettich. Kaum grau auf dem Kopf, mit siebenundfünfzig Jahren, und steht da wie ein Birkenbaum, obwohl er immer nur sitzt.
Herr Seki ließ den Haarschnitt wort-, klag- und reglos über sich ergehen. Dabei zog er ein Gesicht wie einer, der unter der Folter schweigt, bis ihm das Gedärm bei den Knien hängt, erzählte nachher der Haarschneider. Aber dann wurde es fürwahr eine Plage. Herr Seki bekam einen Rasurbrand und über dem Rasurbrand einen Ausschlag vom dicken Haaröl und an den Ohren einen Ausschlag vom dünnen Haaröl und im Nacken einen grundlosen Ausschlag, und dann schälte und schuppte sich alles. Er legte sich ein nasses Handtuch auf den Kopf, setzte darauf einen Binsenhut und machte Reisleim. Damit klebte er Holzspäne in die Scheide des anderen Schwerts, auf dass die Klinge fest sitze. Niemand kam gelaufen. Herr Seki hatte eine solch üble Laune, dass man das bis zum Westflügel spürte. Man mied ihn vorsichtshalber eine ganze Woche lang. Frau Seki ging freiwillig in ein Kloster und aß dort Gerstenbrei und betete, wenn auch wohl nur vorübergehend.
»Und warum?«, fragte der Schwiegervater.
»Posten«, sagte Seki Keijiro.
»Was?«
»Nagasaki.«
»Gönnst du mir einen ganzen Satz, Keijiro?«
Herr Seki räusperte sich. Einen Moment lang wünschte der Schwiegervater, er hätte nichts gefragt. Einen Moment lang wünschte er, er wäre im Westflügel geblieben oder hätte seine Tochter ins Kloster begleitet.
»Ich trete einen Posten in Nagasaki an«, sagte Herr Seki leise und warf einen unklaren Blick durch das Binsengitter vor seinen Augen, »beim dortigen Statthalter, der lieber in Yedo Speichel leckt, als in Nagasaki sein Amt zu versehen, weshalb ich für ihn die Barbaren verwalte, die fremden Kaufleute in ihrer Umzäunung.«
Da war der Schwiegervater recht sprachlos.
»Es geht mir um die Orandesen«, sagte Keijiro. Dieses Wort kaute er langsam.
»Orandesen«, echote der Schwiegervater, zu verdutzt, um verschüttetes Wissen auszugraben; auf den Kopf zu gefragt, hätte er wohl nicht beantworten können, worum es sich hierbei handelte.
»Und wie ging das zu?« Der Schwiegervater hörte aus seiner Stimme einen lamentierenden Ton heraus, der ihn an seine Tochter erinnerte. Er räusperte sich nun seinerseits.
»Ein Brief hin«, sagte Keijiro, »ein Brief zurück.«
»Und warum …«
»Ich verfolge Nachrichten über Oranda seit einundvierzig Jahren.« Wieder warf er einen Blick durch die Binsen, unlesbar, nicht angenehm. »Seit man letzthin für die Christen die Grenzen geschlossen hat …« Er stockte. »Seit die Christen vertrieben sind …«, begann er erneut und brach ab. »Die Orandesen sind seit der Abreise der Christen die einzigen Fremden, die dem da …« – er zeigte mit dem Daumen nach Osten – »… genehm sind, und deshalb …«
»Du sollst den Oberkommandanten nicht ›den da‹ nennen und nicht in seine Richtung zeigen, als wäre das ein Baum oder ein Pferd oder was weiß ich«, rügte ihn der Schwiegervater.
Keijiro stöhnte. »Seit unser aller edler Herr Oberkommandant in Yedo, der kleine Iemitsu …«
»Du sollst ihn nicht ›den kleinen Iemitsu‹ nennen, Blitz und Kugelblitz!«, rief der Schwiegervater.
»Ich kannte ihn, als er klein war. Jetzt kenne ich ihn nicht mehr, erfreulicherweise.«
Der Schwiegervater blieb jetzt stumm. Er wollte nicht versehentlich eine dieser Geschichten über den kleinen Iemitsu hervorlocken. Als er ein berühmter Mann gewesen war, hatte Herr Seki die Söhne des damaligen Oberkommandanten unterrichten dürfen, vor allem jenen, der nun selbst Oberkommandant war. Manchmal, wenn er getrunken hatte, erzählte Herr Seki recht breit davon, und jedesmal musste der Schwiegervater lachen und bangte dann tagelang um seinen Kopf.
»Seit der großmächtige Herr Tokugawa Iemitsu es für gut befand, die Christen abzuschaffen«, sagte Keijiro endlich, »sind die Orandesen allein. Das passt mir. Ich habe einundvierzig Jahre darauf gewartet, dass man sie mir zu einem handlichen Bündel schnürt. Jetzt tat man mir die Gnade.« Er verschob die Unterlippe zu einer Art Lächeln. Der Schwiegervater war nun so verwirrt, dass er sich überhaupt keinen Reim mehr auf Orandesen machen konnte und auch keinen Reim auf seinen Schwiegersohn.
Sie saßen viele Minuten schweigend da.
»Wenn du einen Posten beim Statthalter hast, solltest du dort vielleicht auch nicht verkünden, dass der Statthalter in Yedo Speichel leckt«, murmelte der Schwiegervater.
»Ah«, sagte Keijiro.
Das Haus war still. Vielleicht waren sie inzwischen allesamt ins Kloster verschwunden. Der Schwiegervater linste durch Keijiros Hut. Er dachte, welch furchtbarer Mann das gewesen sei, welch furchtbarer Mann das vielleicht immer noch war, der furchtbare Seki Keijiro, wie er hockte und webte und trank und lauerte, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, und nicht vernünftig älter wurde, mit seiner ewigen furchtbaren offenen …
»Ist es der Statthalter? Die Sippe des Statthalters?«, flüsterte der Schwiegervater. Er warf einen Blick auf das andere Schwert, das blank dalag, während der Reisleim trocknete.
»Nein«, sagte Keijiro, »die Orandesen. Du hörst mir nicht zu.«
Dem Schwiegervater fiel dazu noch immer nichts ein.
»Ich habe eine offene Angelegenheit«, sagte Keijiro, »sie betrifft Orandesisches, und ich weiß auch nicht viel besser als du, was das eigentlich ist, und jetzt ist es soweit, und erzähl es bitte nicht meiner Frau.«
Dann nahm er den Hut ab und das Handtuch vom Kopf und kratzte ausgiebig seinen geschälten, geschuppten, für einen anständigen Posten anständig frisierten Kopf, und dann begann er zu lachen, und er lachte lange, völlig vergnügt, oder zumindest fast.
Zwei Tage später brach er mit kleinem Gefolge auf. Der Schwiegervater ritt ein Stück mit ihm. Auf dem Rückweg würde er seine Tochter im Kloster abholen. Seki Keijiro hatte den Webstuhl dabei, in praktische Teile zerlegt, und er trug noch immer den Binsenhut, und das andere Schwert, in einer schönen roten Tasche, trug er über dem Rücken.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.