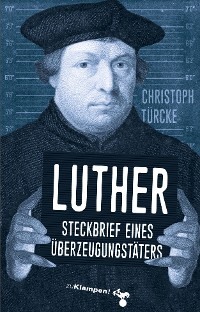Kitabı oku: «Luther – Steckbrief eines Überzeugungstäters», sayfa 2
Bleibt am Ende als Luthers Alleinstellungsmerkmal lediglich seine Lehre von der Rechtfertigung des Sünders durch Gottes Gnade übrig? Nur, mit Verlaub, was ist daran genuiner Luther? Das Entscheidende steht doch schon beim Apostel Paulus. Die Menschen »sind allzumal Sünder […] und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist«.13 Hatte der Katholizismus das vergessen? Keineswegs. Allen Kirchenvätern und Scholastikern ist der Gnadengedanke unverzichtbar. Augustin hat ihm gar eine ganze Serie von Schriften gewidmet und ein scharfes Bewußtsein für das Vertrackte daran entwickelt. Wenn Gnade einzig durch Gottes ebenso vorausschauenden wie unerforschlichen Ratschluß zuteil wird, kann niemand sie sich selbst beschaffen; andrerseits kann niemand an ihrem Empfang ganz unbeteiligt sein. Und diese Beteiligung, diese Empfänglichkeit ist das Problem. In welchem Maße ist sie passiv, in welchem aktiv? Wie weit reicht sie? In welchem Grad gewinnt sie den Status einer Mitwirkung? Diese Fragen trieben schon Paulus um. Er konnte den Gnadenbegriff gar nicht verwenden, ohne ihn sogleich gegen das Mißverständnis zu schützen, der mit Gnade Beschenkte müsse sich nicht mehr bemühen. Mit der Gnade steht, ob man will oder nicht, zugleich ihr Verhältnis zur menschlichen Natur, zum freien Willen, zu den Tugenden und guten Werken zur Debatte, und die Scholastiker haben dies Verhältnis nach allen Regeln der Kunst auszubalancieren versucht. Stets ist Paulus einer ihrer Kronzeugen gewesen.
Es kann keine Rede davon sein, daß die biblischen Schriften im Mittelalter verschüttet waren und erst Luther sie wieder ausgegraben hat. Als er seine ersten Vorlesungen über die Psalmen und den Galaterbrief hielt, bewegte er sich durchaus im Rahmen des theologischen Curriculums. Er entdeckte nicht etwa den Gnadenbegriff wieder, sondern gab ihm lediglich einen eigenen Akzent und neuen Nachdruck. Deshalb fiel es den damaligen päpstlichen Theologen so schwer, zu verstehen, warum ihnen der Poltergeist aus Wittenberg so vehement die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade entgegenhielt. Die bestritten sie doch gar nicht. Und deshalb fiel es der Kurie von 1999 relativ leicht, mit den Lutheranern eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre herauszugeben. Das war doch ihre eigene Lehre. Nur löste sie nicht automatisch das Mitwirkungsproblem. Dem stellte sich der Katholizismus besonnener als Luther, der überall, wo menschliche Beteiligung an Gnade und Rettung auch nur erwogen wurde, bereits die diabolische Versuchung der Selbstgerechtigkeit witterte.
Allein durch Gnade; allein die Schrift; das Abendmahl in beiderlei Gestalt; das Priestertum aller Gläubigen; der Appell an die weltliche Macht, die Ordnung der geistlichen wiederherzustellen: das sind die fünf Wahrzeichen der Lutherschen Reformation. Doch Luther hat keines davon erfunden. Sie waren allesamt schon vorher da. Ihn selbst störte das nicht. Er verstand sich nicht als Erfinder. Patentamt und Urheberrecht waren keine Kategorien seiner Epoche. Um so größer ist das Ärgernis für Lutheraner. Der reformatorische Durchbruch soll nicht die originäre Tat eines religiösen Genies, sondern mit lauter fremden Federn geschmückt gewesen sein? Wie wehrt man sich dagegen? Ganz einfach. Jene kühnen Geister, die längst Einsichten hatten, zu denen dann auch Luther kam, erklärt man zu seinen Vorläufern. Sie sollen für ihn etwas ähnliches gewesen sein wie Johannes der Täufer für Jesus: Wegbereiter. So hatte schon das Markusevangelium die Dinge gedreht. Jener Bußprediger und Täufer, dessen Jünger der historische Jesus gewesen war und von dem er sich, wie alle andern, »zur Vergebung der Sünden« in den Jordan hatte tauchen lassen, wird zu Jesu Herold umgedeutet, der nichts im Sinne hatte als ihn anzukündigen und auf ihn vorzubereiten. »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige richtig.«14
Ähnlich nimmt die lutheranische Weltsicht die gegen den mittelalterlichen Klerus gerichteten Armutsbewegungen, die radikalen Vertreter der deutschen Mystik und die Reformatoren Englands und Böhmens wahr: als Herolde, die den Weg Luthers bereitet haben. So kühn und bahnbrechend sie sich auch geäußert haben mögen – sie haben lediglich anklingen lassen, was erst ihm auszuführen vorbehalten war. Wie aber, wenn es gerade umgekehrt wäre: daß sie die eigentlichen Bahnbrecher waren und dafür in vielen Fällen mit Verfolgung und Tod bezahlten, während Luther nur als ein später Nachfahre und Nutznießer ihres Martyriums, sozusagen als »ungebratener Lorenz«15, das ungeheure Glück hatte, bereits geebnete Wege gehen zu dürfen, Gedanken, an die sich die Zeitgenossen in einem gewissen Maße gewöhnt hatten, lediglich mit neuem Nachdruck formulieren zu können, und eine überaus günstige historische Konstellation vorzufinden, in der sie schließlich zündeten? Wyclif und Hus als die authentischen Reformatoren, Luther als ihr Megaphon? Undenkbar fürs Luthertum. Es kann Reformation gar nicht anders als in den Koordinaten der Wegbereiter-Theorie wahrnehmen. Ja, diese Theorie ist weit über das konfessionelle Luthertum hinaus wirksam geworden. Das Mittelalter, die Neuzeit, die Reformation als Scheide zwischen beiden und Luther als der Reformator: ohne dieses Begriffskonstrukt kann man sich im Geschichtsepochendiskurs überhaupt nicht mehr verständlich machen. Die Umbrüche im Jahrhundert vor Luther sind damit automatisch als vorreformatorisch definiert. Sie werden von einer Grundeinstellung aus wahrgenommen, die Walter Benjamin als »Einfühlung in den Sieger«16 bezeichnet hat. Die »eigentliche« Reformation ist erst die, die sich durchgesetzt hat. The winner takes it all.
Der Teufel
Geistige Originalität war Anfang des 16. Jahrhunderts ein ebenso unbekanntes Wort wie Mittelalter oder Renaissance. Luther wollte nicht originell sein, als er an seiner Psalmen- oder Galaterbriefauslegung laborierte. Er wollte seine Seelennot loswerden. Der streng, mit harter Hand erzogene Erstgeborene eines aus bäuerlichen Verhältnissen aufgestiegenen Bergbauunternehmers sollte Jurist werden und den väterlichen Betrieb durch eine einträgliche Verwaltungslaufbahn absichern helfen. Einerseits belehnten die Eltern ihren begabten Sohn mit hohen Erwartungen. Andrerseits ließen sie ihn eine tiefe Nichtigkeit verspüren; sollte sein Leben doch lediglich den väterlichen Plänen gehorchen. Dieses Wechselbad hielt der Sohn Martin schlecht aus. Und als er das Studium der »freien Künste«, das damals Voraussetzung für den Zutritt zur medizinischen, juristischen oder theologischen Fakultät war, glanzvoll absolviert hatte und Magister artium der Universität Erfurt geworden war, da entzog er sich der väterlichen Autorität und ging, statt zur juristischen Fakultät, ins Erfurter Augustinerkloster. Zuvor war er in ein furchtbares Gewitter geraten und hatte, wie er später selbst berichtete, in Todesangst »Heilige Anna hilf, ich will ein Mönch werden« ausgerufen. Aber mußte er diese spontane Gefühlsaufwallung nachträglich als eisern zu befolgendes Gelübde verstehen? Das tat er, weil es ihm den höheren Rückhalt verschaffte, um sich dem Vater zu widersetzen. Das Gelübde erschien ihm als Ausweg, in einem ganz wörtlichen Sinne als emancipatio: als Herausführung aus der väterlichen Gewalt. Die Eltern fühlten sich betrogen. Mönch statt Jurist? Dafür hatten sie sich nicht krumm gelegt. Ihre Vorwürfe nagten ihn zuinnerst an. Er suchte sie loszuwerden, indem er an die Stelle der unterlassenen juristischen Studien um so heftigere asketische Übungen setzte: exzessives Beten, Fasten und Wachen. Doch die Selbstquälerei nahm ihm sein Schuldgefühl nicht; sie vertiefte es vielmehr zum Gefühl eines generellen Verworfenseins. Im Beichtstuhl verhielt er sich wie ein überpedantischer Jurist und ging seinem Beichtvater mit der Aufzählung von lauter kleinen Verfehlungen und Unzulänglichkeiten auf die Nerven, die dieser als »Puppensünden« abtat.
Eines Tages lauschten die Mönche während der Messe im Chor der Lesung: einer der Geschichten, in denen Jesus einem Kind einen Dämon austreibt. Nach der einen Quelle17 ist es die Geschichte von der Mutter, die den Meister bittet, ihr Töchterlein von einem »unsauberen Geist« zu befreien (Markus 7); nach der andern18 die Geschichte vom Vater, der einen mondsüchtigen Jungen zu Jesus bringt (Matthäus 15); nach der dritten19 die Geschichte von der Austreibung eines taubstummen Dämons ohne Angabe der Bibelstelle. Offenbar hat der Originalzeuge, auf den sich alle drei Quellen beziehen,20 nicht gesagt, welche der zahlreichen Austreibungsgeschichten damals vorgelesen wurde, und so ist jedem Berichterstatter eine andere dazu eingefallen. Wenn man bedenkt, wie es im Erfurter Chor weitergegangen ist, drängt sich am ehesten eine vierte Bibelepisode auf, in der ein Vater seinen Sohn, der einen »sprachlosen Geist« hat, zu Jesus bringt und ihn beschwört, diesen Geist auszutreiben. »Und alsbald, da ihn [sc. Jesus] der Geist sah, riß er ihn [den Jungen]; und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte.« Jesus befiehlt dem »sprachlosen und tauben Geist«, auszufahren. »Da schrie er und riß ihn [sc. den Jungen] sehr und fuhr aus. Und er ward, als wäre er tot«. »Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf«.21
Es spricht sehr viel dafür, daß es diese Geschichte war, die im Erfurter Chor vorgelesen wurde.22 Denn während (oder am Ende?) der Lesung hat sich etwas Bemerkenswertes zugetragen, worin alle drei Berichte übereinstimmen. Luther hat sich plötzlich zu Boden geworfen, sich gewälzt und gebrüllt, und zwei der Berichterstatter sagen auch, was er gebrüllt hat: »Ich bins nicht« (non sum). Offensichtlich hat ihn die Geschichte in diesem Moment so getroffen, als erzählte sie von ihm. Jäh fühlt er sich als der von einem taubstummen Dämon besessene Sohn, der von seinem verzweifelten Vater zu Jesus gebracht wird, aber Jesu Gegenwart nicht aushält. Der Dämon »reißt« ihn, so daß er sich schäumend und schreiend auf dem Boden wälzt. Luther benimmt sich wie dieser Sohn. Er regrediert zu einem sich wälzenden und schreienden Kind, aber er leugnet zugleich, das besessene Kind zu sein, zu dem er sich macht: »Ich bins nicht.« Er begeht einen performativen Widerspruch: verneint ein Besessensein, das er gerade aufführt. Psychologisch gesprochen: Er »agiert« seine Situation. Und dazu gehört: Er will zwar von dem Zustand, den er vorführt, errettet werden, aber er will keine Rettung, die sein Vater einfädelt. Er will von den Vorwürfen des Vaters loskommen, aber nicht zu dessen Konditionen. Nur ein Ausweg, den er selbst findet, kann ihm genügen, und solange er keinen weiß, bleibt er in seinem depressiven Zustand befangen.
Von den drei Kolporteuren dieser Begebenheit waren zwei (Johannes Cochläus und Hieronymus Dungersheim) erklärte Luther-Gegner. Der dritte (Johann Oldecop) gibt sich als neutraler Chronist. Natürlich ist der »Anfall im Chor« für Luther nicht schmeichelhaft. Bequem ließ er sich von böswilligen Gegnern als Zeichen dafür lesen, daß Luther früh schon von jenem Dämon besessen gewesen sei, der ihn später zum Abfall vom wahren katholischen Glauben verleitete. Aber für die Gegenthese aufgeregter Lutheraner, diese Episode sei lediglich eine verleumderische Erfindung, spricht nichts. Dafür schildert sie Luther viel zu hilfsbedürftig und viel zu wenig boshaft. Als anfallartiger Offenbarungseid in einer ausweglosen Lebenssituation hat sie hingegen eine verblüffende Plausibilität. So etwas erfindet man nicht einfach. Auch daß es deutsche Worte waren, die Luther hervorstieß, ist sehr glaubwürdig. Er bricht aus dem liturgischen Rahmen der Messe aus und regrediert zur Sprache seiner Kindheit. In Cochläus’ lateinischer Version wird aus »Ich bins nicht« zwar notgedrungen »non sum«, aber das heißt ja bloß »ich bin nicht« und verschluckt das an dieser Stelle im Deutschen so signifikante »s«: das neuralgische Kürzel für ›dieser Sohn‹.
Kurzum, es spricht alles dafür, daß das gebrüllte »Ich bins nicht« Lutherscher Originalton ist und der »Anfall im Chor« tatsächlich stattgefunden hat. Er darf psychologisch durchaus als hysterische Regression verstanden werden. Erlebt hat Luther ihn freilich anders: als Zugriff einer höheren dämonischen Macht. Von ihr fühlte er sich in diesem Moment direkt angefaßt, und das Gefühl ihrer bedrohlichen Nähe hat ihn sein Lebtag, selbst in der euphorischen Phase des reformatorischen »Durchbruchs«, nie wieder ganz verlassen. Selbstverständlich hielt er diese Macht für objektive Realität. Von klein auf war ihm das weisgemacht worden – wie allen seinen Zeitgenossen. Nicht alle fühlten sich gleichermaßen von dieser Macht bedroht; aber der Glaube an sie war innerhalb des damaligen Weltbildes unausweichlich. Wenn die Existenz Gottes als Inbegriff des Guten nicht in Frage stand und die Existenz des Bösen in der Welt unabweisbar war, dann mußte es auch einen Inbegriff des Bösen geben. Erst im 20. Jahrhundert haben laue Theologen den »Abschied vom Teufel« vorgeschlagen, damit er die Gläubigen nicht unnötig ängstigt und die Kirchenmitgliederzahlen nicht weiter schrumpfen läßt. »Wenn wir die Begriffe ›das Böse‹, ›die Macht des Bösen‹ gebrauchen, dann haben wir es mit einer unbestimmten, nur gedachten Größe zu tun, und es muß uns dabei klar sein, daß es ›das Böse‹ in sich nicht gibt«,23 während die Macht des Guten weiterhin hübsch für bare Münze genommen werden soll: als der real existierende, in Jesus Christus geoffenbarte Gott. Solch pseudoaufklärerisches Messen mit zweierlei Maß war der frühchristlichen und mittelalterlichen Theologie noch fremd. Ihre Teufelslehre war zunächst keineswegs »finster«, vielmehr der seriöse Versuch, das Gewicht des Bösen in der Welt zu monotheistischen Konditionen maximal verständlich zu machen. Man vergißt heute gern, was für eine große geistige Neuerung der Monotheismus war, als er im sechsten vorchristlichen Jahrhundert entstand. Ihm erst ist es gelungen, die Welt als eine zu denken: als einen konsistenten Naturzusammenhang, den ein unfaßbar weiser Schöpfer aus sich entlassen und sinnhaft gefügt haben soll.
Damit stellte sich freilich ein Problem, das den Polytheismus noch kaum gekümmert hatte: Woher kommt eigentlich das Böse? Unter monotheistischen Voraussetzungen hat es keinen Grund – und entsteht doch. Es ist eine grund- und haltlose Abweichung vom schlechterdings Guten – von Gott. So hat es sich schon die biblische Geschichte vom Sündenfall zurechtgelegt. Sie weiß nicht zu sagen, woher die Verlockung kommt, die Adam und Eva böse werden ließ und zu ihrer Vertreibung aus dem Garten Eden führte. Doch seither ist nichts mehr, wie es war. Der Sündenfall der ersten Menschen hat die gesamte Natur in Mitleidenschaft gezogen. Die Nachfahren von Adam und Eva kommen in einer Umgebung von Entbehrung und Gewalt zur Welt, in der ihr Wille sich vorab auf einer schiefen Ebene befindet und gegen seine Neigung zur Eigensucht nicht aufkommt. Daß der Sündenfall des ersten Menschenpaars die gesamte Menschheit konstitutionell unfähig gemacht hat, nicht zu sündigen: das ist der Kerngedanke der Erbsündenlehre. Einerseits ist sie skandalös. Sie rechnet jedem Individuum als persönliche Schuld zu, was doch aufs Konto einer psychosomatischen Erbkrankheit der Spezies Mensch geht. Andrerseits trägt sie dem Faktum Rechnung, daß böse Seelenregungen immer schon im Kraftfeld von umfassenden Natur- und Sozialgewalten stehen. Tatsächlich kommt das Böse nicht nur aus einzelnen Seelen. Es hat die Dimension einer überindividuellen, sogartig wirkenden Macht, wie Augustin, der bedeutendste unter den Kirchenvätern, immer wieder betonte. Er trug wesentlich dazu bei, daß die Erbsünde im fünften Jahrhundert zu einem festen kirchlichen Lehrstück wurde. Damit gewann auch das Böse einen geradezu systemischen Status. Und wo der Weltschöpfer als personifizierte Macht des Guten galt, war es nur folgerichtig, auch die Macht des Bösen zu personifizieren: als Teufel.
Ein Gutes hatte der Teufel. Zu monotheistischen Konditionen war er, wie alles in der Welt, lediglich ein Geschöpf Gottes. Wenn dem aber so war, dann mußte dem Sündenfall der Menschen ein »Prolog im Himmel« vorausgegangen sein: ein Engelfall. Engel sind als körperlose, unvergängliche, reine Intellekte gedacht, die »ihre Erkenntnis Gottes nicht durch tönende Worte, sondern durch die Gegenwart der unwandelbaren Wahrheit selbst« erlangen, also nicht wie die Menschen der Wahrnehmung durch fünf Sinne bedürfen, sondern alles unmittelbar im Lichte der göttlichen Wahrheit erfassen und »mit der Ewigkeit des Beharrens auch die Leichtigkeit des Erkennens und die Seligkeit der Ruhe«24 besitzen. Nur daß einige von ihnen es in der reinen Schau der göttlichen Wahrheit nicht aushielten, sich aus unerfindlicher Widerborstigkeit von ihr abkehrten und ihren Willen dem göttlichen entgegensetzten. Die gefallenen Engel – und nichts anderes sind die Dämonen – treiben sich seither »im niederen Lufthimmel« herum. Sie können einen Luftkörper annehmen, der sie zu unerhört feiner Wahrnehmung und schneller Bewegung befähigt. So stehen ihnen viele übernatürlich erscheinende Mittel zu Gebote, um den Menschen zu schaden. Sie vermögen Künftiges vorherzusagen, Krankheiten, Unwetter und Mißernten zu erzeugen. Dank ihrer Luftigkeit wissen sie sich sogar in die menschlichen Sinne, Phantasien und Träume einzuschleichen und darin die kuriosesten Wahrnehmungsbilder hervorzurufen, als wären es Bilder wirklicher Ereignisse. Dennoch besteht Augustin darauf, daß Dämonen unfähig sind, Wunder zu tun. Ihr Gaukelwerk mag zwar Menschen in Verwunderung versetzen, aber es unterliegt den Gesetzen, die Gott seiner Schöpfung gegeben hat. Es will Gott zwar die Menschen abspenstig machen, trägt dabei aber zur Bewährung der Gläubigen bei. Nur bewährter Glaube ist echter Glaube. Er bedarf der Versuchung. Ohne sich an ihrer sinnlichen Umgebung zu erproben und zu entfalten, könnten die Menschen gar nicht lernen, sich auf Gott hin zusammenzunehmen. Daran wirken die Dämonen wider Willen mit. Indem sie gegen Gott Sturm laufen, tanzen sie nach seiner Pfeife. Ausgerechnet durch ihr widerspenstiges Tun gelangt die Schönheit und Harmonie des Weltganzen zur Vollendung. »Gott würde ja keinen Menschen geschaffen haben und erst recht keinen Engel, dessen künftige Schlechtigkeit er vorausgesehen hätte, wüßte er nicht ebenso, wie er sich ihrer zum Nutzen der Guten bedienen und so das geordnete Weltganze wie ein herrliches Gedicht gewissermaßen mit allerlei Antithesen ausschmücken würde.«
Augustins Dämonenlehre hat versucht, die strukturelle Gewalt des Bösen und ihr Verführungs- und Verblendungspotential im Lichte des Monotheismus zu ergründen und zu begrenzen. Sie war kein Vorstoß finsteren Aberglaubens, sondern darauf aus, diesen so weit, wie es das monotheistische Paradigma irgend zuließ, zu verscheuchen. Um so bemerkenswerter die Wiederkehr des Verscheuchten im Laufe des christlichen Mittelalters. Als im 11. Jahrhundert der große Kirchenbau begann, als sich um ihn herum ein reger Handel und Münzumlauf entfaltete und der Prunk der kirchlichen Würdenträger zunahm, da wurde auch ein Generalverdacht gegen die Kirche als Institution rege. Verwickelte sie sich nicht zusehends selbst in jenes weltliche Treiben, gegen dessen Gefahren sie durch Erteilung der Sakramente gerade schützen sollte?
Man kann die große Kirchenpolitik des Mittelalters durchaus als einen Dauerversuch erachten, diesen Verdacht zu unterdrücken – und diejenigen zu dämonisieren, die ihn explizit oder implizit vorbrachten. Leicht ließ sich das mit den Katharern machen, einer Glaubensgemeinschaft, die sich im 12. Jahrhundert in Südfrankreich ausbreitete. Ihr ging das Streben des Klerus nach immer mehr weltlicher Macht derart gegen den Strich, daß sie den Empfang der Sakramente aus dessen Hand verweigerte. Mit solchen Gaben wollte sie sich nicht beschmutzen. Ihre Mitglieder nannten sich katharoí: die Reinen. Der Schöpfergott erschien ihnen als Urheber alles Unreinen, als ein böses Prinzip, aus dem die gesamte materielle Welt einschließlich der irdischen Kirche hervorgegangen war. Christus erachteten sie hingegen als den Abgesandten eines rein geistigen Prinzips, der sich nie wirklich inkarniert hatte und auch nur gekommen war, die Seelen aus dem Schmutz der Materie in die höhere Welt des Geistes zu ziehen. Das war unvereinbar mit der Kirchenlehre. Gegen die Katharer wurde ein Kreuzfahrerheer mobilisiert. Es wütete in Südfrankreich von 1209 bis 1229. Danach existierten nur noch versprengte und gehetzte Reste der Katharer. Indessen wurde aus dem Namen katharoí im Deutschen das Schimpfwort »Ketzer«.
Kreuzzüge waren zunächst nach außen gerichtet gewesen: auf die Befreiung Jerusalems von den Moslems. Der Krieg gegen die Katharer war der erste Kreuzzug nach innen. Aber war mit ihrer Zerschlagung auch ihr widerspenstiger Geist ausgerottet? Das glaubte die Kurie nicht. Sie setzte nach. Im Jahre 1233 sandte Papst Gregor IX. durch eine Bulle »Predigermönche [= Dominikaner] gegen die Ketzer Frankreichs und der benachbarten Provinzen« und ermächtigte sie, den ortsansässigen Klerikern, sollten sie lässig gegen Ketzerei sein, »ihre Pfründen für immer zu nehmen und gegen sie und alle anderen ohne Berufung vorzugehen«.25 Das war der Beginn der Inquisition: die Fortsetzung des Kreuzzugs nach innen mit andern Mitteln. Von ferne sah sie vielleicht bloß wie eine etwas gründlichere Art der Gemeindeinspektion aus. Faktisch lief sie auf eine dezentrale, flächendeckende Kontrolle christlicher Lebensführung hinaus, die alle Widerchristlichkeit schon im Keim erkennen sollte, damit so etwas wie die Katharersekte sich auch nicht ansatzweise mehr bilden konnte. So unschön hat einst die qualitative empirische Sozialforschung angefangen. Inquisitio heißt ja Befragung, Erkundung, Erforschung. Zu erforschen galt es alle Handlungen und seelischen Regungen, die der christlichen Lehre zuwider waren. Und wer konnte schon von sich sagen, daß er sich dieser Lehre immer und in jeder Hinsicht konform verhalten habe? Wenn ein Inquisitor bei Bereisung einer Stadt alle Bewohner aufforderte, »binnen sechs oder zwölf Tagen zu erscheinen und ihm alles zu enthüllen, was sie über jemanden erfahren oder gehört hätten und was zu dem Glauben oder Verdacht berechtigen könnte, daß derselbe ein Ketzer sei« »oder daß er gegen irgendeinen Glaubensartikel gesprochen habe oder daß er in seinem Lebenswandel von dem der Gläubigen abweiche«26 – gab es ihm da nicht allerlei zu gestehen? Und war es nicht besser, andere anzuschwärzen als sich selbst verdächtig zu machen?
Das Klima der Angst, welches die Inquisition erzeugte, verhalf den Dämonenphantasien zu einer neuen Blüte. Die Katharer hatten die Kirche, deren Sakramente sie ablehnten, lediglich als widerchristlich erachtet. Die Kirche hingegen machte die Katharer rückwirkend zu einer dämonischen Verschwörung. Die besagte Bulle Gregors IX. unterstellt ihnen wilde nächtliche Zusammenkünfte mit einem riesigen Frosch und einem großen schwarzen Kater, die widernatürlich zu küssen seien. Dann »werden die Lichter ausgelöscht und man schreitet zur abscheulichsten Unzucht ohne Rücksicht auf Verwandtschaft«.27 Die erschlagenen Katharer lebten in den Siegern fort wie Tote, die ihre Mörder in Alpträumen heimsuchen: verzerrt zu einer tierisch-menschlichen Gemeinschaft, die sich über Glaube, Sitte und Naturordnung gleichermaßen hinwegsetzt – als Vorhut einer chaotisch-diabolischen Macht, die es nicht nur auf die christlichen Seelen abgesehen hat, sondern sich anschickt, an der gesamten Weltordnung zu rütteln. Und diese Bedrohungsphantasie steckte auch alles andere an, was sich im Christentum subkutan noch an alten heidnischen Zauberpraktiken und Vorstellungen erhalten hatte und ließ diese Überbleibsel, die jahrhundertelang kaum Anstoß erregt hatten, unversehens als Aktivposten einer dämonischen Großoffensive erscheinen.
Skurril ist, wie der Cheftheologe des 13. Jahrhunderts, Thomas von Aquin, den neu aufflammenden Dämonenglauben mit messerscharfen Argumenten gesellschaftsfähig machte. Augustin hatte zwar eingeräumt, daß Dämonen einen Luftleib annehmen und in menschlichen Seelen Gaukelbilder hervorrufen können. Aber dieser Luftleib selbst: konnte der sich auch zu objektiven Gaukelgestalten materialisieren? Das hatte Augustin weder klar behaupten noch leugnen mögen. Thomas hingegen sagt entschieden ja. Es gibt neben der subjektiven Trübung der Sinne, die gelegentlich Trugbilder vorgaukelt, auch Fälle, wo unter bestimmten Luft- und Lichtverhältnissen mehrere Menschen, die ganz bei Sinnen sind, gleichzeitig wahrnehmen, was man eine Fata morgana nennt. Wenn es aber tatsächlich solche objektiven Trugbilder gibt, dann können Dämonen sowohl »die Phantasie eines Menschen bewegen, und auch seine körperlichen Sinne, so daß er etwas anders sieht, als es ist«, als auch »aus Luft einen Körper von jeder beliebigen Form und Gestalt formen, ihn annehmen und darin sichtbar erscheinen«.28
Damit war die Existenz von Sexualdämonen ratifiziert, die als Incubi Frauen beschlafen (incubare = draufliegen) und sich als Succubi geilen Männern unterlegen, ihren Samen auffangen und entwenden und damit unheilvolle Zeugungen vollziehen. Sexuelle Phantasien, die sich an den Katharern entflammt und mit Versatzstücken volkstümlichen Aberglaubens vielfältig angereichert hatten, bekamen ausgerechnet von Thomas, dem größten Rationalisten des Mittelalters, eine pseudowissenschaftliche Grundlage untergeschoben.
Nun mußten nur noch zwei Vergehen zusammengeschlossen werden, die anfangs wenig miteinander zu tun hatten: Häresie und Zauberei. Daran arbeitete die Inquisition besonders in der Zeit, als Avignon zum komfortablen Exil der Kurie geworden war. Traditionell waren Häretiker zumeist Intellektuelle, die zu bestimmten kirchlichen Lehren – über die Schöpfung, Inkarnation, Sakramente etc. – eine abweichende Auffassung vertraten, ohne deshalb anfällig für Zauberei zu sein. Zauberei wiederum war vornehmlich schlechte Gewohnheit: ein eher volkstümliches Haften an alten magischen Formeln und Riten aus vorchristlicher Zeit, doch zumeist ohne ernsthafte Absicht, sich von der kirchlichen Lehre loszusagen. Mit den Katharern schien sich das Gemeinsame dieser beiden Vergehen herauskristallisiert zu haben: die Teufelsbuhlschaft. Man konnte geistig mit dem Teufel buhlen: sich durch ihn zu Hochmut und Eigensinn verführen und von der christlichen Lehre abbringen lassen. Und man konnte physisch mit ihm buhlen: rituell-sexuell. Das waren nur zwei Seiten derselben Sache. Häretiker waren also stets mit dem Teufel im Bunde, Zauberer stets auch Häretiker.
Avignon lag dicht am ehemaligen Katharergebiet. Dorthin hatten es die von der Kurie ausgesandten Inquisitoren nicht weit. Dort fanden denn auch ab 1320 die ersten größeren Zauberer- und Hexenverfolgungen statt. Von Südfrankreich griffen sie nach Nordosten aus und fanden ab 1420 ihren nächsten großen Schauplatz in den Westalpen, ehe sie, angefacht durch eine Bulle Innozenz’ VIII. aus dem Jahre 1484, »in einigen theilen des Oberteutschlands, wie auch in den Meyntzischen, Cölnischen, Trierischen, Salzburgischen Erzbistümern, Städten, Ländern, Orten« das Jagdgebiet fanden, in dem sie dank deutscher Gründlichkeit überhaupt erst ihr Hauptwerk begannen. Jakob Sprenger und Heinrich Institoris, zwei Dominikaner, die im Auftrag und Namen von Innozenz’ Hexenbulle Deutschland bereisten, verfaßten im Zuge ihrer akribischen inquisitorischen Tätigkeit jenen berühmten Leitfaden zur Aufspürung und Zerschmetterung der Hexen, der vom 15. bis zum 17. Jahrhundert 29 Auflagen erlebte: den Hexenhammer.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.