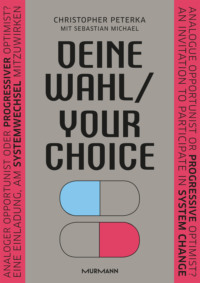Kitabı oku: «Deine Wahl / Your Choice - Zweisprachiges E-Book Deutsch / Englisch», sayfa 5
NEUE SCHLACHTFELDER, NEUE RECHTE, NEUE IDENTITÄTEN
[UM VIRTUELLES TERRITORIUM WERDEN HEFTIGE REVIERKÄMPFE AUSGETRAGEN.]
Obwohl, wie gesagt, die Entwicklung des Internets mit Geldern des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums gefördert wurde, liegt die frühe Geschichte viel näher an der Hippiekultur und einer sehr idealistischen, fast utopischen Perspektive. Es ging um einen freien, demokratischen, offenen, unbeschränkten Bereich für Kommunikation, Information, Austausch, Lernen und Gemeinschaft. Dieses Ideal ist leider dahin.
Mittlerweile werden Revierkämpfe um virtuelles Territorium ausgetragen, und sie sind ähnlich schwer wie jene, die auf klassischen Schlachtfeldern stattfinden.
Manche sind recht subtil, andere weniger. Huawei ist ein klarer Fall, der bereits viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Ähnlich auch die handfesten Belege zur Einmischung der russischen Regierung in Wahlen und Abstimmungen in mächtigen westlichen Demokratien. Aber das ist eher die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Auch in der kommerziellen Sphäre findet ein ständiger Kampf um die Vorherrschaft statt.
Statt viele unabhängige und unterschiedliche Anbieter geschaffen zu haben, ist das Internet eher zu einer Art digitalem Superkontinent geworden, auf dem sich alles – alle Arten von Produkten und Dienstleistungen – im Besitz eines halben Dutzends von Unternehmen befindet. Wir bezeichnen sie als GAFATA, was momentan die wichtigsten Spieler umfasst.
In dieser Art Konfrontation sieht man einen Hauptspieler – sagen wir Amazon –, der sich plötzlich einfach weigert, bestimmte Produkte einer Firma anzubieten, mit der er sich in Konkurrenz befindet, wie zum Beispiel Apple. Das ist kein hypothetischer Fall, sondern ein aktueller Fakt.
Das Wasser wird trüber und alles noch komplexer, wenn kommerzielle Interessen und staatliche Überwachung auf erklärte Ideologien und implementierte Kontrolle über den Datenverkehr treffen.
Sagen wir mal, ich gehe nach China mit meinem Laptop oder Smartphone und entdecke, dass ich weder Google noch andere gewohnte und für mich wichtige Dienstleistungen nutzen kann. Was kann ich tun? Na ja, ich kann eine kleine Software herunterladen, die ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) erzeugt, das mir erlaubt, einen virtuellen »Tunnel« unter Chinas Firewall hindurchzugraben und so zu tun, als wäre ich woanders. Wahrscheinlich funktioniert das eine Weile ganz gut, aber: Wer besitzt das VPN? Kann ich ihm wirklich meine Daten anvertrauen? Wer versichert mir, dass die Leute, die mir meinen kleinen persönlichen Tunnel bereitstellen, mit den Leuten, unter deren Mauer ich hindurchgraben will, nicht unter einer Decke stecken?
[IST ES NOCH MÖGLICH, PRIVAT ZU SEIN? UNSICHTBAR?]
Oder ich gehöre zu einer Gruppe von Leuten, die in großen Teilen der Welt diskriminiert werden. Zum Beispiel die LGBT-Community. Im Juli 2019, zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Buches, gibt es immer noch 69 Länder auf der Welt, die Homosexualität gesetzlich einschränken oder verbieten. Wenn du in eines dieser Länder reist, wird dein Onlineprofil eventuell nicht nur zum Hindernis, etwa weil du kein Visum bekommst, es könnte auch zur existenziellen Bedrohung werden, zum Beispiel weil du verhaftet und angeklagt oder von einer Meute verprügelt wirst.
Was genau bedeutet es für mich, in einer Welt zu sein, in der meine virtuelle und körperliche Existenz nicht trennbar sind? Bedeutet es, dass ich, um sicher und halbwegs frei zu sein, mehrere Profile erstellen muss? Entspräche dies einer multiplen Persönlichkeit? Wie würde ich das überhaupt anstellen? Schau dir zum Beispiel dein Facebook-Profil, dein Amazon-Konto und deine Apple-ID an: Sie sind alle ein Teil desselben Korbs an Vermögenswerten, den deine Person darstellt. In vielerlei Hinsicht tragen sie dazu bei, dass es im digitalen Zeitalter so bequem ist, du zu sein. Das Ganze ist eine Sache der Funktionalität: Allein die Tatsache, dass ich für eine ganze Reihe von Apps, ob Einkauf, Dating oder Sonderdienstleistung, mein Facebook-Profil nutzen kann, um mich einzuloggen, macht alles so einfach. Es ist brillant. Und auch das, was mich digital unmöglich von meiner Online-Identität unterscheiden lässt.
Das führt uns zu dem Punkt, dem wir bisher ausgewichen sind – die Privatsphäre. Ist es in Anbetracht all dieser Umstände immer noch möglich, privat zu sein? Unsichtbar zu sein? Wenn wir es wollen? Wollen wir überhaupt noch privat sein? Und wenn ja, wer soll diese Privatsphäre schützen? Welche Gesetze können nicht nur meine Privatsphäre, sondern auch meine grundlegendsten Menschenrechte schützen?
Die Verquickung von virtueller und realer Sphäre hat es völlig unmöglich gemacht, zu erkennen, wer was kontrolliert, wer die Regeln bestimmt, wer sie befolgt und wer sie schlichtweg ignoriert. Wir haben einen Dschungel verzweigter Interessen, verschachtelter Kompetenzen und diffuser Verantwortlichkeiten erschaffen und das Ganze in etwa so gut reguliert wie den Wilden Westen. Kein Wunder, dass wir in der Patsche sitzen.
Was wir also brauchen, ist ein umsichtiges, differenziertes und diszipliniertes Management der digitalen Infrastruktur und Organisation. Nicht um irgendjemandem Kontrolle darüber zu geben, sondern um für einen angemessenen Grad an digitaler Hygiene zu sorgen, eine gesunde Welt, in der Beziehungen transparent sind und in der wir als Bürger und Gemeinschaft einen Schutz unserer Rechte erfahren und unser körperliches und digitales Wohlergehen garantiert wird.
[WIR BRAUCHEN EINE CHARTA, DIE GESETZLICH DIE INTEGRITÄT UND DAS WOHLBEFINDEN ALLER VERANKERT.]
Dazu gehört die Klärung der Frage, was möglich und was vertretbar ist. Gibt es für das, wozu wir technisch in der Lage sind, auch eine ethische Rechtfertigung? Mit jedem Schritt unserer technologischen Evolution haben wir uns genau diese Frage stellen müssen, am gründlichsten bei der Kernforschung. Obgleich dieses Dilemma bei weitem nicht neu ist, erreicht es uns schneller als zuvor und ist vielleicht jetzt auch komplexer. Die Atombombe wurde und wird bis heute zur Abschreckung verfügbar gehalten: Wenn man genug Zerstörungskraft auf Knopfdruck abrufbereit hält, um die gesamte Zivilisation zu vernichten, dann traut sich auch dein Gegner nicht, sein Potenzial einzusetzen – verfügbar gehalten. Ein hochriskantes Kalkül, das bisher aber scheinbar aufgeht. Die heute notwendigen Entscheidungen scheinen allerdings weit weniger eindeutig und offensichtlich, dabei jedoch nicht weniger wichtig.
Wenn wir ein regelndes, ethisches, anwendbares Rahmenkonzept fordern, das unsere Menschenrechte als digitale Bürger definiert und schützt, dann stellt sich natürlich die Frage: Wer soll diese Aufgabe erfüllen? Wer entwirft welche Art Charta und unterschreibt sie? Wer stellt sicher, dass die »digitalen Superstaaten« – GAFATA und wer immer im Laufe der nächsten Jahre als globaler Spieler dazukommt – sich daran halten?
Wir behaupten, dass sie selbst es sein müssen. Nicht isoliert, sondern in engem Verbund mit den G20 und den Vereinten Nationen.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – der bis heute größten von Menschen ausgelösten Katastrophe – von den Vereinten Nationen verabschiedet. Sie war der erste Versuch, auf globaler Ebene die grundlegendsten Rechte, die alle Menschen unabhängig von Nationalität, Abstammung, Glaubensrichtung oder politischer Überzeugung haben sollten, in Worte zu fassen. Sie hat den Grundstein für viele Bürgerrechts- und Gleichberechtigungsbewegungen gelegt, die in der Nachkriegszeit ins Leben gerufen wurden.
Heute brauchen wir eine Charta, die gesetzlich das Wohlbefinden und die Integrität für alle Netzwerkbeteiligten verewigt und alle mächtigen Parteien – seien sie Nationalstaaten oder globale Konzerne – verpflichtet, sie zu respektieren, zu schützen und aktiv zu fördern.
Dass dies ein globales Unterfangen sein muss, ist klar. In einer global vernetzten und verbundenen Welt werden globale Werte immer wichtiger, nicht nur weil Menschen über die begrenzenden Horizonte ihres eigenen Ursprungs und ihrer Wohnorte hinwegblicken können und wollen, sondern auch weil wir in eine immer globaler werdende Kultur eingebettet sind. Heißt das, dass wir unsere lokalen und regionalen Identitäten aufgeben müssen?
David Goodhart, ein britischer Journalist und Autor, Gründer und Redakteur des Prospect Magazine, hat eine klare Unterscheidung zwischen »irgendwo« und »überall« formuliert.
»Irgendwo«-Menschen sind Leute, die durch ihren Job, ihre Familie und Freunde, ihre emotionalen Bindungen und wirtschaftlichen Einschränkungen an einen Ort gebunden sind. Sie sind tendenziell weniger gebildet und schätzen, wie er sagt, »Gruppenbindung, Vertrautheit und Sicherheit«. »Überall«-Menschen dagegen können tatsächlich überall sein: Sie sind typischerweise gut gebildet und entweder Single oder in einer Beziehung ohne weitere Verantwortung dafür, oder sie haben eine Familie, die sie mitnehmen können. Sie können in Barcelona leben und ihren Laptop zur Arbeit nach Berlin tragen, ein paar Tage mit Freunden in Hongkong verbringen, einen Freelance-Job in Delhi übernehmen und sich dann übers Wochenende in New York erholen – ganz wie es ihnen gefällt. Solange sie ihre Internetverbindung haben, sind sie funktionsfähig; und ihr Blick auf die Welt, ihr soziales Netzwerk und ihre Arbeitsbeziehungen reflektiert das. Laut Goodhart schätzen sie »Autonomie, Offenheit und Fluidität«.
Wir vermuten, dass viele von euch, die das hier lesen, »Überall«-Menschen sind. Wir sind es gewiss. Goodhart erklärt weiterhin, dass »Überall«-Menschen – zumindest in England – nur etwa ein Viertel der Bevölkerung ausmachen, aber über verhältnismäßig viel Einfluss und Macht verfügen, unabhängig davon, auf welcher Seite des politischen Spektrums sie sich befinden. Er weist darauf hin, dass die politische Vernachlässigung, die die »Irgendwo«-Menschen erlebt haben, sie zur Wahl des Brexits geführt haben. Und das Gleiche kann sicherlich für die Wahl Trumps in den Vereinigten Staaten gesagt werden.
Aber auch wenn du global noch so gut vernetzt bist, ein extrem mobiler, polyglotter, globetrottender »Überall«-Mensch bist, hast du immer noch eine Herkunft. Du hast immer noch eine Familie, einen Ursprung, einen Freundeskreis. Und du machst dir Sorgen, wenn der Müll auf deiner Straße nicht abgeholt wird oder es in deiner Nachbarschaft zu Messerstechereien kommt. Lokale Anbindungen, persönliche Beziehungen und deine Wurzel verschwinden also nicht: Selbst das globale Dorf hat einen kleinsten gemeinsamen Nenner, und das ist immer noch die Familie. Wie man Familie definiert, hat sich unter Umständen jedoch beachtlich geändert. Jenseits von Patchworkfamilien, Alleinerziehenden und Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern – allesamt bis vor 25 Jahren nicht voll anerkannt – sehen viele Menschen in der Familie heutzutage nicht mehr nur Blutsbande, sondern auch enge Freunde, mit denen sie familienartige Beziehungen führen.
Als »Überall«-Mensch identifizieren wir uns tendenziell nicht mehr so sehr mit unserer Nationalität. Das heißt nicht, dass wir nicht Teil von etwas sind. Wenn man eine große Stadt wie London oder Tokio oder einen Stadtstaat wie Singapur besucht, wird sofort klar, dass die Leute sich dort sehr zu Hause fühlen. Solange sie eben da sind. Und wenn sie in eine andere Stadt weiterziehen, dann werden sie für die nächsten Jahre eben sagen, dass sie von dort sind.
[WIR WOLLEN IMMER NOCH ALLE DAS GEFÜHL HABEN DAZUZUGEHÖREN.]
Worauf wir hier den Blick richten wollen, ist die simple Tatsache, dass wir keine fixen Bezugspunkte mehr haben, um unsere Identität festzulegen, was aber nicht bedeutet, dass für uns andere Menschen, tatsächliche Orte und gemeinsame Werte nicht mehr existieren oder keine Bedeutung mehr haben. Einige GAFATA-Konzerne, darunter Google und Facebook, fördern eine Unternehmenskultur, die sehr nach nationaler Tradition klingt und so erscheint. Sie haben einen Verhaltenskodex und eine interne Sprache, die alle Neuzugänge lernen und anerkennen müssen, selbst wenn das vertraglich nie irgendwo erwähnt wird. In manchen großen Firmen ist die Anerkennung des Firmenethos tatsächlich Teil des Anstellungsvertrages.
Ob du jetzt Teil eines »Tribe« bist, der sich durch Musikgeschmack und Klamotten definiert, oder »die Marke lebst«, die dein globaler Arbeitgeber verkörpert; ob du täglich mit deinen Eltern skypst, die 2000 Kilometer entfernt leben, oder bei deiner Oma durchklingelst, um zu hören, ob sie einen schönen Samstagnachmittag verbringt: Wir wollen immer noch alle das Gefühl haben dazuzugehören.
Seit dem Beginn der digitalen Moderne – markiert durch den verbreiteten Gebrauch des Internets um die Jahrtausendwende herum – hat die Teilnahme an Festivals und Livekonzerten zugenommen; Livetheater und Großformatkino, drinnen wie im Freien, florieren, immersives Gaming, Abenteuer und narrative Erlebnisse schießen nur so aus dem Boden. Gleiches gilt für Virtual Reality (VR) und Crossover-Zeitvertreib, siehe »Pokémon Go« oder »Ingress«. Wir sehnen uns ganz klar immer noch nach körperlichen Empfindungen, jedoch nicht zwingend denselben wie im prädigitalen Zeitalter. Immerhin hat eine Analyse umfangreicher Datensätze, 1991, 2001 und 2012 erstellt vom British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, ergeben, dass Leute über alle Altersgruppen hinweg heutzutage weniger Sex haben als vor 20 Jahren, zumindest in Großbritannien. Vielleicht sind sie deswegen zurzeit so mies drauf …
Noch ein abschließender Gedanke zur Beziehung zwischen körperlicher Welt und digitaler Existenz. Seit den frühen 1980er-Jahren hat sich mit der Gründung von The Seasteading Institute (TSI) im Jahr 2008 allmählich der Begriff »seasteading« etabliert. Die Idee eines Seastead bezeichnet die Gründung von unabhängigen Gemeinschaften auf hoher See, die daher keinem nationalen Territorium angehören und folglich freie Hand haben, ihre eigenen Regeln und Gesetze zu befolgen.
Laut UN-Konvention des Seerechts beginnt die hohe See 200 Seemeilen, also 370 Kilometer, von der Küstenlinie entfernt. Wenn man sich auf hoher See befindet, fällt man unter keine weitere Rechtsprechung als diejenige des Landes, unter dessen Fahne man segelt. Folglich, so die Logik, kann man, wenn man eine dauerhafte Gemeinde auf hoher See errichtet, dort seine eigene Fahne hissen und komplett unabhängig von jeglichen bestehenden Gesetzen sein: Man kann seine eigene Gesellschaft gründen.
Es sind noch keine funktionalen Seasteads gebaut worden, aber das TSI beschreibt auf seiner Website in einem kurzen Einführungsvideo Seasteads als »schwimmende Städte, die Leuten die Möglichkeit geben werden, neue Ideen über ein friedliches Zusammenleben testen zu können« und auf diesem Weg »die erfolgreichsten florierenden Gesellschaften entstehen [zu] lassen und Wandel auf der ganzen Welt [zu] inspirieren«. Es wird darauf hingewiesen, dass die Hälfte der Erdoberfläche aus unbeanspruchtem Territorium bestehe und schwimmende Städte daher wie »Start-up-Länder« am »blauen Horizont« funktionieren könnten. Das Seastead-Konzept wird verglichen mit digitalen Innovatoren und Disruptoren, deren intellektuelle, unternehmerische und Pioniereinstellung für die Entwicklung von Verfassungen und die Verwaltung von Gesellschaften ein immenses Potenzial freilegen könnte. Frei von den bröckelnden Regierungsinstitutionen und Staaten, die die Kreativität und die Ressourcen der Leute auszehren.
Interessant an der Idee des Seasteading für uns hier ist, dass es in ihrem Kern um den Wunsch geht, völlig neue gesellschaftliche, ökonomische und ethische Richtlinien zu erschaffen, und geografische Orte – einzelne Seasteads – miteinander um Anwohner wetteifern. Jene, die erfolgreich sind, werden florieren wie ein erfolgreiches Start-up, jene, die fehlschlagen, werden einfach verlassen und hören auf zu existieren.
Die praktischen Probleme eines Seastead einmal beiseitegelassen, stellt die theoretische Konzeption ein faszinierendes Beispiel von Tabula-rasa-Denken dar, das womöglich immer notwendiger wird: nicht nur wenn wir von schwimmenden Städten draußen auf dem Ozean träumen, sondern, viel näher an unseren drängenden Problemen, in Bezug auf die Verwaltung unserer Netzwerke.
Zum Abschluss dieses Kapitels hier noch einmal das Wesentliche auf den Punkt gebracht:
 Die virtuelle und die analoge Welt sind nicht mehr klar voneinander getrennt, sie sind Teil derselben Realität.
Die virtuelle und die analoge Welt sind nicht mehr klar voneinander getrennt, sie sind Teil derselben Realität.
 Sowohl die Infrastruktur, die bereits besteht, als auch diejenige, die noch gebaut wird, um den virtuellen Teil unserer Welt möglich zu machen, ist genauso wichtig wie die digitalen Inhalte, die sie verwaltet.
Sowohl die Infrastruktur, die bereits besteht, als auch diejenige, die noch gebaut wird, um den virtuellen Teil unserer Welt möglich zu machen, ist genauso wichtig wie die digitalen Inhalte, die sie verwaltet.
 Es finden in unserer Realität heftige Revierkämpfe statt, bei denen sowohl kommerzielle als auch staatliche Akteure um Vorherrschaft und Kontrolle ringen.
Es finden in unserer Realität heftige Revierkämpfe statt, bei denen sowohl kommerzielle als auch staatliche Akteure um Vorherrschaft und Kontrolle ringen.
 Unsere digitale und körperliche Integrität wie auch unser Wohlbefinden als Menschen stehen auf dem Spiel, weswegen wir dringend neue ethische Richtlinien und eine neue, global ausgerichtete Führung für diese Welt brauchen.
Unsere digitale und körperliche Integrität wie auch unser Wohlbefinden als Menschen stehen auf dem Spiel, weswegen wir dringend neue ethische Richtlinien und eine neue, global ausgerichtete Führung für diese Welt brauchen.
ORIENTIERUNGSAUSSAGEN
2.1
»Der analoge und der digitale Raum können nicht mehr länger separat betrachtet werden.«

Trage diesen Wert auf folgenden Achsen ein: C, E, F.
2.2
»GAFATA sind mächtiger als die G20.«

Trage diesen Wert auf folgenden Achsen ein: A, C, G.
2.3
»Das globale Dorf verkürzt nicht nur Distanzen, sondern ermächtigt auch globale Wertegemeinschaften.«

Trage diesen Wert auf folgenden Achsen ein: B, E, H.
2.4
»Eine imperialistische Besetzung von virtuellem Territorium ist bereits im Gange.«

Trage diesen Wert auf folgenden Achsen ein: A, E, F.
ÜBUNGEN FÜR DEN WANDEL
An was glaubst du (ausgedrückt in drei Hashtags)?
Wenn du deine Hashtags teilen möchtest, kannst du das hier tun: https://twitter.com/C_Peterka
Kapitel 3
Geschätzte Lesezeit: 23 Minuten
Erster Abschnitt: 10 Minuten
Zweiter Abschnitt: 9 Minuten
Dritter Abschnitt: 4 Minuten
DAS EINZIGE, WAS UNS ZU EINEM SYSTEMWANDEL FEHLT, IST ÜBERZEUGUNG
HEDONIST 3.0 – DER WUCHERMENSCH
SPIELEN
Vergnügen, Sinneserfahrung, uns selbst und andere genießen – das und Ähnliches ist nicht einfach verschwunden. Im Gegenteil: Es ist sogar wichtiger geworden, und nicht nur das, es ist wesentlich leichter herstellbar. Zumindest für uns, die wir ein sicheres Leben in einem entwickelten Land führen können. Verglichen mit den Zeiten Gutenbergs leben wir heute wie Könige.
[WIR HABEN ES EIGENTLICH NOCH NIE SO GUT GEHABT.]
Das ist ein Erfolg, den man nicht gering schätzen sollte. Durch die Nachrichten und die Dauerberieselung damit bekommen wir oft den Eindruck, alles sei furchtbar. Tatsächlich sind wir in vielerlei Hinsicht ein spektakulärer Erfolg. Wir sind besser gebildet als je zuvor, die Lese- und Schreibfähigkeit befindet sich weltweit auf dem historisch höchsten Niveau. Und das sogar einschließlich Frauen und Mädchen wie auch sozialen Schichten, denen jahrhundertelang entweder keine Bildung zuteilwurde oder nur unter außergewöhnlichen Umständen. Wir haben mehr Freizeit, wir reisen weiter, die Wahrscheinlichkeit, dass wir an Krankheiten, durch Gewalt oder Unterdrückung sterben, ist geringer als für jede Generation vor uns. Wir haben es tatsächlich noch nie so gut gehabt.
Was auch stimmt: Viele werden weiter ausgebeutet und ungleich behandelt, wir leben in keiner perfekten Welt. Dennoch: Im Vergleich zur Welt, in der ein Gutenberg aufwuchs, haben wir »Vollidioten« es im Zeitalter der Zuckerbergs erstaunlich weit gebracht.
[WIR SIND NICHT DEM UNTERGANG GEWEIHT.]
Als William Shakespeare sich Mitte der 1580er-Jahre eine kurze Auszeit von seiner etwas älteren Frau und seinen drei Kindern in Stratford-upon-Avon gönnte und sich einen Namen als Dichter und Theaterautor machte, betrug die Lebenserwartung für einen jungen Mann in London etwa 30 Jahre. Kein Wunder, dass er schon mit 29 eine Art Midlife-Crisis erlebte und sich Hals über Kopf in einen reichen und besonders schönen, zehn Jahre jüngeren Edelmann verknallte. Wie wir von den vielen und nicht selten genau diesem Liebhaber gewidmeten Sonetten wissen, lebten diese Menschen oft ein Liebesleben, von dem wir auf Facebook heutzutage sagen würden: »It’s complicated.« Das hat aber auch damit zu tun, dass das Leben damals hart war und schnell vorbei sein konnte.
Als Mann konnte man jederzeit zum Duell herausgefordert, in den Krieg geschickt, in eine Schlägerei verwickelt oder für einen x-beliebigen Grund hingerichtet werden. Als Frau gehörte man gesetzlich seinem Ehemann oder Vater – außer man wurde Nonne oder war zufällig die Queen. Die Wahrscheinlichkeit, bei der Geburt eines Kindes zu sterben, war recht hoch.
Wer sich eine Grippe einfing, übel den Finger ritzte oder die Treppe hinunterstürzte, konnte ohne Weiteres den Folgen erliegen: Es gab keine Antibiotika, kaum Desinfektionsmittel, außer Alkohol, und keine Krankenwagen. Die Pest radierte regelmäßig ganze Bevölkerungen über ganz Europa hinweg aus; und wenn es ein mieses Jahr war und die Ernte ausfiel, dann verhungerten die Menschen.
Früher war also nicht alles besser: In fast jedem Teil der Welt sind Lebenserwartung, Wohlstand und der Schutz persönlicher Rechte kontinuierlich angestiegen. Ja, es liegt noch einiges an Weg vor uns, aber wir sind nicht dem Untergang geweiht.
Was ist dann los? Wieso fühlt es sich dann nach dem Gegenteil an?
Es ist gut möglich, dass wir uns einer prekären Schwelle nähern. In manchen Teilen der entwickelten Welt – Teilen der USA und Großbritanniens zum Beispiel – stagniert die Lebenserwartung oder sinkt sogar, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Deutschland weist aktuell eine der geringsten Lebenserwartungen in der entwickelten Welt auf, obwohl es die größte Wirtschaftsmacht Europas und die viertmächtigste der Welt gleich nach Japan, China und den USA ist.
Wie kann das sein? Wie kommt es, dass wir in so einer elementaren Kategorie stagnieren oder sogar verlieren? Mit all dem Wohlstand und all der Gesundheitsfürsorge und all der Bildung und all der Vernetzung, die wir haben?
Kann es sein, dass wir zu viel haben? Von allem? Essen, Trinken, Drogen, Kram?
Oder sind wir einfach zu busy? Stress ist ein signifikanter Indikator in den deutschen Gesundheitsstatistiken. Aber sagten wir nicht, wir hätten mehr Zeit für uns selbst übrig als die Generationen zuvor? Das stimmt zwar, aber was machen wir damit? Wir packen sie voll. Wir verplanen jede Minute des Tages mit irgendeiner Beschäftigung. Wir verplanen die Tage unserer Kinder mit Aktivitäten. Und selbst wenn wir nichts tun, kleben wir an unseren Bildschirmen, wo alle paar Minuten eine Benachrichtigung unsere Aufmerksamkeit auf irgendetwas richten will. Wir sind ständig angetrieben, stimuliert und beschäftigt – rastloser als jemals zuvor.
»What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare.
No time to stand beneath the boughs,
And stare as long as sheep and cows.«
So fragte der Dichter William Henry Davies in seinem Gedicht Leisure von 1911. Damals hatten die meisten nicht einmal ein Telefon, und damit meinen wir einen oldschool Festnetzanschluss – falls ihr noch wisst, was das ist. »A poor life is this«, schlussfolgert er, nachdem er ein paar weitere Zeilen lang ein Landschaftsidyll beschrieben hat, »if, full of care, / We have no time to stand and stare.«
[NICHT ZU LEIDEN WAR DAS WICHTIGSTE.]
Sind wir also immer noch nichts weiter als Hedonisten, die nur Spaß haben wollen und das auch echt gut draufhaben, oder haben wir uns insgesamt in etwas wesentlich Problematischeres verwandelt? Verwandeln wir uns in Wuchermenschen? Ein Mensch im Exzess. Ein Wesen unkontrollierten und unkontrollierbaren Wachstums sowie grenzenloser Gier? Ist das ein neuer Archetyp des 21. Jahrhunderts? Und wenn ja, ist das wirklich das, was wir sein wollen?
Bevor wir diese Frage untersuchen wollen, rufen wir uns ins Gedächtnis, wie wir genau hier gelandet sind. Das war keineswegs ein Zufall. Für die, die den Zweiten Weltkrieg durch- und überlebt hatten, galt als oberste Priorität, die Lebensumstände in der Nachkriegszeit zu verbessern. Mit deutlicher Erinnerung an die Mühsal, Zerstörung, Not und Rationierung war es am wichtigsten, nicht zu leiden. Nicht verzichten zu müssen.
Also wurde gearbeitet, und zwar hart, um materiellen Wohlstand anzuhäufen. Nicht nur genug Essen, sondern reichlich Essen. Nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern eine gemütliche Bleibe und ein Auto, am besten zwei. Küchengeräte und Nippes für den Kaminsims. Es schien vernünftig und nötig. Leibliches Wohl und ein anerkannter Lebensstil waren nicht nur eine nette Angelegenheit, es waren Kernambitionen, die Grundmotivation der Begierde. Für einen selbst wie für die eigenen Kinder und Kindeskinder.
Bei einem derart gut ausgestatteten und versorgten Nachwuchs überrascht es nicht, dass eine Generation entsprang, die alles hatte, und dann eine nächste, die nicht mehr nur alles hatte, sondern komplett drüber war: über-vernetzt, über-ausgestattet und über-versorgt mit Produkten, Marken, Labeln und Dienstleistungen, aber gleichzeitig bemerkenswert unter-engagiert und unter-beteiligt in Bezug auf das eigene »Schicksal«, mehr noch das des Planeten oder das nachfolgender Generationen. So schien es zumindest eine kurze Zeit lang.
Doch Dinge ändern sich immer weiter. Während wir dies schreiben, erreichen uns die Nachrichtenmeldungen über Proteste in Hongkong und in Moskau. Vor einigen Wochen kamen sie auch aus London. Es geht bei allen Protesten um etwas anderes, aber die Demonstranten gehören zum großen Teil der gerade beschriebenen Generation an. Es wäre schlichtweg falsch, die jungen Menschen heute als allgemein gleichgültig zu beschreiben.
Bleibt jedoch die Frage: Was passiert nach der Demo? Hier unterscheiden sich die Proteste in Hongkong und Moskau von denen der Extinction Rebellion. Die ersteren haben klare und spezifische demokratische Forderungen, die rein auf der lokalen und nationalen Ebene erfüllt werden können. Der Umweltaktivismus verfolgt viel komplexere Ziele, die nicht lokal und national gelöst werden können, die radikale politische und ökonomische Änderungen erfordern und eine vollständige Überarbeitung und Neukonzipierung der Gesellschaft und ihrer Funktionsweise voraussetzen.
Es ist ohnehin unmöglich, eine ganze Generation über einen Kamm zu scheren, als wäre sie eine uniforme, homogene Gruppe. Wie immer eröffnet sich auch hier bei näherem Hinsehen ein viel differenzierteres Verständnis. Und zwar das einer Generation, die vielleicht überwältigt ist von den Möglichkeiten, dem Potenzial und den Freiheiten, die sie genießt. Die nicht vor ihren eigenen Verantwortlichkeiten zurückschreckt und Zuflucht in Erholung sucht, die Bedarf hat an einer Strategie oder überhaupt dem Gefühl, etwas ausrichten zu können, wenn man es denn versuchte.
Darüber hinaus hat sich die wirtschaftliche Realität, in der sich diese Generation wiederfindet, im Vergleich zu dem, was ihre Eltern und Großeltern erlebten, fast bis zur Unkenntlichkeit gewandelt. Jobsicherheit kann man so gut wie vergessen. Staatliche Renten können in vielen großen Wirtschaften nicht mehr die Existenz der alternden Bevölkerung sichern.
Nie zu wissen, wie lang der eigene Job halten wird, nicht zu wissen, wie man sich im Alter versorgen wird – diese Art von Ungewissheit ist schon ein beachtlicher Stressfaktor, der noch nicht ganz verstanden ist und sicherlich nicht ignoriert werden kann. Wenn du heute Mitte 20, 30 und sogar 40 bist und arbeitest, hast du keinerlei Garantie für eine sichere Altersvorsorge. Vielleicht denkt man nicht jeden Tag daran, aber es lauert irgendwo im Unterbewusstsein. Es ist eine Ungewissheit, die über dir schwebt. Zu allem bereits Erwähnten – den Ablenkungen, den Krisen, dem Bedeutungsverlust – kommt das noch hinzu, ohne die Möglichkeit dem Stress einfach den Rücken zu kehren, sich um sich zu kümmern und sich in ein Leben voller Sonnenuntergänge und Freizeit abzusetzen. Nicht nur hat man jetzt keine Zeit dazu, einfach nur dazustehen und in die Luft zu starren, man wird sie vermutlich nie haben …
Oder nehmen wir das Konzept, für manche auch das Ideal der »Sharing Economy«. Sie hat gewiss ihren ganz eigenen Charme und suggeriert den Verzicht auf das Bedürfnis, Dinge zu besitzen, als Weg, sich von einem goldenen Käfig zu befreien. Sie bietet stattdessen den über Online- oder Mobilplattformen geteilten Besitz an, ob das eine Bleibe, das Auto für den Weg zum Flughafen oder der Platz zum Arbeiten ist. Aber geht es hierbei wirklich um Teilen? Viele würden das verneinen und feststellen, dass es dabei vielmehr um den somit vermittelten Zugang geht, der nun von noch wenigeren kontrolliert wird, und die Bereitstellung noch stärker monopolisiert ist, als es zuvor der Besitz war. Während es nun also noch schwieriger für junge Leute wird, auf die Besitzleiter zu steigen, bleibt weitgehend unklar, wie die Alternativen aussehen.
Die Katastrophe für uns als menschliche Wesen, und damit für unseren Planeten, ist nicht, in unserem Verlangen erfolgreich zu sein, sondern vielmehr kulturell darauf konditioniert zu werden, zu akzeptieren, dass Wachstum um des Wachstums willen – mehr zu wollen, einfach weil es mehr ist – und Profit um jeden Preis uns ein Gefühl von Erfüllung oder Zufriedenheit geben werden. Dabei wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Die Tatsache, dass materieller Wohlstand und Geld allein nicht glücklich machen, ist immer und immer wieder bestätigt worden. Was wir brauchen, ist eine gesicherte Grundlage und die Möglichkeit, gelassen zu leben. Aber ab einem gewissen Punkt des Wohlstands wird es nicht leichter, sondern tatsächlich immer schwieriger, glücklich zu werden. Das gilt für Individuen wie für die Gesellschaft als Ganzes. Die Folgen davon beginnen wir nun zu spüren.