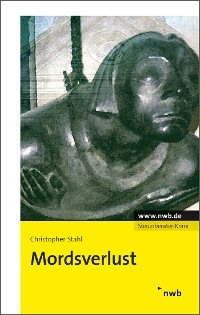Kitabı oku: «Mordsverlust», sayfa 4
„Und die anderen?”
„Die hielten sich ebenfalls zurück. Da will es sich doch keiner mit ihm verderben. Ich funktioniere hervorragend als abschreckendes Beispiel dafür, wozu der Alte in der Lage ist, wenn man bei ihm in Ungnade fällt. Noch einen Wein?”
Ich hatte gar nicht registriert, dass ich bereits das zweite Glas geleert hatte, lehnte nun aber dankend ab.
„An dem Abend nun bestand Renate auf einer Aussprache mit ihrem Mann. Er muss sich so geäußert haben, dass er gar nicht wisse, was sie wolle und hat ihr Hysterie vorgeworfen und gefragt, ob sie wohl endlich schwanger sei.”
„Ist sie es denn?”
„Nein. Sie verhütet, seitdem sie sich ihrer Liebe und ihrer Ehe nicht mehr sicher ist.”
„Und weshalb fragt er dann so etwas?”
„Weil Renate ihm verheimlicht hat, dass sie die Pille nimmt. Bis zu diesem Abend. Benjamin rastete aus, ein Wort ergab das andere und … das Resultat kennen Sie ja.”
„Was geschah dann weiter?”
„Benjamin rief etwa eine Stunde später an und fragte, ob Renate bei mir sei. Sie hatte mich aber vorher schon gebeten, ihren Aufenthaltsort nicht zu verraten. Er glaubte mir wohl nicht so ganz, denn er hängte wütend ein. Na ja, inzwischen weiß er, dass Renate bei mir war. Gertrud hat es ihm gesagt.”
Sie zuckte mit der Schulter, als wollte sie sagen, dass ihr das jetzt egal war.
„Renate ging dann zu Bett. Sie schlief lange, auch die nächsten Tage. Es war Ostern, ein Wetter wie in den letzten Tagen. Wir haben gelesen, ferngesehen und gequatscht. Aber nicht über ihre Situation. Sie wollte das nicht mehr. Am Dienstag hat sie dann ihre Mutter angerufen. Aber das wird Ihnen Frau Faber alles schon erzählt haben, nehme ich an.”
Ich nickte. „Und dann war sie am Morgen des 30. März spurlos verschwunden?”
„Ich habe nicht gehört, wann sie das Haus verlassen hat. Ich habe Durchschlafstörungen und nehme Schlaftabletten. Da habe ich noch nicht einmal mitbekommen, wie sie den Wagen aus der Scheune und auf die Straße gefahren hat. Als ich dann am nächsten Morgen, so gegen acht Uhr aufgestanden war, war nichts mehr da von ihr. Kein Kleidungsstück, kein Buch, keine Toilettenutensilien. Es war, als ob sie nie bei mir gewesen sei.”
„Hat sie nicht erwähnt, wo sie hingehen wollte?”
„Nein, obwohl ich sie gefragt hatte. Sie meinte, es wäre besser so, dann könnte ich mich auch nicht verplappern.”
„Und Sie haben keine Idee, keinen noch so vagen Hinweis? Hat sie etwas von Bekannten erzählt, von Kollegen, die sie von der Polizeischule kennt oder von Lehrgängen, Urlaubsbekanntschaften, Schulfreunden?”
„Nein, kein Wort.”
„Hat sie außer mit ihrer Mutter mit anderen telefoniert?”
„Wenn, dann höchstens über ihr Handy. Die ausgehenden Gespräche habe ich schon im Speicher meiner Telefonanlage überprüft. Da ist keines dabei, das sie geführt hat, außer dem mit ihrer Mutter.”
„Was für ein Auto hat sie?”
„Einen dunkelroten Nissan 350 Z, so einen Sportwagen. Das Kennzeichen ist AZ-RF-3636.”
„Haben Sie ihre Handynummer?”
„Natürlich. Ich durfte sie ja nie auf dem Festnetz anrufen. Das wäre aufgefallen.”
„Und haben Sie versucht, Renate zu erreichen, nachdem sie Ihr Haus verlassen hatte?”
„Daran gedacht habe ich schon, aber ich respektiere ihren Wunsch, dass man sie in Ruhe lässt. Wenn sie mich sprechen will, wird sie schon anrufen.”
Ich hatte von Marga Preuß alles erfahren, was sie zu dem Bild, das ich mir machen musste, beitragen konnte. Ich stand auf und bedankte mich für ihre Gastfreundschaft und das offene Gespräch. Sie wollte noch wissen, ob ich jetzt auch zu ihrem Neffen gehen würde. Aber der hatte über Gertrud einen Termin für den nächsten Morgen ausgemacht.
„Wenn Sie wieder einmal durch die Langgasse kommen, Herr Schäfer … Sie wissen ja jetzt wo die Klingel ist. Sie sind immer willkommen, jederzeit. Bringen Sie dann auch einmal Ihre Frau mit, ich würde mich sehr freuen.” Fast flehentlich signalisierte sie, dass sie in dem gewonnenen Kontakt mit mir einen Weg sah, ihrer Einsamkeit zu entfliehen.
Sie begleitete mich zum Tor, wo ich ihr noch versprechen musste, sie umgehend zu informieren, wenn ich etwas von Renate erfahren sollte.
Sonja war im Hof und spielte mit Kira und Siwa. Die 200-Watt-Lampe, die in fünf Metern Höhe an einem Drahtseil leicht im Wind schwankte, spendete das notwendige Licht dazu.
„Na, ist dein Tête-à-tête mit der mysteriösen Marga vorbei?” Sie empfing mich mit einem vielsagenden Blick, gefolgt von einem herzhaften Kuss, den sie allerdings sehr schnell unterbrach. „Puh, du riechst nach Alkohol. Du hattest mir doch gesagt, es ginge nur um ein kurzes Gespräch, und nun rieche ich, dass es sich um ein ausschweifendes Bacchanal gehandelt haben muss. Ich bitte um eine nachvollziehbare und ehrenhafte Erklärung, mein Liebster!”
Während wir ins Haus gingen, erinnerte ich mich an eine ähnliche Szene, als ich ihr zum ersten Mal begegnet war. Und heute, wie damals, hatte ich Schmetterlinge im Bauch. Nur mit dem Unterschied, dass ich vor drei Jahren dieses Gefühl noch nicht – oder besser gesagt nicht mehr – hatte einordnen können.
Ich war gerade auf dem Hoffest eines Weingutes in Flonheim eingetroffen, als eine Dixieband eines meiner Lieblingsstücke – Petit Fleur, von Sidney Bechet – spielte. Ohne genau hinzusehen hatte ich gedankenverloren am Ende eines der langen Tische Platz genommen, als sich neben mir eine angenehme Frauenstimme bemerkbar machte: „Aber gerne”, immer noch hatte ich den Klang ihrer Stimme und ihre fast schon provokative Ironie im Ohr, „nehmen Sie ruhig Platz.” Als ich mich, eine Entschuldigung stammelnd, umdrehte, strahlte mich eine attraktive Rothaarige, Mitte vierzig, frech aus ihren grünen Augen an. Mit einer leichten Neigung ihres Kopfes, einer Geste, die charakteristisch war für sie, vermutete sie, dass ich ohne elterlichen Beistand bestimmt Probleme mit den elementarsten Anstandsregeln hätte. Vor lauter Verzweiflung leerte ich die Weinschorle, die man mir inzwischen gebracht hatte, auf einen Zug, was sie mit der Bemerkung, das sei ja wohl eindeutig Überschreitung der gesetzlich zulässigen Trinkgeschwindigkeit kommentierte. Ja, so lernte ich Sonja kennen, so lernte ich sie nach ein paar Wirrungen einige Monate später lieben und so, genau so, liebte ich sie immer noch, jeden Tag ein bisschen mehr.
Jetzt berichtete ich ihr von dem Besuch bei Gertrud und bat sie gleichzeitig, Dagmar nichts davon zu erzählen. „Überlass das bitte Heribert.”
„Ich weiß zwar nicht weshalb, aber wenn du das willst, werde ich kein Sterbenswörtchen davon verlauten lassen”, versprach sie.
Anschließend erzählte ich ihr von dem Gespräch mit Marga Preuß. „Sie hat eigentlich ein recht sympathisches Wesen. Natürlich ist sie in Bezug auf ihre Familie ziemlich verbittert, aber mir gegenüber war sie sehr offen und freundlich. Sie hat mich, uns sogar eingeladen, einmal vorbeizukommen.”
„Soll das heißen, dass wir mit ihr nun einen auf Freundschaft machen?”, war Sonjas erster Kommentar, nachdem sie mir schweigend zugehört hatte. „Ich möchte nicht in das gleiche Horn tuten wie einige aus meiner Gesangsgruppe, die sich auf alles stürzen, was nicht in ihre kleine Welt passt. Die bezeichnen sie als … durchgeknallt.”
„Wie bitte?! Durchgeknallt? Was soll das denn jetzt?”
„Entschuldige, Darius, das ist ja nicht mein Sprachgebrauch. Frau Preuß ist Opfer vieler Umstände. Ich glaube ja, dass sich alles, was mit Renate zusammenhängt, so abgespielt hat. Erstens ist es identisch mit dem, was Gertrud euch erzählt hat, und zweitens, weshalb sollte sie die Unwahrheit sagen. Dazu ist das, was sie in dieser Sache erlebt hat, einfach zu banal.”
„Na also, weshalb bezeichnen dann so ein paar deiner Singschwalbentussis sie als durchgeknallt?”
„Darius, nimm einfach nur das, was du in der kurzen Zeit mitgekriegt hast. Sie ist zutiefst eigenbrötlerisch, geradezu asozial im pathologischen Sinn, sie spricht mit niemandem im Dorf – außer mit Pflanzen.”
„Da kenne ich aber noch ganz andere Typen. Denk nur mal an deinen Kollegen, der mit bajuwarischem Akzent Französisch unterrichtet, was der sich für hanebüchene Dinger erlaubt. Damit könnte man eine ganze Abteilung in der Nervenheilanstalt füllen.”
Sonja schaute mich skeptisch von der Seite an, ohne weiter auf meine Bemerkung einzugehen. „Sie nimmt seit Jahren Tabletten, weil sie nicht durchschlafen kann. Und das werden nicht die einzigen pharmazeutischen Teufelsdinger sein. Mensch, Darius, hast du dir denn nicht überlegt, mit wem du es zu tun hast?”
„Mit wem denn?”
„Mit einer Frau, der man die Jugend gestohlen hat, die gedemütigt und verstoßen wurde und ohne Liebe aufwachsen musste, ohne zu wissen, weshalb. Kannst du dir vorstellen, wie es in ihr aussehen muss, zerrissen zwischen Selbstzweifeln, unergründlichen Schuldgefühlen und Hass?”
„Du hast sie ja nicht gesehen, sie wirkte ganz normal auf mich”, setzte ich zu einer Rechtfertigung an.
„Klar, weil sie sich jeden Tag mit Psychopharmaka vollstopft. Sie war bereits mehrmals in Alzey in der Rheinhessenklinik, von der du meinst, dass die Verrücktheiten meines Kollegen sie alleine füllen würden.”
„Woher weißt du das?”, fragte ich kleinlaut.
„Ich kenne die Gerüchte, die über Marga Preuß kursieren, und während du bei ihr warst, habe ich ein wenig recherchiert, weil ich Gerüchte ebenso verabscheue wie du. Der Vater eines meiner Schüler ist …”, sie unterbrach sich, „besser nicht. Du weißt ja: Schweigepflicht. Ich habe einer Person mit Insiderwissen einige Fragen gestellt, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden mussten. Nicht ganz sauber, aber vertretbar.”
„Aber das heißt doch nicht, dass das, was sie mir über Renate erzählt hat, nicht stimmt.”
„Nein, das habe ich ja schon gesagt. Ich will nur keinen persönlichen Kontakt mit ihr. Mein soziales Engagement erschöpft sich im Übermaß in der Schule. Und auch ich habe nur ein begrenztes Kontingent zur freien Verfügung. Ich brauche auch noch etwas für dich.”
Beim letzten Satz sah sie mich so tiefgründig an, dass ich mich auf Wolke Sieben katapultiert fühlte. „Es ist schon spät”, sagte ich und versuchte das Raue aus meiner Stimme zu nehmen, was gründlich missglückte. „Ich gehe schon mal nach oben – Zähneputzen und so.”
„Einen halben Liter Mundwasser und eine ausgiebige Runde Duschen würde die ganze Sache noch attraktiver gestalten”, lockte Sonja. Als sie dann auch noch in Aussicht stellte, gleich nachzukommen, ließ sie damit nicht nur mein Herz vor Vorfreude höher hüpfen. Wir haben eine große Dusche, die es gewohnt ist, zarte Geheimnisse zu bewahren. Licht aus!
Freitag, 8. April 2005
Obwohl Gertrud den Termin mit Benjamin Dohne erst für zehn Uhr vereinbart hatte, war ich bereits vier Stunden vorher mit Sonja aufgestanden. Seitdem es uns nur noch im Doppelpack gab, war das gemeinsame Frühstück zu einem selbstverständlichen, uns heiligen Ritual geworden. Diese Morgenstimmung gemeinsam zu genießen wollten wir nicht mehr missen. Alle Optionen, den noch jungen und verheißungsvollen Tag zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, wurden uns auf einem silbernen Tablett angeboten. Wir mussten die Chancen nur wahrnehmen und ergreifen. Der Tag war noch so frisch wie die Brötchen, die ich von meiner Tour mit den Hunden aus unserer Metzgerei mitbrachte. Seitdem der Dorfladen anderen Tante-Emma-Läden ins Sterben gefolgt war, hatte der rührige Metzgermeister mit Unterstützung seiner nicht minder lebhaften Ehefrau sein Sortiment um Backwaren erweitert und hielt natürlich auch die unvermeidliche Bildzeitung parat.
Sonja verließ das Haus in der Regel gegen viertel vor acht. Sie benötigte maximal zwanzig Minuten bis zu dem Gymnasium am Römerkastell in Alzey, wo sie Mathematik unterrichtete. Jetzt aber saßen wir erst einmal bei unserem Frühstück, schauten uns in Erinnerung an die vergangene Nacht verliebt an und besprachen schließlich den heutigen Tag. Für abends hatten wir uns mit Dagmar und Heribert zum Essen im Weingut Nehmert in Siefersheim verabredet. Heidi Nehmert hatte einen Abend unter das Motto Elsass trifft Rheinhessen gestellt. Die Ankündigung versprach eine Komposition aus elsässer und rheinhessischen Spezialitäten.
Die Aussicht auf einen schönen Abend mit lieben Freunden ließ uns die Hürde der eintönigen Alltagsroutine beschwingt nehmen. Sonja hatte einen langen Schultag vor sich und verabschiedete sich bis zum späten Nachmittag. Ich begab mich in die Kanzlei.
Irene Dengler war wieder von ihrem Fortbildungsseminar zurück und grinste mich fröhlich an. Sie hatte bereits ein intensivesGespräch mit Frau Neubert geführt, war sich aber nicht sicher, ob es erfolgreich war. „Sie scheint Angst zu haben, einen Fehler zu machen”, sagte sie.
„Sie muss schnellstens erkennen, dass wir nur aus Fehlern lernen und uns verbessern können”, knurrte ich.
„Überleg, wie lange es bei dir gedauert hat.” Irene drehte sich demonstrativ in ihrem Bürostuhl zu mir um, blickte mich an und gab sich dann die Antwort selbst. „Fünf Jahre hast du gebraucht, Darius. Also sei ein wenig gnädig.”
„Carlo hat dir gesagt, dass ich vorhabe, Ende des Jahres hier aufzuhören?”
„Vorhabe? Höre ich da etwa einen hypothetischen Konditionalis, mit dem du dir wie üblich ein Hintertürchen offen lässt? Du hast nicht vor, sondern Du wirst! Der Satz lautet daher grammatikalisch korrekt: Ich werde Endes des Jahres hier aufhören.”
„Wie sprechen Sie denn mit Ihrem Chef, Frau Dengler!” Ich gab mir Mühe, ein strenges Gesicht zu machen.
„Chef? Das war einmal. Du bist bestenfalls ein Kollege.”
„Ich hasse Frauen, die nicht nur grammatikalisch geschult sind, sondern auch noch mit ihren Spitzfindigkeiten stets ins Schwarze treffen.”
„Dann lass dich scheiden! Aber das wirst du nicht. Denn genau das liebst du nämlich an deiner Sonja. Du willst es gar nicht anders, weil du es brauchst – gib es doch zu.”
„Einen Teufel werde ich tun”, murmelte ich und verschwand in mein Büro.
Inzwischen hatte ich eine gewisse Routine entwickelt, mich von jetzt auf gleich auf unbestimmte Zeit aus der Kanzlei auszuklinken. Die Mitarbeiter waren im Laufe der Jahre an Delegation gewöhnt und schließlich war ja Carlo auch noch da. Hätte ich den Mut, loszulassen und abzugeben, schon vor Jahren aufgebracht, mir wäre vieles erspart geblieben. Bei den Recherchen nach Renates Verbleib dürften allerdings keine Reisen anstehen, was die Organisation meiner punktuellen Abwesenheit noch erleichterte.
Ich verzichtete auf das Auto und war in knapp zehn Minuten zu Fuß durch Bernheim am Ortsrand angelangt. Dort, an der Straße, die über Neu-Bamberg nach Bad Kreuznach führte, lag das Weingut Preuß & Erben. Das imposante Anwesen ließ schon von weitem die ungewöhnliche Größe des Betriebes erkennen. An der linken Straßenfront reihten sich auf einer Länge von etwa 200 Metern das Wohngebäude aus beigefarbenem Sandstein, die Produktionshalle und das Auslieferungslager für die Flaschenweine. Die Hallen waren von wildem Wein bewachsen, der das öde Bild einer profanen Weinfabrik abmilderte.
Von der Straße weg erstreckte sich das Areal über circa 30 Meter, bis es an den ersten Wingert, wie man hier die Weingärten nennt, anschloss. Ich hatte von Gertrud erfahren, dass 65 Hektar unterschiedlicher Weinsorten in der näheren Umgebung von Bernheim bewirtschaftet wurden. Trotz des Einsatzes von Vollerntern arbeiteten während der Hauptsaison, neben den auf dem Gut lebenden Familienmitgliedern und zwei Auszubildenden, bis zu fünfzehn Erntehelfer im Betrieb mit. Seit dem Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks kamen sie zumeist aus Polen und Rumänien. Davor hatte man neben deutschstämmigen Polen auch deutschstämmige Russen, Ungarn und Tschechen beschäftigt. Für ihre Unterkunft standen auf der gegenüberliegenden Straßenseite – von hohen Hecken umgeben – Wohncontainer zur Verfügung.
Als sie zu Anfang der 90er Jahre aufgestellt worden waren, gab es einen heftigen Streit zwischen dem Gemeinderat und Johann Preuß, weil sie in ihrer Überdimensionierung und funktionalen Plumpheit die Identität des Dorfbildes empfindlich störten. Zu seinen Gunsten führte er damals an, dass die Wohneinheiten deshalb so großzügig ausgelegt waren, damit die Erntehelfer abwechselnd ihre Familienangehörigen für einige Wochen zu Besuch nach Bernheim holen konnten. Er beauftragte sogar auf seine Kosten ein Busunternehmen für deren Hin- und Rückfahrt.
Einerseits erkannte man sein soziales Engagement an, andererseits waren Orts- und Verbandsgemeindebürgermeister gehalten,ein Mindestmaß an ästhetischem Anspruch im Interesse der Bürger durchzusetzen. Während sie dies auf dem formalen Dienstweg angingen, war zu erkennen, dass die Kontakte von Johann Preuß bis in die höchsten Ebenen der Landesregierung reichten. Alles was an politischen Knüppeln aufzubieten war, wurde der Kreisverwaltung und dem Gemeinderat zwischen die Beine geworfen. Selbst vor persönlichen Diffamierungen und Repressalien machte man nicht halt.
Peter König, eines der Ratsmitglieder, der sich als grüner Politiker besonders engagiert einschaltete, verlor durch eine kurze und intensive Schmutzkampagne seinen Arbeitsplatz. Es waren Fotos in der Öffentlichkeit aufgetaucht, die ihn in einer unmissverständlichen Situation mit einer polnischen Haushaltshilfe zeigten. Peter König bestritt, jemals einen derartigen Kontakt gehabt zu haben, und beteuerte, weder die Frau zu kennen noch etwas von der Situation, in der die Aufnahmen gemacht worden waren, zu wissen. Aber die Fotos ließen sich nicht widerlegen. Eine Gegenüberstellung mit der Polin, die er verzweifelt forderte, war nicht mehr möglich, da sie mit unbekannter Adresse bereits wieder in ihre Heimat zurückgekehrt war. Obwohl der damalige Bürgermeister zu ihm stand, legte er daraufhin seine Funktion im Gemeinderat nieder. Als sich dann auch noch seine Frau von ihm trennte, nahm er sich in seiner Garage das Leben. Mit einem Gartenschlauch hatte er Autoabgase in seinen Wagen geleitet.
Erst als 1994 die Verschandelung des Dorfeingangs der breiteren Öffentlichkeit durch eine Bürgerinitiative publik gemacht wurde, lenkte Johann Preuß ein und ließ die Hecken pflanzen. Er reagierte stets allergisch gegen alles, was Aufsehen erregen und einen Schatten auf den Namen Preuß werfen konnte. Außerdem, so wurde gemunkelt, sollte sogar Ministerpräsident Kurt Beck, der damals gerade Rudolf Scharping abgelöst hatte, als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Machtwort gesprochen und einige Staatssekretäre in den Senkel gestellt haben.
Das überdimensionale, zweiflüglige Tor zum Innenhof war geöffnet und ließ bereits von außen einen Blick auf das imponierende Areal zu. Die Bodenfläche des Hofes war betoniert. Die alten Kopfsteine, die erst die authentische Atmosphäre eines rheinhessischen Hofes ausmachten, hatte man wohl schon vor Jahren herausgerissen. Stillos, dachte ich, hier hatte mal wieder ein Verschandelungsspezialist gründliche Arbeit im Kaputtsanieren geleistet.
Zwei Gastarbeiter waren damit beschäftigt mit einem Kärcher Holztische, Stühle und Bänke vom Winterstaub zu befreien. Während sie sichtlich Spaß daran hatten, den Hochdruckreiniger zweckzuentfremden, indem sie mit dem Wasserstrahl einen Plastikball über den Hof trieben, widmete sich ein dritter der Aufgabe, die bereits gereinigten Möbel mit Holzschutzlasur witterungsbeständig zu machen. Sie würdigten mich keines Blickes.
Zur Rechten erblickte ich die Glasfront des Hofladens aus dem ein etwa 30-jähriger Mann trat. Mit fast weißblondem, langem und zu einem Pferdeschwanz gebundenen, Haar und seiner muskulösen, durchtrainierten Gestalt, gab er ein stattliches Bild ab. Das wurde auch nicht dadurch geschmälert, dass er einen guten Kopf kleiner war als ich. Ich kannte ihn vom Sehen. Renate hatte, zumindest was die Optik betraf, eine gute Wahl getroffen. Er nickte mir kurz zu, ohne eine Miene zu verziehen, und herrschte dann die drei Arbeiter an: „Hört auf mit dem Mist. Und du, pass auf, dass keine Farbe runtertropft. Ich hatte dir doch gesagt, dass du etwas unterlegen sollst. Die Farbe bekommst du doch vom Boden nie mehr weg.”
Die Arbeiter nickten kurz. Die Wasserspiele wurden mit erkennbarem Unverständnis eingestellt und ihr Kollege entfernte sich in meiner Richtung, wobei er etwas murmelte, was wie dupa klang. Während seine Landsleute sich mühsam ein Grinsen verkniffen, hatte sein Chef die Beleidigung anscheinend nicht mitbekommen. Vielleicht wollte er sie auch nur überhören, um nicht in meinem Beisein einen Streit vom Zaun brechen zu müssen. Aus den Zeiten,als ich auf meinem Hof einen polnischen Maurer für Sanierungsarbeiten beschäftigt hatte, waren mir ein paar polnische Sprachbrocken geläufig und dupa gehörte dazu. Es bezeichnet in deftigem Gassenjargon den verlängerten Rücken eines Menschen, klingt aber, wie ich meine, bedeutend poetischer, als das deutsche Pendant und weniger barsch. Obwohl es sich trefflich darauf reimt.
„Guten Morgen! Ich bin Benjamin Dohne”, stellte sich der blonde Mann vor. „Sie müssen Herr Schäfer sein. Sie wollen also versuchen, Renates Aufenthaltsort zu ermitteln?” In seiner Stimme schwangen Zweifel mit. „Ich weiß zwar, dass Sie bereits einige Fälle gelöst haben, aber schließlich sind Sie Steuerberater und kein Kriminalbeamter. Man sollte bei seinen Leisten bleiben. Ich bin Winzer und würde mich ja auch nicht als Herrgottsschnitzer versuchen.”
„Wenn Sie aber eine Begabung dafür hätten?” Er stutzte kurz und ich fand, im offensichtlichen Gegensatz zu ihm, meine Antwort ausgesprochen passend, ja geradezu genial. Zu meinem Bedauern ging er nicht darauf ein.
„Außerdem liegt der Fall hier ja wohl anders.”
„Inwiefern?”
„Renate ist aus freien Stücken weggegangen und ich bin sicher, dass sie bald wieder zurückkommt, wenn sie wieder bei Verstand ist.”
„Ihre Mutter ist dennoch sehr besorgt. Und auf ihre ausdrückliche Bitte hin bin ich hier.”
„Gertrud”, es klang sehr geringschätzig, „die wird schnell hysterisch. Außerdem hat sie sich nie damit auseinandergesetzt, ihr Leben zu führen, ohne Renate immer griffbereit um sich zu haben.”
Die letzte Einschätzung teilte ich, ohne ihn das jedoch wissen zu lassen.
„Aber wir sollten uns im Haus weiter unterhalten. Der Hof ist nicht gerade der geeignete Ort für unser Gespräch.”
Er wies mit der Hand auf das mehrgeschossige Wohngebäude.
„Hier wohnt die ganze Familie”, erklärte er. „Mein Großvater hat die Wohnung im Erdgeschoss. Dieses Jahr sind es zwanzig Jahre, dass er im Rollstuhl sitzt. Er ist querschnittgelähmt, durch einen Unfall. Seitdem führt Mama den Betrieb. Sie wohnt mit meinem Vater im zweiten Stock und darüber, im ausgebauten Dachgeschoss, lebt Andreas, mein älterer Bruder, mit meiner Schwägerin Marlies.”
„Und wo wohnt Herr Zerfass?”
Er sah mich irritiert an. „Klaus? Der hat ein Appartement über den alten Gewölbekellern.” Dabei verzog er sein Gesicht geringschätzig. Er deutete auf einen Gebäudeteil im Hintergrund des Hofes, der noch aus den Gründungszeiten des Weingutes stammen musste. Die Fragen, die sich eigentlich aufgedrängt hätten – weshalb ich das wissen wolle und was mich unter Umständen mit Zerfass verband – stellte er interessanterweise nicht.
Mittlerweile waren wir in der Wohnung angelangt, aus der Renate vor vierzehn Tagen ausgezogen war. Am Ende eines großzügigen Flurs betraten wir das Wohnzimmer. Der etwa zwanzig Quadratmeter große, rechteckig geschnittene Raum zog sich parallel zur Straße hin. Durch die fünf zweiflügligen Sprossenfenster mit bräunlich getönten Scheiben wurde er in ein warmes Licht getaucht. Wir ließen uns an einem Esstisch nieder, um den sechs Stühle gruppiert waren.
Durch eine weitere Tür war der Raum mit der Küche verbunden, wie ich durch einen Spalt erkennen konnte, bevor ich mich mit dem Rücken dazu setzte. Daneben stand ein überdimensionaler LCD-Fernseher. Auf der Anrichte hinter der Essgruppe waren neben einem Foto von Renate, das sie in Polizeiuniform zeigte, wahllos Bücher gestapelt. Einige Buchrücken konnte ich entziffern: Galgenlieder von Christian Morgenstern, Der Doppelmord an Uwe Barschel und Die größten Flops der Wirtschaftsgeschichte.
„Renates Bücher”, meinte Benjamin Dohne erklären zu müssen, als er meinem Blick folgte. „Ich lese so etwas nicht.” Dann besann er sich auf seine Gastgeberrolle und bot mir etwas zu trinken an.
„Herr Dohne”, begann ich, nachdem ich dankend abgelehnt hatte, „ich kann verstehen, wenn Sie mir mit gemischten Gefühlen gegenüber sitzen. Schließlich mische ich mich in Ihre Privatangelegenheiten ein. Aber ich kenne Renate und Ihre Schwiegermutter seit …”
Er unterbrach mich mit einer unwirschen Handbewegung. „Geschenkt, Herr Schäfer. Gertrud hat mich schon ausreichend darüber informiert. Außerdem hatten Sie ja gestern schon das Vergnügen mit meiner Tante Marga. Da muss ich wohl die Sache aus meiner Sicht, nämlich der richtigen, darlegen. Sie werden mir aber gestatten, es ohne Ausschmückungen, quasi im Zeitraffer zu schildern. Ich habe noch zu tun.”
Mit einer Geste forderte ich ihn auf zu beginnen. In leierndem, gelangweiltem Tonfall, so, als ob er sie zum hundertsten Mal erzählen würde, spulte er seine Version der Ereignisse ab. Seine Darstellung entsprach exakt dem, was Heribert und ich schon von Gertrud gehört und was Marga Preuß präzisiert hatte. Danach beugte er sich über den Tisch und blickte mich herausfordernd an.
„Zufrieden?”
Ich antwortete nicht auf die knappe Frage – oder sollte es eine provokante Feststellung sein? Ich war mir nicht im Klaren darüber, was er empfand und dachte.
Statt auf sein Verhalten zu reagieren, entging ich der Gefahr, genau das Falsche zu sagen mit einer neutral klingenden Gegenfrage. „Was haben Sie, außer bei Ihrer Tante und Ihrer Schwiegermutter anzurufen, unternommen, um Ihre Frau zu finden?” Ich vermied jetzt auch bewusst, sie beim Vornamen zu nennen, um eine Abgrenzung zu suggerieren.
„Nichts, was hätte ich denn tun sollen?”
„Eine Vermisstenanzeige bei der Polizei?”, schlug ich vor.
„Wir wollten kein Aufsehen erregen. Man sagt uns schon genug nach, da müssen wir nicht für weiteres Futter für den Dorftratsch sorgen. Es liegt ja auch bisher kein Grund vor, sie offiziell suchen zu lassen. Unser Anwalt hat uns auch darüber informiert, dass diePolizei in diesem Fall nichts unternehmen würde. Er hat uns allerdings eine Privatdetektei empfohlen. Aber Gertrud wollte davon nichts wissen. Stattdessen hat sie ja mit Ihnen Kontakt aufgenommen. Und außerdem …” Er sprach nicht weiter und erhob sich stattdessen.
„Ja?”
„Sie soll sich ruhig abreagieren, dann wird sie schon wieder angekrochen kommen. Da bin ich ganz sicher. Geld hat sie ja leider genug auf ihrem Konto. Seine Lebensversicherung hatte ihr Vater auf sie abgeschlossen. Damit kommt sie jahrelang aus. Wenn sie das nicht hätte, würde sie bestimmt schneller wieder vor der Tür stehen.” Sein Tonfall war ins Gehässige abgeglitten, aber seinem Gesichtsausdruck war zu entnehmen, dass er sich zutiefst verletzt, in seiner Ehre getroffen fühlte.
Bankkonto, fiel mir ein. „Können Sie sehen, wann und wofür etwas von ihrem Konto abgebucht wird?”
„Nein.”
„Keine Bankauszüge, die monatlich mit der Post kommen?”
„Sie wickelt schon seit Jahren alles per Onlinebanking ab. Da habe ich keinen Zugriff drauf, da ich ihren PIN-Code nicht kenne.”
„Meinen Sie, Ihre Frau hat ihn irgendwo hier in der Wohnung hinterlegt?”
„Da habe ich auch schon dran gedacht und danach gesucht, sogar ihre Schreibtischschubladen habe ich aufgebrochen. Aber nichts, kein Hinweis.”
Es wäre auch zu schön gewesen, aber es hätte mich auch gewundert, denn so unvorsichtig war Renate nicht. Also setzte ich dort wieder an, wo ich den Fragestrang zuvor unterbrochen hatte.
„Was hat Ihre Frau denn eigentlich so in Harnisch gebracht?”
„Was meinen Sie damit?”
„Ich würde gerne wissen, was geschehen ist, dass sie sich, wie Sie eben sagten, abreagieren muss.”
„Das ist eine längere Geschichte und gehört nicht hierher.”
„Ich finde schon, dass das hierher gehört, Benjamin!”, hörte ichhinter mir eine Frauenstimme, die sich mit freundlichem Ton einschaltete. Ohne, dass ich es bemerkt hatte, war Gerlinde Dohne aus der Küche zu uns getreten. Offensichtlich hatte sie von dort aus unser Gespräch mitverfolgt, sich aber bisher nicht gerührt. Sie reichte mir die Hand und setzte sich unaufgefordert mir gegenüber an den Tisch.
Sie war in meinem Alter und strahlte, trotz des oberflächlich guten ersten Eindrucks, eine derartige Kälte aus, dass ich meinte, die gefühlte Temperatur im Raum sei im Moment ihres Eintretens um mindestens zehn Grad gefallen. Dabei war sie recht attraktiv. Ihre dunkelbraunen Haare hatte sie hochgesteckt und mit einer großen, geschmackvollen Haarklammer befestigt. Sie trug beigefarbene Jeans und eine hellgrüne Bluse, die beide wie angegossen saßen und ihre straffe, weibliche Figur betonten. Ihre Garderobe hatte sie bestimmt nicht bei C & A gekauft. Das konnte selbst ein Modemuffel wie ich erkennen. Alles in allem stellte sie einen auffallenden Kontrast zu ihrer Schwester Marga dar. Man wunderte sich ja immer wieder, zu welch unterschiedlichen Ergebnissen die Gene führen konnten, trotz gleicher Voraussetzungen.
Was mich nämlich innerhalb kurzer Zeit zur Vorsicht und Zurückhaltung gegenüber Gerlinde Dohne mahnte, waren ihre Augen. Selten hatte ich ein so strahlendes und kräftiges Grün gesehen, das eigentlich dazu angetan sein sollte, ein Gegenüber zu faszinieren und einzunehmen. Doch dieser Effekt wurde in das Gegenteil verkehrt durch ihren unsteten Blick. Die Pupillen wanderten in beunruhigendem Maße, ohne erkennbare Motivation, im Raum umher. Offenbar war sie kurzsichtig. Immer wieder kniff sie die Augen zusammen und die Stärke ihrer Kontaktlinsen, denn nur so war das Farbwunder zu erklären, schien nicht mehr auszureichen. Die Vorurteilsschublade, die sich in meinem Gehirn öffnete, trug die Aufschrift: kaltes, berechnendes, egozentrisches, herrschsüchtiges und geldgeiles Weib.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.