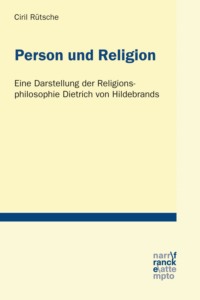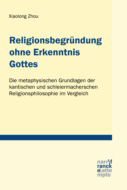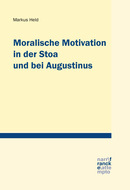Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 19
III DER MENSCH UND SEIN ANGELEGTSEIN AUF DIE RELIGION IN DENKEN, FÜHLEN UND WOLLEN
Bei der BegründungBegründung der Vernünftigkeit der ReligionReligion geht es nicht alleine um die Begründung der realen ExistenzExistenz ihres Bezugspunktes, nämlich um die Begründung der notwendigen Existenz Gottes. Die Begründung der Vernünftigkeit der Religion steht und fällt darüber hinaus vor allem mit der Begründung des lebendigen Verhältnisses des Menschen mit GottGott, des „Zwiegesprächs zwischen Geschöpf und Schöpfer“19. Wie aber soll das Bestehen dieses Verhältnisses in vernünftiger Weise nachgewiesen werden? Auch wenn die Existenz Gottes – wie sich gezeigt hat – absolut gewiss ist, wie will man wissen, ob der begrenzte und kontingente MenschMensch überhaupt die Fähigkeit besitzt, um mit der absoluten PersonPerson in ein Verhältnis zu treten? Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es im Anschluss an die Beschäftigung mit dem WesenWesen Gottes in erster Linie der Herausarbeitung der zentralen Wesensmerkmale der geistigen Person des Menschen.
1 AugustinusAugustinus, BoethiusBoethius, LockeLockeJohn, die Annäherung an das WesenWesen der PersonPerson1 und die Frage nach der unübersteigbaren VollkommenheitVollkommenheit des Personseins
Ausgehend vom Glauben an die trinitarische Struktur des göttlichen Wesens, den die griechischen Kirchenväter in die Formel μίαν οὐσίαν τρεῖς ὑποστάσεις fassten und im lateinischen Westen durch Tertullians Übersetzung von ὐποστάσεις mit persona in die Formel una substantia, tres personae mündete, sah AugustinusAugustinus sich mit terminologischen Ungereimtheiten konfrontiert. So wisse er nicht, wo der Unterschied liege zwischen οὐσίαν und ὑπόστασιν, da die griechische Formel μίαν οὐσίαν τρεῖς ὑποστάσεις doch eigentlich mit una essentia, tres substantiae zu übersetzen wäre.2 Wenn von drei Personen gesprochen werde, so Augustinus die terminologischen Differenzen resümierend, dann nicht um den SachverhaltSachverhalt angemessen auszudrücken, sondern um nicht zu schweigen.3 Trotz dieser Schwierigkeiten, hob Augustinus den BegriffBegriff der PersonPerson so ins allgemeine BewusstseinBewusstsein, dass der MenschMensch nur in Bezug auf seinen GeistGeist eine Person sei4 und er den Geist als eine Dreieinheit mit einer intentionalen Struktur der Selbst- und Fremdbeziehung definierte. Und nur wenn das Dasein über diese intentionale Struktur verfügt, handelt es sich um eine Person.
Die mit AugustinusAugustinus’ PersonPerson-DefinitionDefinition verbundenen begrifflichen Schwierigkeiten – in Verbindung mit einer christologischen Fragestellung – veranlassten BoethiusBoethius zu einem weiteren Durchdenken des Personbegriffs unter Rückgriff auf die aristotelische Philosophie. Die Ergebnisse seines Bemühens hat er in der kleinen Schrift Contra Euthychen et Nestorium schriftlich fixiert, welcher als V. Traktat der Opuscula sacra eine entscheidende Bedeutung für die mittelalterliche Definition des Personbegriffs zukommt.
Aufgrund der Offensichtlichkeit, dass der PersonPerson die NaturNatur zugrunde liegt und sie nicht ausserhalb von ihr ausgesagt werden kann, geht BoethiusBoethius von den verschiedenen Bedeutungen von Natur (natura) aus, welche auf dreierlei Weisen ausgesagt und definiert werden könne. Erstens hätten die Dinge Natur, „die auf gewisse Weise von der VernunftVernunft erfasst werden können, weil sie sind“5; wonach die DefinitionDefinition von Natur sowohl Akzidentien als auch Substanzen beinhaltet. Zweitens sei Natur, „was tätig sein kann oder was erleiden kann“6. Da nach AristotelesAristoteles nur Substanzen das Prinzip der Bewegung sind, definiert Boethius die Natur konsequenterweise als „Prinzip der Bewegung aus sich heraus, nicht beiläufig“7. Drittens bezeichnet natura „die ein jedes Ding bestimmende spezifische Differenz“8.
Da die PersonPerson nun nicht ausserhalb der NaturNatur, sie aber nicht den Akzidentien zuzurechnen ist, wird Person als in den Substanzen seiend ausgesagt. Die Substanzen scheidet er in unkörperliche und körperliche, die körperlichen in nicht lebende und lebende, die lebenden in nicht mit Sinnen begabte und mit Sinnen begabte, die mit Sinnen begabten in unvernünftige und vernünftige, die vernünftigen in unveränderliche und des Leidens nicht fähige und in veränderliche und des Leidens fähige. „Aus all dem wird offensichtlich, dass sich Person weder als in leblosen Körpern seiend aussagen lässt […] noch als in den Lebenden seiend, die der Sinne entbehren […] noch von dem, welchem VernunftVernunft und VerstandVerstand fehlen“9.
Von den Substanzen, wie BoethiusBoethius seine Gedankenfolge weiterführt, sind die einen universal, die anderen partikulär. Universal sind z.B. MenschMensch, SteinSteinEdith oder Holz, schlicht alles, was entweder Genus oder Spezies ist und von einzelnen Menschen, Steinen oder Hölzern ausgesagt wird. Partikulär bezieht sich dagegen auf das, was von anderem nicht ausgesagt werden kann, wie z.B. SokratesSokrates, dieser SteinSteinEdith oder dieses Holz, aus dem dieser Tisch gefertigt wurde. In diesem Sinne kann PersonPerson nicht als im Universalen seiend ausgesagt werden, sondern nur in den Individuen und im Einzelnen.
„Wenn folglich PersonPerson nur in Substanzen und zwar in vernünftigen ist, wenn jede SubstanzSubstanz NaturNatur ist und nicht im Universalen, sondern im Individuellen ihren Bestand hat, ist die DefinitionDefinition der Person gefunden: ‚Einer verständigen Natur unteilbare Substanz‘ [naturae rationabilis individua substantia].“10 Damit sei bestimmt, was die Griechen ὑπόστασις nennen würden. BoethiusBoethius hat den BegriffBegriff der Person jedenfalls einer wesentlichen Klärung zugeführt, indem er einige notwendige Eigenschaften der Person eindeutig bezeichnete.
Wenn im neuzeitlichen Sinne von der PersonPerson die Rede ist, dann muss unweigerlich die Grundlegung des modernen Personbegriffs durch John LockeLockeJohn berücksichtigt werden. LockeLockeJohn distanziert sich vom substanzorientierten Personbegriff des BoethiusBoethius,11 indem er dafür argumentiert, dass nicht die SubstanzSubstanz die IdentitätIdentität der Person begründe, sondern das BewusstseinBewusstsein. Nur das Bewusstsein vermöge die vergangenen und die zukünftigen Ereignisse zu einer Person zu verbinden.12 „Denn soweit ein vernunftbegabtes WesenWesen die Idee einer vergangenen Handlung mit demselben Bewusstsein, das es zuerst von ihr hatte, und mit demselben Bewusstsein, das es von einer gegenwärtigen Handlung hat, wiederholen kann, ebenso weit ist es dasselbe persönliche Ich.“13 Die Substanz dagegen, an der das persönliche Selbst zu einer bestimmten Zeit haftete, könne sich ändern, ohne dass die Person ihre Identität verliert, wie z.B. beim Verlust der Glieder.14
Im ZentrumZentrum von Lockes Theorie steht die personale IdentitätIdentität über die Zeit hinweg. Diese liegt ihm darin begründet, dass ein WesenWesen, das sich sowohl der gegenwärtigen wie der vergangenen HandlungenHandlungen bewusst ist, dieselbe PersonPerson ist, die beide Handlungen initiierte. So könne die Identität nicht in etwas anderem als in dem BewusstseinBewusstsein gesucht werden. Das identische Bewusstsein ist dann aber auch der Grund des Selbst.15 Nicht die identische numerische SubstanzSubstanz, sondern das fortgesetzte Bewusstsein ist das, was das Selbst ausmacht.16 Dieses Selbst wiederum ist das, was LockeLockeJohn als Person bezeichnet.17
Seine Bestimmung des Bewusstseins als eines Wesensmerkmals der PersonPerson ist allerdings problematisch. Denn wohl ist die Person angelegt auf BewusstseinBewusstsein, auf Entfaltung im bewussten Leben, doch wenn LockeLockeJohn die Potenz zum Bewusstsein auf rein metaphysischer Ebene, die nicht immer im Leben verwirklicht ist, zur Bedingung des Personseins erklärt, dann wären der Embryo oder der im Koma liegende Patient, dessen Bewusstlosigkeit durch keine äusseren Reize unterbrochen wird noch werden kann, keine Personen mehr. Das Bewusstsein zur Bedingung des Personseins zu erklären, erweist sich von diesem Einwand her als reduktionistische Isolierung eines Einzelelementes, welches generalisiert, im selben Zuge aber die Verflechtung mit dem Ganzen übersehen bzw. ignoriert wird. Angemessener, weil holistischerholistisch, nimmt sich dagegen die seins- bzw. substanzmässige BegründungBegründung des Personseins aus. Wird die transpersonale IdentitätIdentität der Person in einem substanzorientierten Sinne verstanden, liegt sie auf einer Linie mit von Hildebrands phänomenologischer Theorie der KontinuitätKontinuität – mit dem „Sich-als-ein-und-derselbe-WissenWissen im Ablaufe der Zeit und der mit den verschiedensten Inhalten erfüllten Augenblicke“ –, welche er zu einem „der tiefsten Wesensmerkmale des Menschen als geistiger Person“ erklärt.18
Und wenn Blaise PascalPascalBlaise die metaphysische Existenzweise der PersonPerson mit dem denkenden Schilfrohr in Worte zu fassen suchte, das weiss, dass es stirbt, währenddem das ganze Weltall davon nichts weiss,19 so stellt sich aufgrund der bereits entfalteten Theorie der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten20 die Frage, ob auch das PersonseinPersonsein eine reine VollkommenheitVollkommenheit ist. Dem scheint zweierlei zu widersprechen. Erstens sind die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten irreduzibel einfachirreduzibel einfach (simpliciter simplex), und wenn das Personsein eine reine Vollkommenheit ist, dann muss auch das Personsein irreduzibel einfachirreduzibel einfach sein. Das widerspricht jedoch dem individuellen personalen Sein. Ein allgemeines WesenWesen der Person wäre ebenso wenig Person wie eine Idee oder ein eidos. Folglich ist das Personsein keine reine Vollkommenheit. Zweitens mag das Personsein eine reine Vollkommenheit hinsichtlich des Individuumseins und des Besitzes einer haecceitas sein.21 Aber es kann keine reine Vollkommenheit sein, diese individuelle Person anstelle einer anderen zu sein. Denn wäre meine individuelle Person eine reine Vollkommenheit, dann wäre sie zu sein absolut besser als das Peter-Müller-, das Sonja Hasler- oder jedes andere Person-X-Sein. Doch das ist widersprüchlich.
Handelt es sich beim PersonseinPersonsein also tatsächlich nicht um eine reine VollkommenheitVollkommenheit? Für eine philosophische Gotteslehre hätte dies auf den ersten Blick zur Folge, dass GottGott keine PersonPerson sein kann. Wenn es als gesichert betrachtet wird, dass die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten nicht nur in Gott wirklich sind, sondern dieser die reinen Vollkommenheit selbst ist, dann scheint es unausweichlich, Gott das Personsein abzusprechen. Denn wenn Gott die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten selbst ist, das Personsein aufgrund des nicht irreduzibel einfachen Seins aber keine reine Vollkommenheit sein kann, ergibt sich in logischer Folge, dass Gott keine Person sein kann. Diese Schwierigkeiten gehen in der Tat sehr tief und erwecken den Anschein, als ob sich entweder in der Theorie der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten ein Fehler verbergen müsse oder aber die Person nicht auf einer solch unüberbietbaren Höhe über allen nichtpersonalen Entitäten steht. Wenngleich es mysteriös anmutet, so aber scheint es doch, als gehöre zur reinen Vollkommenheit des Personseins immer eine einmalige IdentitätIdentität, als impliziere der Besitz der reinen Vollkommenheit des Personseins immer den Besitz von etwas, das keine reine, sondern eine gemischte Vollkommenheitgemischte Vollkommenheit ist.
Der Klärung rückt man ein wesentliches Stück näher, wenn sowohl die Dimension der TranszendenzTranszendenz der Einzelperson als auch die GemeinschaftGemeinschaft unter den Personen ins Auge gefasst wird. Es liegt im WesenWesen der PersonPerson, zur vollen Teilnahme am Wohlergehen der Anderen aufgerufen zu sein. Die Person lebt in der Welt nicht als isolierte SubstanzSubstanz, sondern über sich selbst hinausschreitend, nimmt sie am Leben der anderen Personen teil. Dieses gemeinsame Leben von Personen kulminiert in der Idee der perfekten Gemeinschaft, in der die Begrenzungen des individuellen Personseins in gewisser Weise überschritten und in ihren Wert gesetzt werden. Um keinen Aspekt der WirklichkeitWirklichkeit ausser Acht zu lassen, von dem ein Hinweis zur Lösung des vorliegenden Problems zu erhoffen ist, sei schliesslich noch ein theologisches ArgumentArgument beigebracht. Existierte nur eine göttliche Person, so der Ausgangspunkt, wie dies etwa die jüdische ReligionReligion lehrt, dann könnte diese spezifische IdentitätIdentität eine reine VollkommenheitVollkommenheit sein. Wenn aber GottGott, wie die Christen glauben, drei verschiedene Personen ist, dann kann die individuelle Identität einer jeden göttlichen Person keine reine Vollkommenheit sein. Weil in diesem Fall auch die Personen der Dreifaltigkeit einer reinen Vollkommenheit ermangeln würden, denn wenn das Vatersein eine reine Vollkommenheit wäre, dann wäre das Vatersein absolut besser als das Nicht-Vater-Sein; dem Sohn und dem Heiligen GeistGeist würde diese reine Vollkommenheit aber nicht zukommen, ihnen würde also zumindest eine reine Vollkommenheit fehlen. Was der Trinitätstheologie als gesichert gilt, ist auch seitens der Philosophie zu erkennen, dass es nämlich keine reine Vollkommenheit sein kann, diese bestimmte Person anstelle einer anderen Person zu sein.
So lässt sich abschliessend festhalten, dass das UrteilUrteil „Das PersonseinPersonsein ist eine reine VollkommenheitVollkommenheit!“ weder gegen die angeführten Wesenscharakteristika der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten verstösst noch die PersonPerson der unüberbietbaren Höhe beraubt, die sie gegenüber allen nichtpersonalen Entitäten einnimmt. Und zwar gelingt dies – wie gesehen – unter der Voraussetzung, dass die reine Vollkommenheit des Personseins auf die unverletzliche und unveräusserliche IndividualitätIndividualität beschränkt wird, währenddem es keine reine Vollkommenheit ist, diese bestimmte Person anstelle einer anderen zu sein.22
Wenn in der Folge die TheseThese zu begründen gesucht wird, dass der MenschMensch auf die ReligionReligion angelegt ist, indem er mit Denken, Fühlen und Wollen die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, um einen Dialog mit der absoluten PersonPerson führen zu können, so sei zuerst eine Stelle aus dem Oeuvre von Hildebrands zitiert, in der er die wesentlichsten Merkmale der geistigen Person in kurzer und prägnanter Weise zur Sprache bringt. Daraufhin werden die genannten Kräfte des Denkens, Fühlens und Wollens analysiert. Wobei das Denken nicht mehr eigens untersucht werden wird, da es weiter oben bereits unter dem Titel des Erkennens auseinandergesetzt wurde (vgl. Abschnitt I). Der folgende Text möge weiter in die Thematik einführen:
Die geistige PersonPerson stellt eine noch vollkommenere FormForm des Seienden dar [als das Reich der Lebewesen]: ein vernünftiges WesenWesen mit der Fähigkeit, sich und die Welt zu erkennen, eine sinnvolle AntwortAntworttheoretische auf das wahrgenommene Objekt zu geben und frei nach eigenem WillenWillen zu entscheiden; ein Wesen, das VerantwortungVerantwortung besitzt, fähig ist, Träger sittlicher WerteWerte zu sein und mit anderen Personen in GemeinschaftGemeinschaft zu treten.23
2 Das Zusammenwirken und gegenseitige Befruchten von VernunftVernunft, Wille und Herz und das geistig-intentionale affektive Leben der PersonPerson
Wohl ist das ErkennenErkennen einer der tiefsten Wesenszüge der geistigen PersonPerson,1 doch ist es recht besehen eine Trias von geistigen Zentren, die im Menschen besteht: „VernunftVernunft, Wille und Herz (GefühlGefühl), die bestimmt sind zusammenzuwirken und einander zu befruchten“2. Vernunft, Wille und Herz sind ihm die „drei grundlegenden Zentren“, die „drei fundamentalen Fähigkeiten oder Wurzeln im Menschen“.3 Von HildebrandHildebrandDietrich von war jedoch nicht der erste Denker, der im Menschen verschiedene Vermögen oder Kräfte unterschied. Das tat – noch vor AugustinusAugustinus – bereits PlatonPlaton, indem er zwischen einem vernünftigen (logistikon), einem begehrlichen (epithimitikon) und einem zornmütigen (timoeides) Seelenteil unterschied.4
Von HildebrandHildebrandDietrich von sieht „das Geheimnis der menschlichen PersonPerson“ jedenfalls im Herzen bzw. im GefühlGefühl gelegen, „hier wird ihr innerstes WortWort gesprochen“.5 Der Ausdruck „Gefühl“ ist jedoch – ähnlich wie im Falle des oben besprochenen Begriffs der Erfahrung – alles andere als univok. Das liegt einmal daran, dass das Herz in der Geschichte der Philosophie weitgehend vernachlässigt und der VernunftVernunft und dem WillenWillen untergeordnet wurde. Auszunehmen ist davon aber zumindest Blaise PascalPascalBlaise, der unter anderem sagen konnte: „Das Herz und nicht die Vernunft nimmt GottGott wahr.“6 Auch Sören KierkegaardKierkegaardSören (1813–1855) hat in seinem programmatischen Hauptwerk Entweder-Oder vom Fühlen gesprochen. Er macht die ethische Reifung davon abhängig, ob „die PersönlichkeitPersönlichkeit mit ihrer ganzen Energie die Intensität der Pflicht gefühlt hat“7. „Die Hauptsache ist darum nicht, ob ein MenschMensch an den Fingern herzählen kann, wie viele Pflichten er hat, sondern dass er ein für allemal die Intensität der Pflicht so empfunden hat, dass das BewusstseinBewusstsein davon ihm die GewissheitGewissheit der ewigen Gültigkeit seines Wesens ist.“8
Den Hauptgrund der Diskreditierung des Herzens verortet von HildebrandHildebrandDietrich von „in der Loslösung der affektiven AntwortAntworttheoretische von dem motivierenden Objekt“9. Was sich gerade auch im Bereich der ReligionReligion zeigt. Sobald die religiösen Haltungen nämlich von ihrem Gegenstand abgelöst werden und die Frage nach der ExistenzExistenz Gottes beiseite geschoben und er als „blosses Postulat für den Genuss religiöser Gefühle“ betrachtet wird, „werden die religiösen AntwortenAntworten ihres wahren Sinnes und Gehaltes beraubt“.10 Das gibt zu erkennen, wodurch die Religion zur Unvernünftigkeit degradieren kann, es zeigt aber auch, dass die Vernünftigkeit der Religion ein intentionales, ein gegenstandgerichtetes Gefühlsleben bedingt.11
Zu den bedeutenden philosophischen Taten von Hildebrands ist auch seine Unterscheidung zwischen nichtgeistigen und geistigen Formen der AffektivitätAffektivität zu zählen. In grundlegender Weise differenziert er zwischen leiblichen und psychischen Gefühlen, was er mit dem Unterschied zwischen dem Kopfweh, dem Zahnschmerz, dem Wohlbehagen an einem warmen Bad, dem angenehmen GefühlGefühl des Ausruhens oder der körperlichen Erschöpfung einerseits und dem Kummer über ein tragisches Ereignis, der Lustigkeit oder der Depression andererseits veranschaulicht. Was die leiblichen Gefühle des Menschen betrifft, so haben sie einen anderen Charakter als die der Tiere. Obzwar es keine geistigen sind, sind es dennoch eindeutig personale. Auch wenn gewisse physiologische Vorgänge homolog verlaufen, so verlaufen sie im bewussten Leben des Menschen nichtsdestoweniger von der Wurzel her anders, sind sie doch „in die geheimnisvolle, tiefe Welt einer PersonPerson eingesenkt“ und werden „von diesem identischen Selbst erlebt“.12 Die psychischen Gefühle sind darüber hinaus noch subjektiver, sie „gehen mehr im SubjektSubjekt vor sich als die Körpergefühle“13. Sehr wohl können diese beiden Gefühlsarten koexistieren, so etwa ist der Einfluss der körperlichen Vitalität auf die psychische Stimmung ja geradezu feststellbar.
Von HildebrandHildebrandDietrich von unterscheidet die Gefühle sodann nach ihrer GeistigkeitGeistigkeit. Geistig sind ihm die Gefühle dann, wenn sie intentional sind, wie beispielsweise im Falle des Kummers über ein tragisches Ereignis. Sie sind es dann, wenn ihnen der Charakter einer AntwortAntworttheoretische zukommt, wenn sie in einer sinnvollen und bewussten Beziehung zu einem Gegenstand stehen. Dagegen sind nicht-intentionale Gefühle wie das Kopfweh oder das angenehme GefühlGefühl des Ausruhens spezifisch ungeistig. Zudem „werden psychische Zustände entweder durch körperliche oder psychische Vorgänge ‚verursacht‘, affektive Antwortenaffektive Antworten sind dagegen ‚motiviert‘“14. Doch besitzen nicht alle intentionalen affektiven AntwortenAntworten diese Geistigkeit. Ein Beispiel dafür ist etwa die Wut. Zwar ist die Wut für gewöhnlich motiviert und stellt eine AntwortAntworttheoretische auf etwas ganz Bestimmtes dar, womit sie eigentlich intentionale Züge trägt, doch ist sie trotzdem nicht in jedem Falle geistig. „Wenn sie durch ihre Intensität in ein ‚Den-Kopf-Verlieren‘ ausartet, stellt sie ein radikal Ungeistiges dar. Sie schaltet die VernunftVernunft und auch den klaren WillenWillen aus; sie paralysiert beide.“15 Dann hat sie sogar einen „geist-feindlichen Charakter“16.
Wichtig ist hier vor allem der Wesensunterschied zwischen den geistigen und den nichtgeistigen Formen der AffektivitätAffektivität. Wie gesehen, ist die GeistigkeitGeistigkeit einer affektiven AntwortAntworttheoretische nicht alleine durch ihre IntentionalitätIntentionalität gesichert, „sie erfordert darüber hinaus die für Wertantworten charakteristische TranszendenzTranszendenz“17. In der WertantwortWertantwort18 kommt es zu einem KonformierenKonformieren mit dem Wert, dem in sich Bedeutsamen, zu einer adaequatio cordis ad valorem. Es ist dies „einer der tiefsten Grundzüge der PersonPerson“19. Im selben Mass wie in der ErkenntnisErkenntnis kommt es in der affektiven Wertantwort zu einem Überschreiten der bloss subjektiven Bedürfnisse und Begierden. Doch reicht die der Wertantwort eigene Transzendenz noch weiter. „Indem unser Herz sich dem Wert angleicht, das in sich Bedeutsame uns ergreift, bildet sich eine EinheitEinheit, die über die im ErkennenErkennen liegende noch hinausgeht.“20 Das zeigt sich in aller Deutlichkeit an der affektivsten aller affektiven AntwortenAntworten, an der LiebeLiebe.21 In der Liebe ist die Person noch tiefer in die Vereinigung mit dem Objekt hineingezogen als in der Erkenntnis. Und doch erweist sich an der Liebe die „MitwirkungMitwirkung des Intellektes mit dem Herzen“22. Denn es ist ein ErkenntnisaktErkenntnisakt, in dem der Gegenstand der Liebe erfasst und es ist ein Erkenntnisakt, in dem sein Wert begriffen wird.
Etwas von dieser MitwirkungMitwirkung des Intellektes mit dem Herzen hat sich weiter oben bereits gezeigt, als das WertfühlenWertfühlen eingeführt wurde, das unmittelbare AffiziertwerdenAffiziertwerden vom Wert.23 Das erstens ein rezeptives Verhalten und zweitens die WirkungWirkung eines Erkannten ist, und zwar eine affektive Wirkung, das drittens ein ausgesprochen intentionales Erlebnis ist.24 Ohne dieses Affiziertwerden vom Wert – wie von HildebrandHildebrandDietrich von bereits in seiner Habilitationsschrift dargelegt hat – ist auch das ErkennenErkennen von Sachverhalten, die in dem betreffenden Gegenstand und seiner intrinsischen BedeutsamkeitBedeutsamkeit gründen, „nur in sehr beschränktem Masse möglich“25. Um ein Erkennen handelt es sich beim Wertfühlen jedoch allemal, denn wie sonst könnte man an dem axiomatischen SatzSatz, wie an dem notwendigen SachverhaltSachverhalt festhalten, dass nichts gewollt oder gefühlt werden kann, das nicht vorweg erkannt worden ist? Es handelt sich hierbei um eine Problemstellung, deren abschliessende Behandlung einer späteren Stelle vorbehalten bleibt. Nur andeutungsweise sei hier auf das anstehende Problem aufmerksam gemacht, das sich in die Frage fassen lässt, ob das Erkennen dem Wollen in jedem Falle vorhergeht oder ob es sich in gewissen Fällen auch so verhält, dass das Wollen dem Erkennen vorhergeht.26