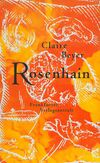Kitabı oku: «Revanche»
Tobias Ristow lebt allein in einer komfortablen Terrassenhauswohnung, die er nach dem Abitur von seinem Vater zur Verfügung gestellt bekommen hat. Im Gegenzug setzte er auf Wunsch seines Vaters Unterschriften unter einige Formulare, ohne zu ahnen, welch weitreichende Folgen dies für ihn haben würde. Als Träumer der Familie spielt er in der väterlichen Firma eine nebengeordnete Rolle, anders als seine Halbbrüder, die vom Vater bevorzugt werden. Als er die attraktive, aber kapriziöse Lea kennenlernt, deren Sohn Raphael nach anfänglicher Skepsis immer mehr Vertrauen zu ihm fasst, kommt neuer Schwung in sein Leben. Doch die alten Fragen lassen ihn nicht los: Was hatte es mit dem rätselhaften Autounfall seiner Mutter auf sich? Warum verschwand sein geliebter Onkel Fritz damals spurlos? Tobias macht sich auf die Suche nach den eigenen Wurzeln, die ihn bis nach Madeira und durch Nordfrankreich führt, und dringt tiefer in die rätselhaften Verflechtungen der eigenen Familiengeschichte vor.


Inhalt
Wenn, wie an diesem Morgen …
»La Maison Rouge« werden die drei kleinen Häuser …
Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren …
Ich habe einen Mann getötet …
Raphael sah sich unwillkürlich um …
Frankreich, 1916 …
Raphael ging zum Schreibtisch …
Monate zuvor war Tobias Ristow …
Der Start vom Flughafen Funchal …
Nach seinem Einzug saß Tobias …
Zwei Jahre hatte er im Lebensstil …
Am Wochenende nach Ritas Brief …
Er wechselte die Fakultät …
Heute lachte kaum noch jemand …
Der Junge war sieben Jahre alt gewesen …
Einen Stapel Auftragszettel …
Ristow sah auf seinem Handy …
Fledermäuse und irgendwelche Nachtvögel …
Die Firma. Das Große …
Ristow schloss die schwere Eingangstür …
Sein Freund und Studienkollege …
Als Ristow in die Wohnung zurückkam …
Wohin er reisen würde …
Ristow war auf dem Weg nach Laupheim …
»Ja und ja«, sagte Fred …
»Das Elsass«, dozierte Raphael …
Die Gästewohnung, ursprünglich die Räume von …
Ein Glas und noch eins …
Ihr Ziel war Laon …
Raphael vergaß angesichts …
Wir sind fast am Ziel …
Am deutschen Soldatenfriedhof …
Raphael hatte die Blumen gepflückt …
Spektakulärer Panoramablick …
Schau mal nach oben …
Wäre es ihnen möglich gewesen …
In Kirchen finde ich die Fenster …
Bis fast vor die Tore von Paris …
Während die Hitze Paris fest im Griff hatte …
Ristow und der wieder gesundete Raphael …
Wilhelm Ristow betrachtete die schlafende Lea …
Der Neckar fing den warmen Regen …
Am Flughafen von Funchal warteten …
Raphael hatte einen Schlüssel …
Ristow führte auf Madeira …
Nicht im Lorbeerwald …
Ristow setzte sich auf den äußersten Rand …
Aber der Schreiber ist halbwegs in seinem Bild Und bewegt sich darin zugleich als Maulwurf und Adler
Tomas Tranströmer
Für Bruder Franz
Wenn, wie an diesem Morgen, ihre Schritte so massiv durch die Kellerdecke drangen, würde es Ärger geben. Mehr noch als Worte setzte seine Mutter ihre Absätze als Waffe gegen ihn ein. Klackklackklack, ein gewaltiges Stakkato, das der Choreografie ihrer Wut folgte. Er sprang auf und stellte sich für einen Moment vor seinen Schreibtisch, auf den ein Sonnenstrahl durch das Kellerfenster fiel. Raphael mochte seine Behausung, obwohl sie keine acht Quadratmeter maß und außer in den Morgenstunden kaum Licht hereinkam. Wären da nicht diese Schritte, einen besseren Platz zum Leben hätte er sich nicht vorstellen können.
Vor seinem Verschwinden hatte Raphaels Vater den Kellerraum für sich beansprucht, wahlweise als Werkstatt, Bücherzimmer oder Büro. Längst war alles leergeräumt und nur eine Werkbank und einige graue Kabel, die aus der Wand hingen, zeugten noch von seinem überstürzten Aufbruch ohne Wiederkehr.
Schnell zog sich der Junge an, warf sich die Schultasche über die Schulter, eilte die Treppe hinauf, duckte sich und floh an der Tür seiner Mutter vorbei hinaus ins Freie.
Kein Frühstück. Kein Pausenbrot. Und Geld hatte er auch keines. Sie schuldete ihm sein Taschengeld seit Ewigkeiten, er wusste selbst nicht mehr genau, seit wann. Shit, shit, shit, shit. Mit diesem Rhythmus betrat er das Schulgebäude. Und verließ es wieder, noch bevor er es zum Klassenraum geschafft hatte.
Er überlegte, ging dann zum Terrassenhaus. Tobias Ristow war nicht da, aber Fred Immermann ließ ihn wortlos in die Wohnung. Raphael setzte sich an den Schreibtisch und nahm die Aufzeichnungen des Meldereiters August Ristow aus dem Ersten Weltkrieg zur Hand und begann zu lesen.
*
»La Maison Rouge« werden die drei kleinen Häuser auf dem Weg von Festieux zum strategisch wichtigen Fort de la Malmaison genannt. Sie waren als »Lieu d’amour«, als »Ort der Liebe« bekannt. Ich wurde in den Gefechtsstand gerufen. Der Unteroffizier unserer Einheit, ein Bayer mit rotem Bart, teilte mich dazu ein, am Abend die Offiziere zu den roten Häusern zu begleiten, um dort für die Pferde zu sorgen. Sie sollten bei etwaigen Trommelfeuern oder sonstigem Lärm beruhigt werden, so der Bayer. Mit meinem Leben musste ich dafür garantieren.
Die Leiber der Pferde dampften vom scharfen Ritt und wärmten die kalte Luft der Boxen. Ich trocknete ihnen den Schweiß, legte raue Decken über sie, sprach mit ihnen. Diese ehrliche und gute Arbeit liebte ich und freute mich schon am Morgen auf meine Aufgabe, auch wenn die Offiziere oftmals bis spät in die Nacht in dem Etablissement blieben und sich danach, mitunter stockbesoffen, kaum auf den Tieren halten konnten. Seit Tagen – oder waren es Wochen? – gab es keine Kampfhandlungen. Beide Seiten belauerten sich, jeder hatte Angst vor dem ersten Schuss, der ersten Granate, dem ersten Angriff. Der Stellungskrieg lag in tiefer Agonie. Doch die Soldaten hockten schussbereit in ihren Gräben.
Ich beförderte tagsüber die Eilnachrichten zu den Gefechtsständen und zurück, ritt mein Pferd dabei über einen Zufl uss zur Aisne. Es war eine verbotene Abkürzung, denn dort gab es nur eine schmale Behelfsbrücke mit lückenhaftem Geländer. An diesem Tag scheute das Tier vor seinem eigenen Spiegelbild und wir beide stürzten hinab. Glück im Unglück, dass der Bach zu diesem Zeitpunkt wenig Wasser mit sich führte, denn bei Normal- oder gar bei Hochwasser wurden die Nebenarme der Aisne, wie sie selbst, zum reißenden Strom. Ich schimpfte meinen Weggefährten einen Ochsen, und wirklich, so ein Pferd kann schuldbewusst dreinschauen. Gott sei Dank sah keiner, wie wir uns triefend nass ans Ufer hievten. Wäre das bekannt geworden, hätte es mich wieder in den Schützengraben gebracht.
Mein klatschnasses Pferd musste gleich getrocknet werden – und ich ebenfalls. Doch als ich wieder aufsaß, machte mich ein undefinierbares Gefühl stutzig. Ich erkannte die Brücke eindeutig als das Versteck des Tornisters. Das Holz der Brückendielen hatte es mir verraten. Grau und rissig und einzigartig in dieser Gegend. Der sterbende Kamerad hatte mir sein Geheimnis anvertraut.
Kriegsbeute. Goldbarren und -münzen. Gib sie zurück, schienen seine Augen zu sagen, ich möchte nicht als Dieb sterben. Ich hatte es ihm in die Hand versprochen.
Ich stieg dennoch nicht ab, das Pferd ging vor. Auch musste ich vorsichtig sein und die schützende Nacht für mein Vorhaben wählen, den Tornister auszugraben. Jetzt musste ich mich um mein Pferd kümmern, ohne dass mein Sturz einem der höheren Dienstgrade zu Ohren kam. Mir fiel der Stall der Maisons Rouges ein. Zu dieser Tageszeit war dort nicht mit Offizieren zu rechnen.
Ich kam nicht zur üblichen Stunde zu den drei roten Häusern und war überrascht, jemanden anzutreffen. Es war ein junges Mädchen mit Haube, eine Küchenmamsell oder ein Hausmädchen der Frauen, die in den Häusern ihrem Gewerbe nachgingen. Sie schüttete Karottenreste in einen Trog und bemerkte mich erst, als ich mich beinahe hinter ihr befand. Sie erschrak so sehr, dass ihr die Blechschüssel aus den Händen fiel. Ihren langen Rock samt karierter Schürze raffend, rannte sie mit hochrotem Kopf an mir vorbei, hinaus aus dem Stall.
Das war meine erste Begegnung mit Simone.
Überhaupt war es das erste weibliche Wesen in Nähe der Front, das ich zu Gesicht bekam. Denn jene Damen, zu denen es die Offiziere zog, verließen die roten Häuser nie. Fast so verwirrt wie das inzwischen verschwundene Mädchen stieg ich vom Pferd, trocknete meinen Gefährten mit geübten Handgriffen, und ließ dabei die Blechschüssel nicht aus den Augen. Dann entkleidete ich mich schnell, legte Uniform und Wäsche auf einen Strohballen, schlang eine raue Decke um meinen Körper und zog mich in eine der leeren Pferdeboxen zurück. Ein leises Geräusch ließ mich aufhorchen und ich spähte um die Ecke. Am Tor zum Stall blitzte eine weiße Haube auf. Gleich darauf stand das Mädchen im Innern und schaute sich suchend um. Vorsichtig trat ich aus meinem Versteck. Die Decke notdürftig unter die Achseln geklemmt, hob ich die Schüssel auf und streckte sie ihr entgegen. Sie reagierte schnell, war mit wenigen Schritten bei mir, riss die Schüssel an sich, wobei ich vor lauter Überraschung meine schützende Decke fallen ließ. Schon am Tor, drehte sich das Mädchen noch einmal um, ich glaubte, sie lachen zu sehen, war aber viel zu verlegen, um etwas zu erwidern. Soldat August nackt im Stall, präsentiert seine abgemagerte Gestalt einer jungen Frau. Gott im Himmel, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, und floh zurück in die Box.
An den Tagen und Abenden darauf war alles wie zuvor. Ich ritt, an mein Pferd geschmiegt, ausgestattet mit den wichtigen Botschaften, den Chemin des Dames entlang, kam erleichtert wieder ins Fort zurück, nahm am Abend die Pferde der Offiziere bei den roten Häusern in meine Obhut und verbrachte die halben Nächte im Stall. Dort beschäftigten mich die Gedanken um das Mädchen oder den versteckten Tornister, manches Mal auch um beide gleichzeitig. Dann, ich war auf meinem Strohballen eingeschlafen, schrak ich hoch. Das Mädchen stand vor mir. Ich hatte keine Vorstellung, wie lange sie mich schon beobachtet hatte. Unsicher, wie ich mich verhalten sollte, blieb ich einfach liegen, schaute sie an. Schaute, ob sie ein Messer zog. Das war an anderer Stelle vorgekommen, ich wusste davon. Aber das Mädchen lächelte nur, zeigte auf sich und nannte ihren Namen. Ich stand auf, verneigte mich vor ihr: August, ich bin August. Auguste, wiederholte sie, setzte sich und zog mich an sich.
Simone. Eine Liebe im Krieg. Im Feindesland. In Unzeiten.
Wir perfektionierten nach und nach unsere sprachlose Kommunikation, stießen an Grenzen. Wie sagt man Unsagbares. Eine Hand aufs Herz, ein Streicheln über die Wangen, eine lange Umarmung. Ihre Lippen berühren, ihre Haare, ihren Schoß, ihre geschlossenen Lider küssen. Mon amour, mon amour. So brachten wir uns Worte bei. Lachten über die Aussprache des anderen.
Bis wir vom rotbärtigen Unteroffizier entdeckt wurden. Er hatte eine Flasche Schnaps aus den Satteltaschen seines Pferdes geholt und ließ im hinteren Teil des Stalls Wasser. Wir hatten uns geliebt und lagen engumschlungen auf unserem Strohbett. Der Bärtige starrte auf uns, starrte auf Simone, in deren dunklen Locken sich Halme verfangen hatten. Dann wandte er sich wortlos dem Tor zu. Hastig kleideten wir uns an. Ich fror. Der lüsterne Blick des Bärtigen verhieß nichts Gutes. Simone war in großer Gefahr. Was mit mir passieren würde, war mir in diesem Moment gleichgültig. Ich begleitete sie zu den roten Häusern, wo sie eine kleine Kammer bewohnte. Ihr Weinen verfolgte mich die ganze Nacht.
Simone musste verschwinden. Möglichst weit weg von den Maisons Rouges. Aber wie? Mir fiel der Tornister ein. Ich nahm die Taschenlampe, eine neue Daimon 414, einen Spaten, sattelte mein schläfriges Pferd und gab ihm vor dem offenen Stalltor die Sporen. Kaum hatte ich die Brücke erreicht, sprang ich ab, ließ meinen Gefährten stehen, er würde nicht weglaufen. Nach nur wenigen Versuchen fand ich das Versteck. Der Regen hatte es fast schon freigelegt. Mit dem Tornister auf dem Rücken ritt ich im Galopp zurück. Trotz tiefster Dunkelheit. Ich musste mich beeilen, denn die Offiziere würden bald aufbrechen und als ihre Vorhut musste ich vorausreiten. Es war noch ruhig, als ich am Stall ankam. In den drei roten Häusern brannten die Petroleumlampen, hin und wieder tauchten Silhouetten hinter den Fensterscheiben auf. Mein Gefährte durfte nach einem kräftigen Abreiben des verschwitzten Leibs seinen Schlaf fortsetzen. Ich verkroch mich in eine leere Box, öffnete den verschmutzten Tornister. Wie alle anderen auch bestand der Außenstoff aus grauer, fester Baumwolle. Innen war er mit einem leinenweißen Bezug ausgelegt. Das eingenähte hölzerne Kreuz , das der Stabilisierung dienen sollte, war gebrochen, doch das nierenförmige Kochgeschirr aus Stahlblech war da, ebenso etwas Wäsche und Ersatzstiefel. Im Außenfach fand ich Patronen. Ich breitete das Inventar vor mir aus, sah aber unter dem Schein der Taschenlampe nichts, was auf geraubtes Kriegsgut hinwies. Erst als ich in einen der Stiefelschächte griff, kam die Beute zum Vorschein. Drei Goldbarren und etliche Münzen. Hastig stopfte ich alles wieder zurück, packte das Stiefelpaar in den Tornister und versteckte ihn unter Stroh und Heu in einem Loch in der Wand, denn aus den Häusern drangen bereits Stimmen zu mir herüber.
Die Offiziere gingen jeden Abend zu den roten Häusern. Außer bei Kampfhandlungen oder an Sonntagen, weil sich dann im Laufe des Abends der Garnisonspfarrer zeigte und über die gelichteten Reihen hinweg predigte. Einzig ein Zitat ist mir davon in Erinnerung geblieben: »Gott halte es mit den besten Kanonen.«
Wenn ich also das Mädchen retten wollte, dann an diesem Sonntagabend, nur sonntags konnte es gelingen, davon war ich überzeugt, das redete ich mir ein. Trotzdem war ich verzweifelt, denn als einfacher Soldat musste ich am Gottesdienst teilnehmen, jedes Fernbleiben wurde geahndet. Nur eine List würde mir noch helfen, Simone zu retten, aber auch die blieb mir versagt, denn für diesen Abend wurde ich als Wachposten während der Predigten eingeteilt. Gott war bei den Kanonen, nicht bei mir.
In diesen Tagen blieb es an der Front ruhig. Die Soldaten harrten in den Gräben im Schlamm und Dreck aus. Die Offiziere hatten sich zu den hinteren Linien zurückgezogen. Ihre Unterkünfte waren mit Teppichen und Tapeten ausgestattet, zum Teil gar mit richtigen Betten und Waschschüsseln. Von Simone gab es kein Zeichen, keine Spur. Ich ritt wieder auf dem Chemin des Dames, übergab Depeschen oder Briefe aus der Heimat und abends ging es zu den Maisons Rouges. Ich ritt vorbei an den Toten, die am Ufer der Aisne ihre ewige Ruhe gefunden hatten. Sie, die Vergessenen. Vielleicht im Fluss, vielleicht im Massengrab, das man in der Nähe des Ufers angelegt hatte. Und wenn sie noch auf dem Boden gelegen hätten, ich hätte sie nicht mehr wahrgenommen. Verroht wie ein Tier war ich. Alle Empfindungen, alles Mitleid, aller Schmerz richtete sich auf eine Person, auf Simone. Dann sah ich sie endlich, wenn auch nur von weitem. Über den Schultern trug sie ein Joch, an jedem Ende hing ein Eimer. Sie humpelte. Simone humpelte. Ihr Blick war auf den Boden gerichtet. In einer der Türen stand der Rotbärtige und schrie ihr etwas zu. Ich verstand es nicht. Zog mich in die Dunkelheit des Stalls zurück, weil ich sah, dass der Teufel einen Schritt in meine Richtung machte, es sich dann anders überlegte und seine Reitpeitsche aus dem Stiefelschacht zog und hinter Simone herlief und auf sie einschlug. Sie ging zu Boden, das Wasser stürzte aus den Gefäßen. Kein Schrei, nur ein Lachen. Der Rotbärtige lachte.
Wenige Wochen später – es regnete und stürmte schon seit dem frühen Morgen – gab mir der Unteroffizier an einem Sonntagabend den Befehl zum Aufbruch. Er überschritt damit seine Kompetenz und missachtete seine Anwesenheitspflicht bei der Predigt. Sein Ziel waren natürlich die drei roten Häuser. Mir war klar, dass es nur um Simone gehen konnte, und ich musste vorausreiten, ihn sicher zu ihr führen. Irgendwann hielt ich mein Pferd an, der Rotbärtige brüllte mir zu, was das solle. Ich machte ihm den Vorschlag, die Abkürzung über die Behelfsbrücke zu nehmen, weil es so stark regnete und der Herr Unteroffizier völlig durchnässt sein würde, bis wir am Ziel wären. Nach längerem Zögern willigte er ein. Ich brachte ihn sicher über die Behelfsbrücke, obwohl das Wasser fast die Bohlenbretter des Steges erreicht hatte. Im Stall angekommen, trocknete ich unsere Pferde, fütterte sie und während ich das tat, kam eine Ruhe über mich, die einer Ohnmacht glich. Ich atmete den Geruch der Tiere ein, den Geruch des Regens, den Geruch des Grases, das von weither als Futter für die Pferde beschafft worden war. Ich atmete die Ruhe des Stalles ein und wusste in diesen Sekunden, dass genau jetzt der Moment gekommen war, zu handeln.
Die Vorbereitungen waren getroffen. Ein Seil, das den Zweck erfüllen musste, hing an einem Haken der Stallwand. Zusammen mit Werkzeug. Aber das brauchte ich nicht, das brauchte der Bauernjunge August nicht. Ich wusste, dass mein Zeitrahmen etwa drei Stunden betrug, und handelte, nachdem ich den Entschluss gefasst hatte, zügig, aber ohne Hast. Zwei-, dreimal testete ich meine Vorrichtung auf der Brücke. Und jedes Mal gelang mir mein Vorhaben. Danach hatte ich noch etwa eine Stunde Zeit, meine Hände zu beruhigen, meine Stimme zur Sicherheit zu zwingen. Doch als der Rotbärtige schließlich kam und zum Aufbruch drängte, ich unsere Pferde sattelte, zitterten meine Knie. Er bemerkte es nicht. Trieb mich an, schrie mich an, ob ich die Peitsche spüren wolle, langsam wie ich sei. Mir spuke wohl die Küchenmamsell im Kopf herum, griente er, aber da käme ich zu spät, die habe schon bekommen, was sie brauche. Das Glück des Teufels sei mit mir, dachte ich und ritt los.
Im schlammigen Boden kamen wir nur langsam vorwärts. Die Pferde schnaubten wegen der fürchterlichen Anstrengung. Der Unteroffizier schlug seines mit der Gerte. Ich ritt wie immer voraus. Hielt dann und wann an, scheinbar aufmerksam die Lage erkundend. Dem Rotbärtigen blieb nichts anderes übrig, als es mir gleichzutun. Kurz vor der Behelfsbrücke schrie ich ihm zu, er solle vor dem Überqueren auf mein Zeichen achten und zunächst warten. Äußerste Vorsicht sei geboten, denn ich hätte Schatten gesehen. Er schüttelte den Kopf, hielt sich aber mit seinem Pferd an Ort und Stelle. Der Bach überspülte inzwischen die Bretter, doch es sei, wenn auch erschwert, möglich, darüber zu reiten, das versicherte ich und trabte an. Er sah nicht weiter als bis zum Boden, sah nicht, wie ich jenseits des Steges das Seil aufnahm, es an den Sattel meines Pferdes band und spannte.
Auf meinen Ruf hin ritt der Rotbärtige los, gab dem Pferd die Sporen, ich tat es ebenfalls. Sein Schrei ging im Regen, im angstvollen Wiehern des Pferdes, unter. Das Tier war gestolpert, hatte den Rotbärtigen abgeworfen und der reißende Bach war ihm zum Verhängnis geworden. Er hatte ihn sich geholt. Als hätte er nur darauf gewartet.
Schon wieder diese Ohnmacht, dachte ich, riss mich dann aber zusammen und lief zum Ufer. Spähte über die aufgewühlten Fluten. Sah nichts als tausendfache Wellen die sich gegenseitig hochpeitschten. Glaubte vor der Flussbiegung etwas zu sehen, einen Mantel, ausgebreitet wie ein Floß. Aber der Fluss gab nichts preis. Dennoch horchte ich wartend und rufend. Hoffend, keine Antwort zu erhalten. Auf einmal fuhr ich vor Schreck zusammen, stieß einen Schrei aus, weil mich jemand an der Schulter berührte. Es war nur mein Pferd, mein treuer Gefährte.
In rasendem Tempo ritt ich zurück, holte Simone zu mir in den Stall. Sie humpelte noch immer. Auch war etwas mit ihrem Gesicht, was ich mehr ahnte als sah. Der Ausdruck ihrer Augen war ein anderer geworden. Ich deutete an, nicht lange bleiben zu können. Wagte nicht, sie in den Arm zu nehmen. Stattdessen nahm ich ihre Hand, zog sie mit mir. Widerwillig folgte sie mir in den hinteren Teil des Stalls, dort, wo die Wassertröge über dem Boden angebracht waren. Ich bat sie zu warten, ging in die leere Pferdebox, bückte mich und zog zwei Steine aus der Wand. Dahinter, zwischen Dung und Stroh, lag der Tornister. Darin, in den Stiefeln verborgen, der geraubte Schatz. Simone starrte mich verständnislos an. Ohne jede Regung. Schließlich zog ich eine große Umhängetasche aus dem Stroh. Ich hatte sie während der langen Stunden des Wartens auf die Offiziere aus dem Innenfutter des Tornisters mit Sattelzwirn vernäht. Sie verfügte über mehrere schließbare Taschen und einen dicken Gurt. Als ich sie Simone umhängen wollte, wehrte sie zunächst ab, ließ es aber nach einer bittenden Geste meinerseits zu. Dann verstaute ich darin das Gold und die drei Barren, alles, ausnahmslos.
Ich gab ihr zum Abschied die Hand. Sie nahm und drückte sie, dann aber umarmte und küsste sie mich. Sie wollte, dass ich mit ihr gehe. Viens avec moi. Ich schüttelte den Kopf. Pourquoi pas? Es wäre unser beider Tod. Wir hätten keine Chance, auch nur eine Strecke gemeinsam zu gehen. Der Deserteur und das Mädchen. Der Preuße und die Französin.
Als sie im Dunkel verschwunden war, drückte ich meinen Kopf gegen den warmen Pferdehals, konnte aber den Geruch nicht ertragen. Nicht in diesem Augenblick. Ich ging zum Stalltor, horchte in die Nacht, glaubte eine Pferdekutsche zu hören, die sich von den drei roten Häusern entfernte. Glaubte Simone darin sitzen zu sehen, in Reisekleidung, mit einer Umhängetasche, die aus preußischem Stoff gefertigt war, in der Hand einen Zettel mit der Adresse von August Ristow in Kallies, Pommern, eine Adresse, die nichts mehr wert war. Weil es das Haus nicht mehr gab, weil die Menschen, die dort gelebt hatten, auf der Flucht oder tot waren, weil der Jüngste als Soldat auf dem Chemin des Dames ein Meldereiter war und am Abend der Offiziersbegleiter zu den trois Maisons Rouges. Ich weinte. Dieser Krieg würde nie zu Ende gehen und wenn doch, Simone würde mich vergeblich suchen. Es gab kein Zuhause mehr. Keine Adresse.
*
Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren. Triefte vor Nässe, schwitzte und fror gleichzeitig, als ich zurück zur Behelfsbrücke ritt. Meine Knie zitterten wieder. So sehr, dass ich nicht absitzen konnte. Das Pferd des Unteroffiziers war nicht zu sehen. Ich hoffte, es war auf und davon. Hoffte, dass es nicht auch in den Fluten versunken war.
Aber es war nicht im Fort angekommen, als ich – der Morgen graute bereits –dort eintraf. An die anschließende Meldung erinnere ich mich nicht mehr, so sehr ich mich auch anstrenge. Ich erinnere mich nur noch, dass ich zum Suchtrupp eingeteilt und danach immer wieder verhört wurde. Weil sich der Unteroffizier aber ungefragt und dazu sonntags an einem Ort aufgehalten hatte, der zwar gelitten, jedoch nicht erlaubt war, wurde keine große Sache daraus gemacht, wie ich von Kameraden erfuhr. Vermisst im Feindesland.
*
Ich habe einen Mann getötet. Ich bin ein Mörder. Ich habe viele Männer getötet. Ich bin kein Mörder.
*
Raphael sah sich unwillkürlich um, aber er war der alleinige Zeuge dieses Geständnisses. Instinktiv verdeckte er die Worte mit der Hand, lugte nach einer Weile zwischen den Fingern hindurch, doch er hatte richtig gelesen: August war ein Mörder. Raphael zwang sich zum Weiterlesen, dazu, die Aufzeichnungen von vorn zu beginnen, als könne er dieses schlimme Ereignis damit ungeschehen machen oder zumindest besser verstehen.
*
Frankreich, 1916
Ich schrie, bis meine Stimme versagte, aber keiner hörte mich. Ich redete, bis die Worte einem ewigen Fluss glichen, aber keiner verstand mich. Ich weinte, bis die Tränen einen See um mich füllten, aber keiner trocknete sie. Es war Krieg. Und ich, der Bauernjunge August Ferdinand Ristow, war Soldat, lag im dreckigsten Graben, keiner kann sich vorstellen, wie elendig und dreckig. Ratten starrten mich an, suchte ich Deckung, Kugeln und Splitter explodierten über meinem Kopf. Würden sie treffen. Würden sie treffen …
Aber schon seit Tagen herrschte Ruhe. Mir war, als würde sich ein Ring um uns zusammenziehen. Dass die Feinde kämen und mich und alle, die wir im Graben kauerten, vernichteten. Noch ist alles still, dachte ich, zu still. Die Ruhe vor dem Sturm, den Kanonen, den Granaten. Zeit, Verletzte zu bergen und die Toten zu vergraben oder um ihnen die Augen zu schließen. Dass ich nicht hier sein sollte, nicht durfte, hämmerte es ständig in meinem Kopf. Ich müsste bei der Ernte sein, den Eltern helfen. Die Pferde einspannen, den Roggen prüfen, der jetzt so gelb wie die Sonne war, daheim in Kallies, dem schönsten Ort in Pommern. Mit meinem Freund Gerhard zum See laufen, die Angel auswerfen und fette Brassen oder Plötzen oder beides herausholen, sie über dem Feuer braten und satt und müde sein, wie alle Tage, an denen der Horizont eine blaue Borte trug. Ich müsste bei Marianne sein, meiner schönen Trakehner-Stute, mit ihr entlang der unendlichen Kartoffel- und Rübenfelder galoppieren, in lichten Wäldern Halt machen, ihr den Schweiß abtrocknen und auf Gerhard warten, weil er immer der Zweite ist. Mit ihm im Gras liegen, von der Ostsee träumen, von den riesigen Schiffen und Kränen und davon, einmal die Füße in das Meer einzutauchen. Aber nie, nie fort aus Kallies.
Ich müsste zu Hause sein, hämmerte es immer weiter. Den Hof übernehmen, auf den Pferdemarkt gehen, um nach Trakehnern Ausschau zu halten, auch, um vielleicht eine Stute wie die Mongolin zu finden, die so schön ist, dass es einem Tränen in die Augen treibt. Ich müsste, hämmerte es, an den Stallknecht von Gerhards Vater denken, der in seiner Kammer einen Druck von Thomas von Nathusius aufgehängt hatte, der die Mongolin in ihrer ganzen Schönheit zeigt.
Aber die vermaledeite Stille raubte mir die Vielzahl der Erinnerungen. Zerfetzte sie, warf sie in kleinen Stücken in den Graben.
Adieu la vie, adieu l’amour, Adieu toutes les femmes C’est bien fini, c’est pour toujours De cette guerre infâme C’est à Craonne, sur le plateau Qu’on doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés Nous sommes les sacrifiés
Leb’ wohl Leben, Leb’ wohl Liebe, Lebt wohl all ihr Frauen Es ist vorbei, für immer vorbei Dieser abscheuliche Krieg Auf dem Plateau von Craonne Wo man krepieren muss Weil wir alle verdammt sind Wir sind die Geopferten
Ich war im Fort de la Malmaison und wartete mit einigen Kameraden auf einen neuen Einsatzbefehl. Wir hockten draußen auf einem Heuballen, immer sprungbereit, immer in Habachtstellung, wenn einer der Offiziere auftauchte. Ein Blatt wurde vom Wind aufgewirbelt und zu Boden gedrückt. Ich las die Zeilen, konnte sie nicht deuten, gerade noch das Wort Adieu. Adieu Mama, Papa, Adieu Marianne, Adieu Kallies, schrieb ich in Gedanken dazu. Ich schaute nicht mehr auf, nicht auf die Erde, nicht auf den Himmel, wo angeblich Gott wohnen soll. Mag sein, dass andere das glauben, aber ich denke inzwischen, dass es ein Schönwettergott ist, dass er bei uns Soldaten gehörig wegschaut. Sollte ich wirklich dieser Hölle hier entkommen und das Ende des Krieges erleben, würde ich keine Kirche aufsuchen, um eine Kerze anzuzünden. Ich würde mich in ein frisch bezogenes Bett legen, alle Tage lang Grießbrei mit Zucker und Zimt essen. Aber noch war ich nicht August, der Kallieser Bauernjunge, sondern war ein Soldat. Ich rutschte vom Heuballen, verzog mich zum Taubenschlag. Im kleinen Futterhaus daneben bot eine Sitzbank für kurze Zeit die Möglichkeit des Rückzugs. Dort konnte ich meine Gedanken bei mir halten. Sie stoben nicht auseinander wie draußen, sie hockten sich zu den Brieftauben, wie sie nicht wissend, nicht ahnend, wohin sie die nächste Stunde führen würde. Was geht mich Politik an, was der Kaiser, dachte ich. Natürlich kam dieser Gedanke zu spät und hätte mich auch zwei Jahre zuvor nicht davor bewahrt, Soldat zu werden. Mein Geburtstag war im Juli und alle gesunden Männer, die das Alter von zwanzig Jahren vollendet hatten, mussten sich bei der zuständigen Behörde melden, damit über ihre militärische Verwendung entschieden werden konnte. Zur Kontrolle hatten sie Stammrollen aufgebaut, in denen die Grundstückseigentümer – in diesem Fall war das mein Vater – mit ihren Söhnen – damit meinten sie mich – eingetragen wurden. Wenn es denn unbedingt sein musste, dachte ich, zwei Jahre sind keine Zeit und mit meinem Freund Gerhard würde das ein Abenteuer werden. Vielleicht war es sogar Vorfreude auf die schmucke Uniform (ich sah mich hoch zu Ross, wie mir die Mädchen zuwinkten), vielleicht Stolz, endlich als Mann gesehen zu werden. Was für ein Kind ich doch war, nichts hatte ich kapiert.
Und so setzte sich mein militärisches Leben wie ein Zug in Bewegung. Auf preußischen Schienen. Die erste Haltestelle hieß Potsdam. Entweder hatte der Zufall geholfen oder die alphabetische Ordnung. Gerhard, dessen Nachname Renchow lautete, wurde mit mir und zwei weiteren Kameraden einer Stube zugeteilt; ich weinte fast vor Freude.