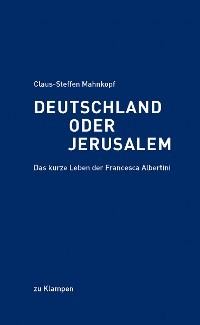Kitabı oku: «Deutschland oder Jerusalem», sayfa 3
Im Wasser war sie überglücklich. »In einem früheren Leben war ich ein Fisch«, sagte sie. Auf einer Karte nannte sie sich eine »Delphinin«. Im Frühjahr 2005 entdeckte sie, trotz des Diabetes, das Tauchen und schloß sich einem Verein in Freiburg an. Ende April tauchte sie zum ersten Mal, für 35 Minuten in neun Meter Tiefe. Bis zum Sommer 2007 sollte sie noch 66 Mal unter Wasser gehen. Sie machte regelmäßige Ausflüge ins Freiburger Umland, aber auch ins Salzkammergut, ins Tessin und nach Mallorca mit zwölf Tauchgängen im offenen Meer. In einem Tauchvideo aus diesem Urlaub sieht man Francesca vorbeischwimmen und in die Kamera winken. Wie immer strahlte sie. Unter Wasser fand sie buchstäblich Ruhe. Auch hier war sie ehrgeizig. Sie bestand die Prüfungen, erwarb die Brevets in Bronze und Silber, das Goldbrevet strebte sie an. Dafür mußte sie viel lernen, auch Technik und Theorie, mithin etwas, was ihr sonst überhaupt nicht lag. Aber sie biß sich durch und war danach sehr stolz, wenigstens auf einem technischen Gebiet es geschafft zu haben. In ihrem Tauchbuch hielt sie immer fest, was sie alles sah, Oktopusse, Fische, auch solche, die sich gegenseitig fressen, Felsformationen, die Szenerie bei Nacht oder Nebel. Tauchreisen auf die Malediven und Seychellen waren angedacht.
Ein anderes Hobby, dem sie vor allem in der Freiburger Zeit frönte, waren Krankenhausserien im Fernsehen, aber nicht etwa die spießigen deutschen à la Schwarzwaldklinik mit ihrem gutmenschelnden Touch, sondern die actionreiche amerikanische Serie Emergency Room, wo auf der Notaufnahme ein Notfall in größter Hektik den nächsten jagt. Genau diese Katastrophenstimmung brauchte sie. Abende, an denen sie gezeigt wurden, waren tabu für alles andere. Francesca saugte die Episoden auf wie Kinder, die spannende Bücher verschlingen. Sie liebte daran die Mischung aus Gefahr und Rettung. Sie, die Tochter eines Intensivmedizinpflegers, interessierte sich für Medizin in all ihren Facetten. Die Ironie ist, daß, als ihre chronische Krankheit ausbrach, auch bei ihr der Notarzt nicht nur einmal gerufen werden mußte.
Eine andere »Heilige Kuh« war Star Trek. Francesca war ein Trekki par excellence. Sie kannte alle Folgen und wußte alles. Sie las die entsprechenden Bücher, so von Leonard Nimoy, dem Darsteller des legendären Mr. Spock, sowohl das Buch I am Spock als auch das Buch I am not Spock. Als in Berlin der neue Star Trek-Kinofilm Premiere hatte, kaufte sich Francesca Monate vorher eine Karte. Nachdem ich es einmal versäumt hatte, den Videorekorder zu programmieren, gab es einen Ehekrach. Im Herbst 2010 hielt sie auf dem Gründungskongreß der Deutschen Fantastikforschung einen Vortrag über die Religiosität in Star Trek. Sie überlegte sich ernsthaft, von Cincinnati nach Los Angeles zu fliegen, nur um endlich die Paramount Studios besuchen zu können, wo die Serien gedreht wurden.
Francesca liebte die Tiere, ging gerne in den Zoo, wollte sich lange Zeit einen Hund zulegen und erwarb schlußendlich eine Katze. Beim Tauchen faszinierte sie die Unterwassertierwelt. Mit jener Sarah Pohl wurde ein Forschungsvorhaben zur jüdischen Tierethik vereinbart. Tierbabys in natura oder im Fernsehen, vor allem von Großtieren wie Elefanten, entzückten sie; Francesca kam ins Schwärmen und Schmachten, wie Großeltern beim Anblick ihrer neugeborenen Enkel. Im Zoo in Guilin, wo die Affen sich frei bewegten und durchaus das Gelände verließen, in der Vogelabteilung auf Madeira hatte sie ihre helle Freude.
In ihre Katze Samira, eine Britische Kurzhaarkatze, verliebte sie sich auf den ersten Blick. Sie erwarb im Frühjahr 2010 die drei Monate alte Zuchtkatze und kaufte daraufhin alles nur Erdenkliche, was eine Katze eventuell brauchen könnte, manches doppelt, manches Sinnlose. Sie schloß eine Krankenversicherung ab, meldete sich bei der GPS-Ortung verlorener Katzen an und war Samira gegenüber mindestens so hypochondrisch wie zu sich selbst. Der Kinderwunsch, der ab und an latent in der Psychoanalyse eine Rolle spielte, war mit diesem Haustier endgültig erledigt. Francesca hatte ein Baby, etwas zum Schmusen und Umhätscheln. Wenn das Ersatzbaby sich nachts zu ihr aufs Bett legte und schnurrte, war für Francesca die Welt heil, wie in der Kindheit. Auf dem Potsdamer Schreibtisch stand eine Postkarte mit einer lebhaft spielenden Katze und einem Satz von Rilke: »Das Leben und dazu eine Katze, das ergibt eine unglaubliche Summe!«
PARTNERIN
Francescas Geschichte läßt sich nicht zweigeteilt erzählen. Hier die Person, das Leben, das Schicksal ihres kurzen Lebens. Dort ihr Werk, ihre Philosophie, ihre Überzeugungen. Es muß ein Buch geschrieben werden, das der Einheit dieser beiden Seiten nachgeht. Francesca war eine authentische Jüdin genau darin, daß ihr Leben und ihr Werk ineinandergreifen, ihre Abstammung aus Rom und dem Judentum, ihre Emigration nach Deutschland, ihre Krankheit und ihr früher Tod auf der einen Seite, ihre Forschung, ihre Politik, ihr Verhalten den Menschen gegenüber, ihre Ethik auf der anderen. Ihr Politikbegriff verlangte diese Einheit ihres Lebens, ihres Menschlichseins und ihrer Arbeit. So hatte ihr kurzes Leben den Charakter eines Projekts, Aussöhnung auf verschiedenen Ebenen zu leben, es zumindest zu versuchen. Zu diesem Projekt gehörte unverbrüchlich ihre Ehe mit mir. Daß sie einen Deutschen mit sehr ähnlichen kulturellen Absichten wählte, ist kein Zufall und entfaltet sein Gewicht. Ich kann daher nicht anders, als ihre Geschichte immer auch aus dem Blickwinkel meines eigenen Lebens zu erzählen. Wir hatten ein gemeinsames Projekt.
Der künftige Mann meiner größeren Schwester bekam Ende der 1960er Jahre einen Studienplatz für Medizin in Freiburg. Nachdem beide dorthin zogen, war ich regelmäßig in den Ferien Gast in dieser Stadt. Ich partizipierte als Teenager an den akademischen Kreisen, vor allem des Instituts für Medizingeschichte, an dem mein Schwager Assistent wurde. Ich gewöhnte mich an die »ökologische« Stadt des Südens, die mir zur zweiten Heimat war, nachdem ich im häßlichen und proletarischen Mannheim niemals recht heimisch geworden war. Anfang der 80er Jahre entdeckte ich, daß Freiburg, die Musikhochschule, genauer das dortige Institut für neue Musik, das Mekka des fortschrittlichen Komponierens war, sozusagen eine Freiburger Schule in sich barg wie einst die österreichische Hauptstadt die Zweite Wiener. Dort lernte ich im Sommer 1984 Brian Ferneyhough kennen, einen Jahrhundertkomponisten, einen der luzidesten Lehrer seiner Zeit. Freiburg bot mir mithin das optimale Klima, Musik zu studieren, zu komponieren und die berufliche Laufbahn aufzubauen.
Francesca wiederum begegnete auf der Suche nach einer Promotionsmöglichkeit, die das korrupte und mafiöse italienische System ihr vorenthielt, im Herbst 1998 auf Vermittlung des römischen Universitätsprofessors Marco Maria Olivetti dem deutschen Religionsphilosophen Bernhard Casper, der nicht zögerte, Francesca die Promotion zu vermitteln: Der Privatdozent Hans-Helmuth Gander wurde Erstgutachter an der Philosophischen Fakultät, der Casper als Theologe nicht angehörte. Dieser wurde zum väterlichen Mentor und zum Zweitgutachter. Und wieder war es Freiburg: Casper war Ordinarius für Religionsphilosophie an der dortigen Universität. Was wäre gewesen, wenn er in Flensburg, Eichstätt, Trier oder Stralsund gelehrt hätte? Wohin hätten wir, von Rom kommend, gehen sollen? Eine Fernbeziehung? Ein Neustart an einem für Francesca zwar günstigen, für mich freilich gänzlich unpassenden Ort? Zum Glück stellte sich diese Frage nicht. Unser gemeinsamer Beginn war perfekt. Francesca wuchs in eine Familie hinein, die ihr die härtesten Anpassungen ans tägliche Leben abnahm, in die meine. Das ist für jemanden, der aus dem Ausland einwandert, von nicht zu unterschätzendem Wert.
Am Tage nach unserer Hochzeit fanden wir eine Wohnung an dem kleinen Flüßchen Dreisam, gelegen zwischen Berg und dem Wasser, quasi in der Natur, in jener Kartäuserstraße, in der auch der Südwestrundfunk mit einem der weltbesten elektronischen Studios, dem legendären Experimentalstudio, das mit Nono berühmt wurde, seinen Sitz hatte, an dem ich für Jahre arbeiten sollte. Die Wohnung gehörte einem alten Zahnarzt aus Breisach, der sie für seinen Freund, den Philosophen Max Müller, gekauft hatte, der dort starb, wo Francesca dann ihre philosophische Doktorarbeit schrieb.
Freiburg war also perfekt. Von dieser Stadt aus konnte sie ihre temporären Lehrverpflichtungen in Frankfurt, Heidelberg und Fribourg in der Schweiz problemlos erpendeln. Wenn ich im folgenden über die perfekte Partnerschaft nachdenke, dann sollte immer diese wundersame und zugleich ganz wunderbare Rolle, die diese Stadt spielte, im Gedächtnis behalten sein. Ich ging von Freiburg nach Rom, Francesca ging von Rom nach Freiburg. Bis 2007 war diese Strecke unsere Achse, später erweitert um die Achsen Freiburg/Berlin und Leipzig/Berlin.
Gibt es eine perfekte Partnerschaft? Bei uns waren die elementaren Voraussetzungen der Lebensführung die gleichen. Das hieß, daß wir beide keine Kinder wollten. Von Anfang an nicht. Francesca hatte das bereits in der Teenagerzeit für sich entschieden. Ich empfand ebenfalls niemals diesen Wunsch. Wir widmeten unser Leben der Arbeit. Der Selbstverwirklichung als Forscherin und Dozentin, als Komponist und Intellektueller galt unsere Priorität. Das war auch der Grund, warum wir uns nicht gegenseitig als Besitz betrachteten, auch wenn die tiefe Liebe, die uns verband, derlei erheischen könnte. Wir waren uns einig darin, dem anderen, um dessen beruflicher oder kreativer Laufbahn willen, die Freiräume zu gewähren, die er benötigte. Das betraf vor allem die Wahl des Ortes, an dem man lebt. Da Francesca so schnell wie möglich Professorin werden wollte, bewarb sie sich auch außerhalb Deutschlands und wurde alsbald in den USA und nach Großbritannien eingeladen. Aus meiner Sicht kann ich sagen: gottlob erfolglos. Aber ich wäre diese räumliche Distanz, einer zukünftigen Alternative im Blick, ihr zu konzedieren sehr wohl bereit gewesen, so wie ich wie selbstverständlich ihr den langen Israelaufenthalt gönnte, obwohl die terroristische Gefahr während der zweiten Intifada nicht zu unterschätzen war, was Freunde veranlaßte, mir einzuflüstern, ich solle doch ein eheliches Machtwort sprechen. Wir führten eine moderne Ehe. Wir waren beide emanzipiert. Wir ergänzten uns: Francesca war meine Fremdsprachensekretärin, Reiseleiterin, Museumsführerin und nicht selten das lebende Lexikon. Ich war ihr Steuerberater, Handwerker, Computerspezialist und Führer durch die deutsche Sprache.
Gibt es eine perfekte Verbindung? Waren wir nicht grundverschieden? Wie häufig wurde ich auf meinen musikalischen Reisen gefragt, ob denn meine Frau auch Musikerin (oder Komponistin) sei. Stets wies ich das zurück, mit Stolz und mit Freude. Nicht, daß ich etwas gegen Musikerinnen oder Komponistinnen hätte, aber ich war überglücklich, jemanden an meiner Seite zu haben, die eine ganz andere Welt mitbrachte. Äußerlich konnte man meinen, daß wir genau nicht zusammenpaßten. Ich bin nicht religiös, ja geradezu atheistisch und meide kollektive Rituale, zu denen nun einmal auch die religiösen gehören. Francesca wiederum war zwar musikalisch und sang gerne, Musik gehörte aber nicht zu ihren Wissensgebieten (alle Bücher, die ich ihr schenkte, wurden geflissentlich ignoriert); sie konnte mit Musik ohne Worte kaum etwas anfangen. Sie liebte es, mir zuzuhören, wenn ich die Aria der Goldbergvariationen spielte. Aber danach war es auch schon wieder vorbei. Wir besuchten Opern, aber keine Konzerte. Außer denen mit meiner Musik natürlich.
Wie konnte das gutgehen? Ein Mann, dem die Religion fremd ist, eine Frau, für welche die Musik, ähnlich Kant, kaum mehr ist als reizvolle Proportionen, aber kaum einen Geist enthält? Es mag banal klingen: gerade deswegen. Wir ergänzten uns. Es klappte wunderbar, es war niemals wirklich ein Problem. Zumal sie, nicht einfach aus Liebe, sondern mit guten Gründen, meiner Musik Geist zumaß. Es war ja nicht so, daß Francesca nicht die großen Klassiker kannte. Aber sie war Verdianerin, ich Wagnerianer, wenn man das zuspitzen darf. Sie blieb hier Italienerin. Während meiner Zeit als Konsultant der Stuttgarter Oper bei deren Jahrhundert-Ring besuchten wir alle Premieren. Obwohl sie etwa die Siegfried-Inszenierung unter einem theatralischen Blickpunkt hoch lobte, war ihr der schwere, der blechlastige Ton dieser Musik wesensfremd, ohne daß sie sofort die Antisemitismuskeule schwingen mußte.
Francesca war musikalisch und hätte wohl gerne in der Jugend ein Instrument erlernt. Sie hatte eine schöne, sonore Altstimme, die sie aber aus Scham versteckte. Ich hatte sie immer wieder vergebens ermutigt, Gesangsunterricht zu nehmen. Francesca kannte unzählige Lieder auswendig und konnte die Texte rezitieren. Sie liebte, neben jüdischen Gesängen, vor allem die italienischen Cantautori, jene hochgebildeten italienischen politischen Liedermacher wie Fabrizio de André, Francesco de Gregori oder Francesco Guccini. Sie wollte über die »Kritische Theorie der italienischen Cantautori« einen Text für Musik & Ästhetik schreiben. Der italienischen Popmusik à la Ti amo von Eros Ramazzotti schämte sie sich hingegen. Francesca hatte Kontakt zu Künstlern: Für den in Rom lebenden Künstler Andrea Battantier schrieb sie einen Text, dieser widmete dem »child Francesca« ein Video über Konzentrationslager.
Musik mußte für sie mit Text oder Handlung verbunden sein. Als sie, die Freiburger Studentin, in ein akademisches Konzert gebeten und von mir über die Länge einer Mahlersymphonie aufgeklärt wurde, schob sie eine Krankheit vor. Daher liebte sie die Oper oder Chorgesang, so aus der Renaissance, die sie in meiner CD-Sammlung entdeckte. Bei Puccini schmolz sie dahin. Als sie in einer Kirche Thomas Tallis’ berühmte 40stimmige Motette Spem in alium hörte, war sie enthusiasmiert. An Opernabenden interessierte sie die Inszenierung mehr als die Musik. Wenn diese ihr nicht lag, konnte sie das Haus auch früher verlassen. Bei der Uraufführung von Klaus Hubers Schwarzerde in Basel konnte ich sie gerade noch aufhalten. Immerhin war Huber mein Kompositionslehrer und Francesca von seiner Erscheinung äußerst angetan. Aber für sie zählte der Inhalt, der Stoff mehr als die Musik.
Francesca liebte die Harfe. Immer wieder versuchte sie mich zu einer speziell ihr gewidmeten Harfenkomposition zu verführen. Ich wies sie auf den diatonischen Charakter dieses Instruments hin und daß dies mit meiner musikalischen Sprache schwer zu vereinbaren wäre – was sie aber nicht verstand. Ich solle nicht chinesisch reden, antwortete sie mir. Dabei hatte ich bereits ein Harfensolostück geschrieben. Sie wünschte sich jedoch ein eigenes, persönliches. 2010 überlegte sie sich ernsthaft, eine Handharfe zu kaufen und sich das Spiel autodidaktisch anzueignen. Hierzu vertiefte sie sich in eine Einführung in die Notenschrift. Sie entdeckte die dem Fünfliniensystem innewohnende Unregelmäßigkeit zwischen Ganz- und Halbtonschritten und beschwerte sich bei mir über solche Irrationalität, die ihr nur Zeit raube. Als ich erklärte, daß wir diesen Unebenheiten die Tonalität zu verdanken haben, erreichte meine Rede sie nicht mehr. Sie hatte bereits innerlich abgeschaltet. Von einer Harfe war nicht mehr die Rede.
Die Musik verband uns also nicht oder nur wenig. Doch die Gemeinsamkeiten waren überwältigend. Wir mochten nicht: Horoskop und Esoterik, Adlige, laute, lärmige Musik, extrem geschminkte Frauen, Kreuzfahrten (ich foppte sie, sie werde wohl kaum ablehnen können, wenn ich ihr eine Kreuzfahrt schenkte; sie drohte daraufhin mit Scheidung), teure Autos, Pelzmäntel, den Papstkult, Fußball, Scharlatanerie in der Kunstszene, die Postmoderne. Wir verachteten Westerwelle, amüsierten uns über den Freiherrn zu Guttenberg, Berlusconi verabscheuten wir. Wir mochten Bruno Ganz, Woody Allen, Venedig, Katzen, Kartoffeln (Francescas, der Italienerin, Lieblingsbeilage), Ironie, Bücher, Reisen, Politik, Philosophie, Theater, Museen. »Mein Leben besteht auch aus Literatur, Politik, Theater, Oper und Freunden«, schrieb sie einmal. Das war bei mir nicht anders. Regelmäßig fuhren wir nach Basel zu den Museen, in Berlin gingen wir in jede wichtige Ausstellung, in Rom sowieso.
Häufig verständigten wir uns über philosophische Metaphern. Zu unserer Hochzeit im September 1999 beschenkten wir uns gegenseitig. Ich bekam eine sechsbändige Aristotelesausgabe. Die Widmung: »Aristotelicamente, tu sei il ›sinolo‹ della mia vita!« »Aristotelisch gesehen, bist Du die Substanz meines Lebens.« Natürlich hatten wir intellektuelle Differenzen, etwa, was die Einschätzung von Derrida betraf. Er war für sie ein genialer Schriftsteller, aber kein genialer Philosoph, der Lévinas für sie war. In politischen Fragen trennte uns ihre Ungeduld. Sie wollte die Demokratie in China jetzt, das Elektroauto jetzt, die Abschaffung des Hungers jetzt, die Reform des Kapitalismus jetzt, die Überwindung revanchistischer Bewegungen in Europa jetzt. Es konnte ihr nicht schnell genug gehen. Immerhin las sie auf meine Anregung hin das eine oder andere politische Buch, das pragmatische und nicht nur prinzipielle Lösungen vorschlägt, so von Franz Josef Radermacher oder Jeffrey Sachs. Da für uns beide die Vernunft – und nicht etwa der Glaube oder die Ideologie – an erster Stelle stand, konnten wir uns rasch verständigen. Unterschiede ergaben sich aus der unterschiedlichen Lebenserfahrung, dem Alter, der Herkunft, Interessenlage, dem Geschmack und Temperament – mithin Allzumenschlichem. Aber einen Grunddissens gab es für uns nicht. Wir hätten ohne großen Konflikt ein Buch zusammen schreiben können.
Wer religiös ist, könnte sagen, daß Gott uns zusammengeführt hat. Aber nicht in dem einfachen Sinne, daß er die Liebe zweier Menschen stiftet; eher in dem, daß zwei füreinander bestimmt scheinen und der Zufall, der sie zusammenführt, keiner sein kann. Uns verband die messianische Idee. Es war ihr Thema. Nicht nur im Messiasbuch und in der entsprechenden Vorlesung, sondern insgesamt. Das gilt aber auch für mich, seit ich in den frühen Kindestagen mit gesellschaftlichen Revolutions- und Erlösungsthemen der 1968er Zeit geradezu vollgepumpt wurde und kaum anders darauf zu reagieren wußte, als mir einen idealen Staat auszumalen. Als ich zehn Jahre später Adorno und den Schlußaphorismus zum Messianischen Licht in den Minima Moralia entdeckte, war es wie eine Wiedergeburt. Auf eine neue Reflexionsstufe wurde mein latenter Messianismus weniger durch das Studium, so in Frankfurt, gehoben, als durch die Begegnung mit der Jüdin, die Francesca war. Es ist schließlich kein Zufall, daß ich eines Tages ein großes Chorstück mit dem Messiastext von Maimonides komponieren sollte.
Unsere Liebe ging bis zu einer Art siamesischer Verschwisterung. Mir fiel irgendwann auf, daß ich im Kreise meiner Leipziger Studenten nicht nur häufig über Francesca sprach, sondern das in einer Art und Weise tat, als ob sie eine allseitig bekannte Persönlichkeit sei. Wie Francesca andernorts über mich sprach, erfuhr ich erst später. Eine Kollegin von der University of Amsterdam schreibt: »Im Sommer 2001 traf ich sie wieder in Oxford, auf einem Sommerkolloquium in Yarton Manor. Ich erinnere mich klar, daß es Ihr Hochzeitstag war, und sie war so glücklich, von Ihnen zu hören und Blumen zu empfangen. Sie erzählte das der gesamten Gruppe und strotzte vor Glück. Es war offensichtlich, daß sie sehr stolz auf Sie war.« Ein Kollege in Potsdam schrieb ihr einmal: »Warum sagst Du mir nicht, daß Du einen so berühmten Mann hast? Ich dachte immer, Dein Mann ist einer jener Partner, die froh sind, wenn etwas Licht vom Gatten auf sie herabfällt und die mit tränennassen Augen im Auditorium sitzen, wenn der Gatte irgendwo geehrt wird. Bei euch wird das eher ein Spiegelungsverhältnis sein.« Francesca antwortet: »Du hast mich nie nach meinem Mann gefragt … Jetzt aber im Ernst: Ich bin auf meinen Clausi sehr stolz.« Aus Hawaii kam die Beobachtung: »Francesca hat Sie sehr geliebt und mit großer Bewunderung von Ihrem Talent gesprochen.« Jeder Witwer hört das gerne.
Die vielleicht wunderbarste Seite an Francesca war ihr phänomenaler Witz. Ironie war ihr Element, und sie litt darunter, daß die Deutschen diese häufig nicht verstünden, weil sie sie für bare Münze nähmen. Francescas mitunter harte, ja bissige, aber niemals zynische Bemerkungen (»Die Universitätsverwaltung zwingt mich zum Amoklauf«) erzeugten eine gewisse Leichtigkeit, um über das am Leben eben nicht Leichte hinwegzukommen. Ihre umfassende Bildung half ihr dabei, natürlich auch, daß sie aus mindestens zwei zusätzlichen Welten kam, der römischen und der jüdischen. Als der Verlag ihres ersten Buches ein graues Cover vorschlug, schrieb sie zurück, es erinnere sie an das größte Gefängnis in Rom. Das Buch erschien dann in Knallrot, ihrer Lieblingsfarbe, der Farbe der Liebe, des Feuers und der Leidenschaft, wie sie sagte. War sie erzürnt, rief sie durchaus: »Ich schicke den Mossad!« Wurden wir der häßlichen und geschmacklosen Seiten der Deutschen ansichtig, seufzte sie auf: »Mein Volk …« Wir konnten ganze Abende im Restaurant im Tonfall der Ironie, der Indirektheit und des Humors verbringen. Witze waren gleichfalls ein Medium unserer Weltverständigung.
Francesca war von genialischem Zuschnitt, eine Ausnahmebegabung. Aber das Attribut »Genie« adressierte sie an mich zurück. Das hört man als Komponist zwar gerne, ich wollte aber doch die genauere Begründung hören. Sie antwortete mit Kant: ein schöpferischer Geist, welcher der Materie die Regeln aufzwingt. Sie bewunderte mich als Komponisten auch, weil sie davon nichts oder kaum etwas verstand. Aber sie hörte den Geist in meiner Musik. Wie genau sie dafür Worte finden konnte, zeigt sich an meiner oktophonischen Raumkomposition void – mal d’archive, in der Klänge aus Libeskinds Berliner Jüdischem Museum verarbeitet sind. Sie nannte das Werk ein »Requiem ohne Gott«. Ich habe bisher keine trefflichere Formulierung gefunden. Vermutlich hatte Francesca recht, wenn sie das Schöpferische in mir verortete. Ihre philosophische Doktorarbeit war auch weniger ein eigenständiger systematischer Entwurf. Francesca war viel eher eine Person, deren hermeneutische Kraft sich ganz entfaltete, wenn sie mit fremden Texten konfrontiert wurde, wie es ihr Freiburger Mentor Casper einmal treffend formulierte.
Die Intellektuelle Francesca ließ sich nicht blenden. Da sie möglichst viele Bücher kaufte, die ihren Interessen entsprachen, erwarb sie auch das Buch Das Wissen der Religion von Norbert Bolz, ohne zu ahnen, wer dieser Autor ist. Sie las es auf unserer Andalusienreise. Zunächst sagte ich nichts und wartete ab. Nach etwa 30 Seiten klappte sie frustriert das Buch zu. »Da steht nichts Originelles drin, und vieles ist einfach nur sachlich falsch oder uninformiert.« Das war der Zeitpunkt, sie über den Blender und Pseudophilosophen, der Bolz nun einmal ist, aufzuklären, über einen Autor, der großspurig auftritt, im besseren Fall aber nur Allgemeinplätze verkündet. Ich mußte schmunzeln, eine andere Reaktion von ihrer Seite hätte mich gewundert.
Wie ich schon andeutete und Tamara Albertini in ihrer Beschreibung bestätigt, trat Francesca nicht als Intellektuelle auf. Es fehlte ihr die Arroganz, vielmehr war sie getragen von Demut. Ihr fehlte das paranoische Gesicht weiblicher Intellektueller, die bereits auf Angriff gehen, bevor überhaupt etwas gesagt ist. Francesca war weder Kampffeministin noch Kampfjüdin, auch keine Kampfphilosophin. Sie wußte, daß sie, der »shooting star«, das nicht nötig hatte; sie lebte ein anderes Leben, eines, das nicht trennt zwischen Leben und Arbeit, zwischen Lebensvollzug und der weltanschaulichen Ausrichtung. Ihre Gesichtszüge hatten nichts von dem Verhärmten, Angespannten, Kopflastigen, Besserwisserischen, dem man so häufig in Deutschland unter Akademikern begegnet, auch nichts von der ewigen Opferrolle der Jüdin, deren Volk vernichtet werden sollte. Sie hatte auch nichts von einem Minderwertigkeitskomplex des zu Recht oder zu Unrecht verkannten Genies. Schon eher hatte sie etwas von einer Schauspielerin, wandelbar, ausdrucksstark, facettenreich, klug. Selbst für mich, der sie auch anders erlebte, ist frappant, daß sie auf fast allen Bildern in die Kamera lacht. Sicher, das war auch dem Gegenüber geschuldet. Aber diese hier ausgedrückte Lebensfreude muß man erst einmal in sich spüren. Das Harte im Gesicht einer Hannah Arendt fehlte ihr gänzlich. Eher könnte man sie mit Anne Frank, Etty Hillesum und Simone Weil vergleichen, zumal Francesca immer wesentlich jünger aussah, als sie war. Es gibt ein Bild aus Las Vegas, auf dem die 32jährige wie ein Teenager aussieht. Francesca bleib immer auch ein Kind. Selbst noch als Professorin. Eine Doppelexistenz eben.