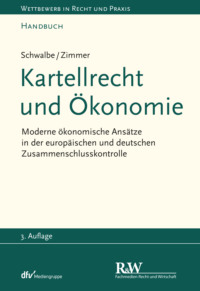Kitabı oku: «Kartellrecht und Ökonomie», sayfa 6
a) Bertrand-Wettbewerb: Preiswettbewerb mit homogenen Gütern
In einem Markt, in dem die Unternehmen ein homogenes Produkt herstellen, keinen Kapazitätsbeschränkungen unterliegen, mit konstanten und gleichen Stückkosten produzieren und der Wettbewerbsparameter der Preis ihres Produktes ist, führt das Nash-Gleichgewicht zur gleichen Menge und zum gleichen Preis wie im Fall des vollkommenen Wettbewerbs.78 Im Bertrand-Modell mit homogenen Gütern verlangt jedes Unternehmen im Nash-Gleichgewicht einen Preis, der den Grenzkosten bzw. den Stückkosten entspricht.79 Der Grund dafür kann am Beispiel mit zwei Unternehmen verdeutlicht werden. Würde ein Unternehmen seinen Preis unter denjenigen senken, der seinen Grenzkosten entspricht, also unter den Preis, der bei vollkommenem Wettbewerb herrschen würde, dann könnte es zwar die gesamte Nachfrage auf sich ziehen, würde aber einen Verlust erwirtschaften. Ein Abweichen mit dem Preis nach unten wäre also nicht lohnend. Würde es dagegen einen höheren Preis verlangen, dann könnte das Unternehmen nichts mehr absetzen, denn alle Konsumenten würden nun beim günstigeren Konkurrenten kaufen. Es besteht daher auch kein Anreiz, mit dem Preis nach oben abzuweichen. Da also kein Unternehmen einen Anreiz hat, einseitig seine Strategie zu ändern, handelt es sich bei diesen Preisen um ein Nash-Gleichgewicht. Man könnte sich auch vorstellen, dass sämtliche Unternehmen den gleichen Preis verlangen, der aber über den Grenzkosten liegt. In diesem Fall könnten die Unternehmen einen positiven Gewinn erwirtschaften. Aber ein solcher Preis wäre kein Nash-Gleichgewicht, denn würde ein Unternehmen seinen Preis geringfügig senken, dann könnte es die gesamte Nachfrage auf sich ziehen und dadurch einen deutlich höheren Gewinn erzielen – der Gewinn pro Stück wäre fast gleich geblieben, aber die abgesetzte Menge hätte drastisch zugenommen. Das andere Unternehmen würde „leer“ ausgehen und hätte seinerseits nun wieder einen Anreiz, seinen Preis unter den des Konkurrenten zu senken, um die gesamte Nachfrage an sich zu ziehen. Diese Überlegungen machen deutlich, dass sich im Nash-Gleichgewicht die gleichen Preise, Mengen und Gewinne ergeben wie bei vollkommenem Wettbewerb. Entscheidend für diesen starken Wettbewerbsdruck zwischen den Unternehmen ist die Reaktion der Nachfrage auf eine Preisänderung: Eine kleine Preissenkung unter den Preis des Konkurrenten führt zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage, eine Preiserhöhung über den Preis des Konkurrenten führt zu einem völligen Verlust jeglicher Nachfrage.
b) Bertrand-Modell mit Kapazitätsbeschränkungen – Edgeworth-Zyklen
Das Standard-Bertrand-Modell setzt jedoch voraus, dass die Unternehmen keinerlei Kapazitätsbeschränkungen unterliegen, d.h. jedes Unternehmen ist in der Lage, immer die gesamte Nachfrage zu befriedigen. Wenn diese Bedingung jedoch nicht erfüllt ist, dann ist ein Preis in Höhe der Grenzkosten kein Nash-Gleichgewicht mehr.80 Dies kann anhand eines einfachen Beispiels illustriert werden. Angenommen, die Nachfragefunktion sei gegeben durch x(p) = 1000 – p und die Unternehmen 1 und 2 produzieren mit Grenzkosten in Höhe von 280 bis zu einer maximalen Kapazität von 360 Einheiten. Würden beide Unternehmen einen Preis in Höhe der Grenzkosten, d.h. von 280 verlangen, dann würde die Menge von 1000 – 280 = 720 Einheiten nachgefragt werden. Diese Menge könnte mit den Kapazitäten der beiden Unternehmen hergestellt werden. Allerdings sind nun Preise in Höhe der Grenzkosten kein Gleichgewicht mehr, denn jedes Unternehmen hat einen Anreiz, einseitig von diesem Preis abzuweichen und einen höheren Preis zu verlangen. Ohne Kapazitätsbeschränkungen würde nun die gesamte Nachfrage vom Unternehmen mit dem geringeren Preis gedeckt werden. Dies ist nun aber aufgrund der Kapazitätsbeschränkung nicht möglich. Würde z.B. Unternehmen 1 einen höheren Preis verlangen, verbliebe ihm eine Restnachfrage in Höhe von xr(p) = 640 – p. Gegenüber dieser Restnachfrage ist Unternehmen 1 Monopolist und würde den gewinnmaximierenden Preis in Höhe von 460 verlangen. Bei diesem Preis würde es die Menge von 180 Einheiten verkaufen und einen Stückgewinn von 180 erzielen. In der Regel wird angenommen, dass die Konsumenten mit der höchsten Zahlungsbereitschaft das Gut zum günstigeren Preis erwerben können, d.h. dass eine effiziente Rationierung vorliegt.81
In der beschriebenen Situation könnte Unternehmen 1 also profitabel von einem Preis in Höhe der Grenzkosten abweichen. Allerdings würde nun Unternehmen 2 diesen Preis unterbieten können und bei einem etwas geringeren Preis, z.B. 459,99, seine gesamte Kapazität in Höhe von 360 Einheiten absetzen und einen (fast) doppelt so hohen Gewinn realisieren wie Firma 1.82 Dieser Preis würde wiederum von Unternehmen 1 unterboten werden, sodass auch dies kein Gleichgewicht ist. Würde ein Unternehmen jedoch einen Preis in Höhe von 370 oder weniger verlangen, dann könnte sich das andere Unternehmen besser stellen, wenn es einen Preis von 460 fordern würde. Bei einem Preis von 370 und einer abgesetzten Menge von 360 wäre der Gewinn der gleiche wie bei einem Preis von 460 und 180 verkauften Einheiten: 370 * 360 – 280 * 360 = 460 * 180 – 280 * 180 = 32400. Dieses Beispiel zeigt, dass wegen der Kapazitätsbeschränkungen kein Gleichgewicht existiert.83 Auf diese Tatsache hat bereits Edgeworth (1897) aufmerksam gemacht. Er ging bei seiner Überlegung von einem Prozess des gegenseitigen Unterbietens aus, der beim Monopolpreis beginnt und sich dann bis zu einem Preis fortsetzt, bei dem es für ein Unternehmen wieder profitabel wird, den hohen Preis zu setzen. Man spricht bei solchen Prozessen daher von Edgeworth-Zyklen.84 Im Zusammenhang mit der Sektoruntersuchung des Kraftstoffmarktes, die das Bundeskartellamt im Jahr 2011 durchgeführt hat und die ein zyklisches Preissetzungsverhalten der Mineralölkonzerne festgestellt hat, sind Edgeworth-Zyklen intensiv diskutiert worden.85
c) Mengenwettbewerb mit homogenen Gütern
In ähnlicher Weise wie das Bertrand-Modell kann auch die Situation des Mengenwettbewerbs bei einem homogenen Gut, d.h. das Cournot-Modell, analysiert werden. Exemplarisch wird ein Duopol betrachtet, in dem die Unternehmen mit gleichen und konstanten Grenzkosten produzieren. Hier müssen sie darüber entscheiden, welche Menge des Produktes sie jeweils herstellen und am Markt anbieten sollen. Der Preis wird sich dort so bilden, dass die insgesamt hergestellte Menge auch abgesetzt werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine größere Angebotsmenge mit einem geringeren Marktpreis verbunden ist, d.h., die Duopolisten sehen sich einer fallenden Nachfragefunktion gegenüber.
Das Nash-Gleichgewicht im Cournot-Modell kann am einfachsten durch einen Vergleich mit einem Monopol erläutert werden. Wie auf den Seiten 22–25 gezeigt, wird ein Monopolist die Preisänderung, die er durch eine Mengenerhöhung induziert, bei seiner Entscheidung berücksichtigen und wird eine geringere Menge zu einem höheren Preis anbieten als bei vollkommenem Wettbewerb. Im Cournot-Duopol gibt es einen ähnlichen Zusammenhang: Jedem der beiden Unternehmen ist bewusst, dass eine Mengenausweitung zu einer Senkung des Marktpreises führen wird. Allerdings betrifft diese Preissenkung nun nicht nur das Unternehmen, das seine Menge ausdehnt, sondern gleichzeitig auch das andere, das seine Produktionsmenge nicht verändert hat. Dieses Unternehmen hätte eine Erlöseinbuße zu verzeichnen: Es verkauft die gleiche Menge zu einem geringeren Preis. Dieser Effekt ist für das andere Unternehmen jedoch irrelevant und geht in sein Entscheidungskalkül nicht mit ein. Ein Teil des Preissenkungseffektes wird also von einem Unternehmen, das seine Menge erhöht, nicht berücksichtigt.
Wie wird nun das andere Unternehmen auf eine Mengenausweitung des Konkurrenten reagieren? Würde es die Menge ebenfalls erhöhen, dann würde das zu einem Preisverfall am Markt führen. Um diesen zu vermeiden, wird das andere Unternehmen als Reaktion auf die Mengenausweitung mit einer Reduktion der eigenen Produktionsmenge reagieren. Allerdings wird diese Mengenreduktion insgesamt geringer ausfallen als die Mengenerhöhung des ersten Unternehmens. Analog wird bei einer Mengenreduktion eines Unternehmens das andere Unternehmen mit einer Produktionsausweitung reagieren, denn die Reduktion der Menge führt zu einem Preisanstieg, der für die anderen Unternehmen einen Anreiz für eine leichte Mengenausweitung darstellt. Die Mengenreaktionen verlaufen also in entgegengesetzter Richtung, d.h. die Mengen im Cournot-Modell sind so genannte strategische Substitute. Im Gleichgewicht des Cournot-Modells würde eine einseitige Mengenerhöhung einerseits zwar zu einem zusätzlichen Erlös aufgrund der größeren abgesetzten Menge führen. Andererseits verursacht die größere Produktionsmenge zusätzliche Kosten und der Marktpreis würde aufgrund der Mengenerhöhung zurückgehen. Der zweite Effekt überwiegt jedoch den ersten, sodass sich ein Abweichen vom Gleichgewicht lohnt.
Das Nash-Gleichgewicht in einem Markt mit Mengenwettbewerb ist gegeben durch eine Kombination von Angebotsmengen, sodass kein Unternehmen einen Anreiz hat, sein Angebot bei gegebener Menge des anderen zu verändern. Insgesamt wird im Gleichgewicht eine größere Menge angeboten als bei einem Monopol, da jedes Unternehmen nur einen Teil des von ihm verursachten Preiseffektes berücksichtigt. Die insgesamt hergestellte Menge ist jedoch geringer als die bei vollkommener Konkurrenz, da ja die Auswirkung von Mengenerhöhungen zumindest teilweise berücksichtigt werden. Das Marktergebnis bei oligopolistischem Mengenwettbewerb mit einem homogenen Gut liegt also zwischen dem bei vollkommenem Wettbewerb und dem beim Monopol. Dies zeigt, dass der Wettbewerbsparameter einen gravierenden Einfluss auf das Marktergebnis hat: Während bei Preiswettbewerb das gleiche Ergebnis resultiert wie bei vollkommenem Wettbewerb, wird im Cournot-Oligopol eine geringere Menge zu einem höheren Preis angeboten. Der Grund für diesen Unterschied liegt vor allem an unterschiedlichen Reaktionen der Nachfrage in den beiden Modellen. Bei Preiswettbewerb reagiert die Nachfrage äußerst sprunghaft – kleine Preisunterschiede führen zu dazu, dass ein Unternehmen entweder überhaupt keine oder aber die gesamte Nachfrage bekommt. Dies erzeugt einen extremen Wettbewerbsdruck, der ein Resultat hervorbringt, das dem bei vollkommener Konkurrenz entspricht. Bei Mengenwettbewerb hingegen ist die Reaktion der Nachfrage auf eine Mengenänderung weitaus moderater. Bei einer Mengenreduktion wird zwar der Preis des Gutes etwas steigen, aber dies führt nur zu einer Verringerung der Nachfrage, nicht aber zu ihrem völligen Verschwinden. Die Nachfrage bei Mengenwettbewerb reagiert also weitaus unelastischer als bei Preiswettbewerb. Der Wettbewerbsdruck ist bei Mengenwettbewerb daher deutlich geringer und dies führt einerseits zu niedrigeren Mengen, höheren Preisen und damit einer geringeren Konsumentenwohlfahrt und andererseits zu höheren Gewinnen für die Unternehmen.86
Das Ergebnis in einem Markt mit Mengenwettbewerb hängt auch von der Zahl der im Markt aktiven Unternehmen ab. Gäbe es nicht nur zwei, sondern vier gleiche Unternehmen im Markt, dann beträfen die Auswirkungen einer Mengenerhöhung eines Unternehmens jetzt nur noch zu 25 % das eigene Unternehmen –75 % des Effektes entfielen auf die anderen drei Unternehmen und werden bei einer Entscheidung nicht berücksichtigt. Ein Unternehmen würde daher eine größere Menge anbieten, da der Preissenkungseffekt von geringerer Bedeutung wäre. Je größer die Anzahl der Unternehmen im Markt ist, desto geringer ist der Anteil des Effektes, der auf das eigene Unternehmen entfällt. Dies legt die Vermutung nahe, dass mit wachsender Zahl der Unternehmen auch insgesamt eine größere Menge angeboten wird. Man kann zeigen, dass im Fall einer sehr großen Zahl von Unternehmen das Marktergebnis dem bei vollkommenem Wettbewerb entspricht.87 Umgekehrt gilt natürlich, dass bei einer geringeren Zahl von Unternehmen die am Markt angebotene Menge abnimmt und im Grenzfall mit einem Unternehmen der Monopolmenge entspricht. Zunehmende Konzentration in einem Markt mit Mengenwettbewerb geht also mit geringeren Mengen und steigenden Preisen einher.
d) Bertrand-Wettbewerb mit differenzierten Gütern
Die bisher getroffene Annahme homogener Güter ist zur Beschreibung vieler Märkte weniger geeignet, denn die meisten Güter, auch wenn sie sich sehr ähnlich sind, unterscheiden sich in gewissen Aspekten, sind also nicht vollkommen homogen. Daher wird im Folgenden die Analyse oligopolistischer Gleichgewichte auf den Fall differenzierter Güter übertragen.88 Im Bertrand-Modell mit homogenen Gütern führte die große Preiselastizität der Nachfrage zum gleichen Resultat wie bei vollkommenem Wettbewerb. Bei differenzierten Gütern hingegen ist die Preiselastizität der Nachfrage deutlich geringer, da die Nachfrager, ähnlich wie im Modell der monopolistischen Konkurrenz, unterschiedliche Präferenzen für die Varianten des Gutes haben.89 Ein Konsument wäre daher nicht so leicht bereit, die von ihm präferierte Variante durch eine andere zu substituieren – differenzierte Güter sind nur unvollkommene Substitute. Wenn nun ein Unternehmen den Preis seines Produktes erhöht, dann weichen nicht mehr alle Konsumenten auf andere Güter aus, sondern nur diejenigen, deren Präferenz für das betrachtete Gut am wenigsten ausgeprägt ist, die marginalen Konsumenten. Dem Unternehmen verbleibt eine gewisse „Stammkundschaft“, die das Produkt selbst bei gestiegenem Preis weiterhin erwirbt und der gegenüber er über eine gewisse „Marktmacht“ verfügt. Die Anzahl der marginalen Nachfrager hängt natürlich auch vom Ausmaß der Preiserhöhung ab – je stärker die Preissteigerung, desto mehr Konsumenten werden auf Substitute ausweichen. Die geringere Preiselastizität der Nachfrage bei differenzierten Gütern erlaubt es einem Unternehmen, einen Preis zu verlangen, der über dem Wettbewerbspreis liegt, ohne gleich die gesamte Nachfrage zu verlieren.
Wenn nun ein Unternehmen den Preis für sein Produkt erhöht, würden einige Nachfrager auf Substitute ausweichen und die Nachfrage nach diesen Substituten würde zunehmen. Diese Unternehmen könnten daher eine größere Menge absetzen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage würden sie nun ihrerseits auch den Preis ihres Produktes etwas anheben. Diese Preiserhöhung wird geringer ausfallen, als die anfängliche ihres Konkurrenten.90 Analog kann man bei einer Preissenkung eines Unternehmens argumentieren: Senkt ein Unternehmen den Preis seines Produktes um einen bestimmten Betrag, dann wird das Unternehmen nur einen Teil der Kunden anderer Unternehmen dazu bewegen können, zum günstiger gewordenen Produkt zu wechseln. Viele Nachfrager werden jedoch weiterhin die relativ teurer gewordenen Produkte der Konkurrenten erwerben. Da aber die Nachfrage für diese Unternehmen zurückgegangen ist, werden diese, um den Nachfragerückgang auszugleichen, ihre Preise ebenfalls etwas senken, allerdings nicht im gleichen Maße, denn sie verfügen über eine „Stammkundschaft“, die nicht so leicht bereit ist, zu einem für sie unvollkommenem Substitut zu wechseln, selbst wenn dieses etwas günstiger ist. Die Preisreaktionen der Oligopolisten verlaufen also in die gleiche Richtung: Bei einer Preiserhöhung eines Unternehmens werden die Konkurrenten ihre Preise ebenfalls etwas anheben, bei einer Preissenkung müssen sie mit ihren Preisen ebenfalls heruntergehen. Die Preise im Bertrand-Modell mit differenzierten Gütern werden daher als strategische Komplemente bezeichnet.91
Ein Nash-Gleichgewicht in einem oligopolistischem Markt mit differenzierten Gütern und preissetzenden Unternehmen besteht also aus einer Strategienkombination in Form einer Liste von Preisen, bei denen kein Unternehmen ein Interesse daran hat, den eigenen Preis zu senken oder zu erhöhen, wenn die anderen Unternehmen ihre Preise nicht ändern. Die Preise im Gleichgewicht werden über den Grenzkosten liegen, weil die Güter nur unvollkommene Substitute sind und die Unternehmen daher gegenüber ihrer „Stammkundschaft“ über eine gewisse Marktmacht verfügen. Dabei ist die Abweichung von den Grenzkosten eng mit dem Grad der Substituierbarkeit der Güter verknüpft: Bei vollkommenen Substituten ergibt sich wieder das Resultat des ursprünglichen Bertrand-Modells, d.h. Wettbewerbspreise in Höhe der Grenzkosten. Nimmt der Differenzierungsgrad zwischen den Gütern zu, werden die Preise für die Güter steigen – im Grenzfall, d.h. wenn die Güter überhaupt nicht mehr substituierbar sind, ist jedes Unternehmen Monopolist in Bezug auf sein Gut und wird den Monopolpreis verlangen. Man kann aus diesen Überlegungen die folgenden Schlüsse ziehen: 1. Je höher der Preis eines Unternehmens, desto höher werden die Preise der Konkurrenten sein; 2. je enger die Substituierbarkeit zwischen den Gütern, desto niedriger sind die Preise.
e) Cournot-Wettbewerb mit differenzierten Gütern
Die Unterschiede zwischen einem Modell des Mengenwettbewerbs mit differenzierten Gütern und einem mit einem homogenen Gut sind gering und hängen vom Differenzierungsgrad ab: Je engere Substitute die Güter sind, desto ähnlicher ist das Marktergebnis dem bei einem homogenen Gut, d.h. dem ursprünglichen Cournot-Modell.92 Je größer der Differenzierungsgrad, d.h. je schlechtere Substitute die Güter sind, desto unabhängiger sind die Oligopolisten von einander, desto höher sind die resultierenden Preise und desto geringer die angebotenen Mengen. Im Grenzfall der völligen Unabhängigkeit der Güter ist jedes Unternehmen Monopolist bezüglich des von ihm angebotenen Gutes und wird die Monopolmenge zum Monopolpreis anbieten.
f) Weitere Modelle oligopolistischen Wettbewerbs
In den bisher dargestellten Modellen oligopolistischen Wettbewerbs wurde implizit davon ausgegangen, dass die Unternehmen ihre Preis- bzw. Mengenentscheidungen in Unkenntnis der Entscheidungen ihrer Konkurrenten treffen bzw. dass sie simultan über Preise und Mengen entscheiden. Es können jedoch auch Situationen auftreten, in denen erst ein Unternehmen seine Preis- oder Mengenentscheidung trifft und dann die anderen Oligopolisten, in Kenntnis dieser Entscheidung, ihre Strategien wählen.93 Die Gründe dafür, dass ein Unternehmen zum Preis- oder Mengenführer wurde, können darin liegen, dass es durch eine erfolgreiche Innovation als erstes in einen Markt eingetreten ist und die anderen Unternehmen als Nachzügler erst nach dem Preis- oder Mengenführer agieren können.
Ein preisführendes Unternehmen kann bei seiner Preispolitik die Reaktionen der Konkurrenten in sein Entscheidungskalkül miteinbeziehen, während die Konkurrenten den vom Preisführer gesetzten Preis als gegeben hinnehmen müssen.94 Offensichtlich spielt es bei Preiswettbewerb mit einem homogenen Gut keine Rolle, ob die Preise simultan oder sequentiell gesetzt werden, das Ergebnis wird immer das gleiche sein wie bei vollkommenem Wettbewerb. Bei differenzierten Gütern ist die Situation jedoch eine andere: Der Preisführer muss damit rechnen, dass der Preisfolger den von ihm gesetzten Preis etwas unterbieten wird, um sich einen größeren Teil der Nachfrage zu sichern.95 Er wird dieses Verhalten des Preisfolgers antizipieren und daher von vornherein einen höheren Preis verlangen als bei simultaner Preissetzung. Dieser höhere Preis bietet dem Preisfolger nun die Möglichkeit, seinen Preis ebenfalls zu erhöhen, was wiederum einen positiven Effekt auf die Nachfrage für den Preisführer hat. Durch diese insgesamt höheren Preise wird der Wettbewerb in diesem Markt stärker beschränkt als bei simultaner Preissetzung und beide Unternehmen realisieren dadurch höhere Gewinne. Dabei erhält der Preisführer, aufgrund der Tatsache, dass der Preisfolger ihn etwas unterbieten kann, einen geringeren Gewinn als der Preisfolger. Dieses Modell macht deutlich, dass es bei Preiswettbewerb im Interesse aller Unternehmen liegt, ein Unternehmen als Preisführer zu akzeptieren, da sich hierdurch alle Unternehmen einen höheren Gewinn sichern können.96 Allerdings wäre jedes Unternehmen lieber Preisfolger, da dieser einen höheren Gewinn realisierten kann als der Preisführer.97
Das Modell des sequentiellen Mengenwettbewerbs geht auf von Stackelberg (1934) zurück. Es wird von einer Situation ausgegangen, in der sich ein Unternehmen, der Stackelberg-Führer, einseitig auf eine bestimmte Angebotsmenge festlegen kann und die anderen Unternehmen, die Stackelberg-Folger, mit ihrer Mengenentscheidung auf die vorgegebene Menge reagieren. Der Stackelberg-Führer kann, da er seine Menge zuerst wählt, die Reaktion der Stackelberg-Folger bei seiner Entscheidung berücksichtigen. Da die Mengen im Cournot-Modell strategische Substitute sind, werden die Stackelberg-Folger auf eine Mengenerhöhung seitens des Stackelberg-Führers mit einer Verringerung ihrer Angebotsmengen reagieren, um einen Preisverfall zu verhindern. Dies veranlasst den Stackelberg-Führer, eine größere Menge anzubieten als im Cournot-Nash-Gleichgewicht, wodurch er einen höheren Gewinn erzielen kann. Die Stackelberg-Folger bieten geringere Mengen an und realisieren einen niedrigeren Gewinn als im Cournot-Nash-Gleichgewicht mit simultaner Mengensetzung.98