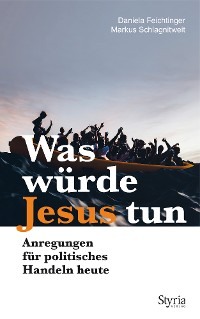Kitabı oku: «Was würde Jesus tun», sayfa 2
Drei Gründe, warum es schwierig ist, Salz zu sein
Ich bin gerne pfiffig. Wer möchte schließlich nicht die Grundzutat sein, auf die es ankommt und die allem ihren Geschmack verleiht? Das ist aber aus drei Gründen gar nicht einfach:
Erstens bin ich für die Welt als Christin eher der weiße Pfeffer als das Salz. Vor einiger Zeit habe ich bei einem Rezept den geforderten weißen gegen schwarzen Pfeffer getauscht. Ich konnte geschmacklich keine Verschlechterung feststellen. So sieht die Lage häufig aus: Christentum ist bestenfalls nice to have, aber ersetzbar. Sofern ich mich nicht in explizit christlichen Kreisen bewege, bringen mir die Leute Toleranz entgegen, oder – wie den meisten Tolerierten – Neugier. Schließlich bin ich exotisch: Schau an, weißer Pfeffer! Was es nicht alles gibt! Oder im Fall des Christentums: Was es doch immer noch gibt! Mit der Ausstrahlung der „Letzten ihrer Art“ führe ich Gespräche über die Jungfrauengeburt, die Missbrauchsskandale oder die manchmal sehr unrühmlichen Erfahrungen mit den eigenen Religionslehrerinnen und -lehrern. Sofern ich schlagfertig reagiere, peppe ich damit zwar die Gesellschaft auf. Aber noch nie hatte ich den Eindruck, dass jemand auf meinesgleichen gewartet hätte. Den Leuten, auf die ich treffe, fehlt weder ein substanzieller Mineralstoff noch die richtige Würze.
Was also hat diese Welt so nötig wie Salz? Ihr fehlt nichts, das aktuell unter dem Label „Christentum“ firmiert. Jetzt könnte man natürlich einwenden, das Christentum werde von diesen Leuten missverstanden. Wenn sie wüssten, worum es bei der Sache Jesu wirklich geht, wenn sie wüssten, wie ich diese Sache verstehe, würde es ihnen schon fehlen. Damit bin ich aus dem Schneider: Ich werde missverstanden – was soll ich machen?
Ich könnte zu verstehen versuchen, auf welcher Erde ich lebe. Damit kommen wir zur zweiten Schwierigkeit, denn das war zu keinem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte dringender und komplizierter als heute. Die großen Schlagwörter – Ökologie und Klimawandel, Technisierung und künstliche Intelligenz, Religion und Säkularisierung, Migration, Geschlechterverhältnisse – wer versteht schon wirklich die Zusammenhänge, auf die sie verweisen? Selbst wer sich ernsthaft bemüht, eine informierte Erdenbürgerin zu sein, wird am Ende mit Sokrates bekennen: Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Aber das Ringen um Fakten ist lohnend. Meinungen und Ahnungen füllen die Lücken sonst von selbst und erzeugen ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Wer sein (Halb-)Wissen testen möchte, dem sei Factfulness (2018) von Hans Rosling empfohlen. Was meinen Sie: Hat sich der Anteil der Weltbevölkerung, der in extremer Armut lebt, in den letzten zwanzig Jahren nahezu verdoppelt, deutlich mehr als halbiert oder ist er gleichgeblieben? Unabhängig von Bildungsgrad und sozialem Status der Befragten tippen hier viele auf die besorgniserregenderen Varianten eins und drei. Tatsächlich hat sich die extreme Armut jedoch weltweit halbiert. Wir Menschen neigen zu Schwarzmalerei und bedienen uns undifferenzierter Begriffe. (Ist Armut deshalb ausgestorben? Leider nein. Aber sie hat sich verändert.)
Im Fall der Christenheit unterstelle ich noch ein Vorurteil: Wir hätten gern, dass die Welt auf uns wartet und uns wie das Salz zum Leben braucht. Wenn dem aber nicht so ist und sich die Probleme dieser Welt anders und vielleicht sogar effizienter ohne uns lösen lassen – wie gehen wir um mit der eigenen Überflüssigkeit? Wie sieht unsere Expertise aus?
„Freude, Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen heute sind auch Freude, Hoffnung, Trauer und Angst der Jüngerinnen und Jünger Jesu.“ Als Teil der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils (1965) hat dieser Satz für die katholische Kirche Verfassungsrang und erhebt einen stattlichen Anspruch: Wir sollen miteinander vertraut sein. Wenn ich nützlich sein will, muss ich wissen, was gebraucht wird. Das gelingt nur durch aufmerksames Zuhören, das keine Mängel unterstellt, um sie dann zu beheben. Ziel des Zuhörens ist es dann nicht, auf jeden Zuruf blindwütig zu reagieren oder die Weltordnung im Alleingang umzukrempeln, sondern sich zu fragen: Was würde Jesus tun? Wie würde er den Bedürfnissen der Zeit begegnen?
Das führt zur dritten Schwierigkeit: Was bedeutet es, im Sinne Jesu nützlich und pfiffig zu sein? Bei Vorträgen und in Gesprächen stoße ich noch im innersten Kreis der kirchlich Engagierten auf Unwissenheit in religiösen Belangen, auch was die Person Jesu angeht. Selbst fromme Kirchgängerinnen und Kirchgänger wissen zum Teil nicht, ob man mit Sicherheit sagen kann, dass Jesus überhaupt gelebt hat. 2 Manchmal schicken sie dann nach, es sei ihnen auch gar nicht so wichtig. Falls die Unkenntnis der Fakten nicht nur Jesus, sondern auch die zuvor genannten Themen von Umwelt bis Geschlecht betrifft, weiß ich nicht, wer hier wie Salz sein soll. Was bleibt dann vom Evangelium übrig außer: Seid nett zueinander?
Das Bild vom Salz ist Teil der Einleitung der Bergpredigt. Nachdem Jesus jene Teile der Bevölkerung seliggepriesen hat, die eigentlich nichts Gutes erwarten, sagt er den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Kopf zu: Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt! Ihr seid die Stadt auf dem Berg! Eines der letzten beiden Bilder für sich genommen könnte gedeutet werden als: Ihr seid die Stars! Aber in Verbindung mit der Rede vom Salz geht es um Nutzen, Schlichtheit und Alltag. Heute sind dem Christentum in Europa die Möglichkeiten genommen, die ganz großen Suppen nachzuwürzen oder zu versalzen. Die Macht ist schlicht und ergreifend weg. Christinnen und Christen sind vereinzelt und können sich auf keinen gemeinsamen Kurs einigen. Innerhalb der eigenen Reihen findet sich das gesamte Spektrum der Meinungen, das sich auch außerhalb findet. Ob Abtreibung, Homo-Ehe oder Sonntagsöffnungszeiten im Handel: Von Pro bis Kontra ist alles dabei. Daran ändern auch offizielle Lehrmeinungen nichts.
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine Chirurgin, an der die Rede vom Salz konkret wird. In einer Dokumentation über geschlechtsangleichende Operationen erzählte sie von ihrer anfänglichen Unsicherheit: Pfuschte sie Gott damit nicht ins Handwerk? Aber dann sah sie das Leid dieser Menschen und wie sehr sie es durch die Eingriffe lindern konnte. – Nicht alle werden meinen, dass die Ärztin das Evangelium richtig versteht, wenn sie aus der Haut des Unterarms einen Penis oder aus Teilen des Glieds eine Vagina formt. Allerdings ist Heilung ein Wesensmerkmal des Gottesreiches, um dessen Kommen wir jedes Mal im Vaterunser bitten. Jesus sagt nichts über transidente Menschen – wir können es ihm als Kind seiner Zeit nicht vorwerfen. Ich muss heute die Fakten kennen, die wissenschaftlichen Einsichten und die Lebensgeschichten der Menschen, um zu verstehen, dass ein solcher chirurgischer Eingriff für eine transidente Person Teil einer Heilungsgeschichte sein kann.
Jesus und seine Botschaft sind weder das Vehikel für meine eigene Unsicherheit und Unkenntnis noch für meine politische Agenda und Empörung. Jesus zeichnet sich durch einen nüchternen Blick aus: Er kennt die illegalen Machenschaften seiner Zeit, die sozialen Spannungen, die Gegebenheiten. In der Wirklichkeit bricht durch sein Handeln das Gottesreich an. Was das Reich Gottes ist – das ist die Frage, von der her klar wird, auf welche Weise wir Salz sein sollen.

Feinde lieben
oder
Wie man sich mit Wasser abtrocknet
Matthäus 5,38–45
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin! Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel! Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm! Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab! Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
DANIELA FEICHTINGER
Gewaltloses Handeln hält den absoluten Wert des Friedens hoch
Um das Ende gleich vorwegzunehmen: Der Held der Bergpredigt stirbt. Die Rede geht für ihren Sprecher nicht gut aus. Wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King, die von der Bergpredigt inspiriert sind, wird auch Jesus, der Urheber, letztendlich ermordet. Nach einem kurzen Prozess wird er zum Tode verurteilt und findet als politischer Aufwiegler den Tod am Kreuz: „König der Juden“ lautet der Tatbestand – ein zynisches Fazit seines Wirkens, das gerade nicht an weltlicher Herrschaft interessiert ist, sondern am Reich Gottes.
Die Feinde Jesu stammen vorwiegend aus den Reihen religiöser Gruppierungen wie der Pharisäer und Sadduzäer. Während die Pharisäer ihre Frömmigkeit betonen und sich um die exakte Auslegung der Tora bemühen, rekrutieren sich die Sadduzäer aus den herrschenden Priesterfamilien und der einflussreichen Oberschicht. Wiederholt gerät Jesus mit ihnen in Konflikt, beispielsweise, als er am Sabbat Kranke heilt oder kurz vor seinem Tod die Händler aus dem Tempel jagt. Oberflächlich betrachtet handelt es sich bei diesen Auseinandersetzungen um theologische Dispute. De facto betreffen sie jedoch die öffentliche Sphäre und im Fall des Tempels die ökonomische Lebensgrundlage der Sadduzäer und Hohepriester.
Hingerichtet wird Jesus dann allerdings durch die Schergen des römischen Präfekten Pontius Pilatus. Er ist als Statthalter der Repräsentant der Besatzungsmacht, die seit 63 v. Chr. das Gebiet beherrscht und es seit 6 n. Chr. autonom verwaltet. Aus sozialen, ökonomischen und religiösen Gründen lehnt ein Teil der palästinischen Bevölkerung die Fremdherrscher ab. Letztendlich kommt es nicht einfach zum Sturz der römischen Verwaltung, sondern zum Bürgerkrieg unter der Führung gewalttätiger Splittergruppen, genannt Zeloten („Eiferer“) und Sikarier („Dolchmänner“). Ihren Wurzeln nach sind sie Sozialrevolutionäre und Banditen, die besonders in der verarmten Landbevölkerung großen Rückhalt haben. Aus religiöser Sicht stellen sie eine radikale Abspaltung der Pharisäer dar. Nach vier Jahren gipfelt der Krieg 70 n. Chr. schließlich in der Zerstörung des Jerusalemer Tempels.
Auch unter den Jüngern Jesu findet sich bereits ein früher Anhänger der gewalttätigen Bewegung: Simon, genannt „der Zelot“ (Lk 6,15). Die Bergpredigt ist vor dem Hintergrund der beschriebenen politischen Spannungen und dem Aufruf zu Gewalt durch gewisse Gruppen zu verstehen: Tut nichts dergleichen. Liebt eure Feinde. Nicht nur die Römer, sondern eure Feinde generell. Schlagt nicht einmal zurück, wenn ihr geschlagen werdet. – Erstaunliche, aber sicherlich keine todeswürdigen Aussagen. Schlussendlich werden es die politischen Mühlen der Zeit sein, die Jesus das Leben kosten: ein Statthalter, der zu Pessach keine Unruhen brauchen kann, einige einflussreiche Persönlichkeiten, die sich durch Jesus gefährdet sehen, und der Verräter in den eigenen Reihen: Judas.
Es scheint so, als hätten Menschen im wohlgeordneten Rechts- und Sozialstaat keine Feinde dieser Größenordnung. Glaubt man TV-Sendungen wie Schauplatz Gericht, sind Feinde in Österreich weder Fremdherrscher noch geniale James-Bond-Bösewichte, sondern querulantische Nachbarinnen und Nachbarn, die einen vor Gericht zerren, oder die eigenen Geschwister, die sich im Streit über das Testament der verstorbenen Matriarchin zu Hyänen entwickeln. Was hieße es, diese Feinde im Sinne Jesu zu lieben? Soll man ihnen die drei Quadratmeter Grund kampflos überlassen ohne Gewähr, dass sie nicht morgen drei weitere wollen? Soll man ihnen zum Sparbuch der Mutter auch noch das Tafelsilber dazugeben? – Die Bergpredigt durchbricht die Logik, die Feinde an einen herantragen, durch ein Verhalten, das sich Feinde nicht leisten können: durch Großzügigkeit, Selbsthingabe und Verletzlichkeit.
Ein solches Verhalten ist wahnsinnig und könnte niemals staatstragend werden. Dementsprechend wurde die Bergpredigt durch die Jahrtausende hindurch auch relativiert: Sie gelte nur bis zum Ende der Welt, das Jesus in naher Zukunft erwartete. Da es noch aussteht, sei sie nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Oder: Die Bergpredigt sei nur für eine gewisse Elite, deren Lebensumstände es zuließen, tatsächlich umsetzbar, beispielsweise für Priester und Ordensleute. Oder aber die Bergpredigt sei bloß ein Ideal, an dem wir uns zwar orientieren, dem wir aber nie gerecht werden können.
Ich hänge einer anderen Auslegung an: Es gibt keine andere Möglichkeit, einen Punkt hinter die menschliche Gewaltgeschichte zu setzen. Die Wucht des Angriffs muss in mir zum Erliegen kommen. Es gibt keine Rache. Das ist sehr unbefriedigend, wie ich nach einer ziemlich unglücklichen Schulzeit und vielen Jahren zermürbender familiärer Konflikte sagen kann. Die Vorstellung, das erlittene Unrecht zu potenzieren und einmal mächtig Schaden anzurichten, ist verlockend, besonders in Augenblicken besinnungsloser Ohnmacht. Wenn jedoch über Jahre keine der Parteien aus der Gewaltspirale aussteigt, stürzen sie im Allerletzten nur gemeinsam in den Abgrund. Niemand gewinnt mehr, beide verlieren, und worum es ging, ist endgültig belanglos geworden. Sich an der Eskalation nicht zu beteiligen, kann einen trotzdem das Leben kosten. Was das Gegenüber tut, ist schließlich nicht gesagt. Aber was es einem nicht nehmen kann, ist der Sinn: Das gewaltlose Handeln hält bis in den Tod den absoluten Wert des Friedens hoch. In der Auferstehung setzt Gott dahinter sein Ausrufezeichen.
Frieden gibt es nicht ohne Wahrheit. Wer um der Harmonie willen auch noch die andere Wange hinhält oder sich Täterinnen und Tätern weiter aussetzt, um irgendeinen Schein zu wahren, oder weil das Opfer im Herzen bereits entschuldigt hat, wofür die betreffende Person keine Reue zeigt, wird an dieser Lüge todunglücklich werden und schlimmstenfalls sterben. Frieden und Wahrheit sind nur gemeinsam Ausdruck jener Liebe, die Jesus verkörpert.
Verkörpert hat diese Liebe auch der Schriftsteller James Baldwin (1924–1987), ein wesentlicher Protagonist der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, der einen Großteil eines Lebens im selbstgewählten Exil verbrachte. In einem seiner berühmtesten Texte, einem erstmals 1962 veröffentlichten Brief an seinen Neffen James, schildert er dem Fünfzehnjährigen, was es bedeutet, ein Schwarzer in den USA zu sein. Am Ende seiner Ausführungen, die so wenig bitter wie beschönigend sind, schreibt er:
„Bitte, lieber James, verliere in dem Sturm, der in Deinem jugendlichen Kopf wütet, nie die Wirklichkeit aus den Augen, die hinter den Wörtern Akzeptanz und Integration steht. Du hast keine Veranlassung, so zu werden wie die Weißen, und es gibt nicht die geringste Grundlage für ihre unverfrorene Annahme, sie müssten Dich akzeptieren. Die schreckliche Wahrheit ist, mein Junge: Du musst sie akzeptieren. Das ist mein voller Ernst. Du musst sie akzeptieren, und zwar mit Liebe. Eine andere Hoffnung gibt es nicht für diese unschuldigen Menschen.“ 3
Der Friede, auf den Baldwin abzielt, ist kein Scheinfriede. Die Liebe, zu der er seinen Neffen auffordert, ist kein Entschuldigen der Gräueltaten. Sein Frieden und seine Liebe sind der Wahrheit verpflichtet, für die er in all seinen Werken Zeugnis ablegt.
Mit jedem Nachbarschaftsstreit und mit jedem Familienkonflikt gestalten wir die Weltgeschichte. Oft halten Menschen mit ihren feindseligen Ansichten hinter dem Berg, solange sie keinen öffentlichen Zuspruch erwarten. Doch schon in diesem Moment, wenn das mörderische Gezeter in den eigenen vier Wänden losgeht, fangen sich gesellschaftspolitische Weichen zu stellen an. Schon hier keimt das Gottesreich – oder nicht.
MARKUS SCHLAGNITWEIT
Das „Gespräch mit den Feinden“ suchen
Als „die gewaltigste Rede …, die ich kenne“, hat der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Friedrich Dürrenmatt die Bergpredigt Jesu einmal bezeichnet. „Gewaltig“ nannte er sie gewiss nicht aufgrund ihres Umfanges oder ihrer Rhetorik. Nein, gewaltig ist diese Rede aufgrund ihres Inhalts. Sie zählt zu den herausforderndsten Texten der gesamten Bibel. Manche Passagen daraus mag man noch als geradezu romantisch und jedenfalls rhetorisch gelungen empfinden – etwa die bekannten Seligpreisungen oder einige Bilder und Gleichnisse: vom Salz der Erde oder den Lilien auf dem Feld. Mit dem wahren Höhepunkt dieser großen Rede und dem Kern christlicher Existenz konfrontiert aber der Abschnitt über die Feindesliebe – und wer sich wirklich darauf einlässt, muss es geradezu als Ungeheuerlichkeit empfinden, was Jesus da seiner Gefolgschaft zumutet: „Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen! Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen.“ – Die hier erhobenen Forderungen stellen zumindest für durchschnittliche Menschen, Marke „Normalverbraucher“, nicht nur eine moralische Überforderung dar, sondern auch eine unerhörte Provokation. – Feindes-liebe!!! – Ist das nicht widersinnig? Feindschaft und Liebe sind doch rein semantisch schon als Gegensatzpaar definiert. Kann man von jemandem etwa verlangen, sich mit Wasser abzutrocknen? – Eben!
Vielleicht sind – wie auch Daniela Feichtinger vermutet – viele Menschen in einem so wohlgeordneten Rechts- und Sozialstaat wie unserer österreichischen Heimat in der glücklichen Lage, von Ressentiment-geplagten Nachbarinnen und Nachbarn und missgünstigen Verwandten einmal abgesehen, keine echten Feinde zu haben, also niemanden, der sie abgrundtief hasst und ihre Existenz zerstören will. Aber man stelle sich nur einmal vor, was diese Worte auslösen mögen in den Ohren von Palästinenserinnen und Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen oder bei den seit Jahrzehnten um ihre Grundrechte betrogenen und verzweifelt um ihre Existenz ringenden Landarbeiterinnen und -arbeitern und Indigenen Brasiliens!
Aber auch in sozial (noch) relativ friedlichen Gesellschaften und stabilen Rechtsordnungen hat das Wort von der Feindesliebe hohen Brennwert – und zwar im Sinne Friedrich Heers, des bedeutenden österreichischen Kulturhistorikers, Intellektuellen und Linkskatholiken: Heer publizierte 1949 sein Buch Gespräch der Feinde und setzte alleine schon mit diesem Titel einen Markstein für das Funktionieren einer modernen, pluralistischen Gesellschaft und insbesondere für die spezifische christliche Verantwortung in dieser: Die Komplexität der Moderne sei, so Heer, schlichtweg nicht zu bewältigen. Keine Ideologie oder Weltanschauung, auch keine Religion könne mit gutem Recht für sich einen Alleinanspruch auf Wahrheit und alleinige Deutungshoheit über die Wirklichkeit erheben. Das Zusammenleben in der pluralistischen Moderne könne nur gelingen, wenn die einander widersprechenden Interessen- und Weltanschauungslager sich zu dem bereitfänden, was Heer eben mit dem „Gespräch der Feinde“ meinte: den aufrichtigen und ernsthaften Diskurs mit dem jeweiligen Gegenlager – getragen von gegenseitigem Respekt und dem ehrlichen Bemühen, die Gegenseite wenigstens verstehen zu wollen, ohne ihre Meinung oder Option deshalb gleich teilen zu müssen.
Heers unermüdliche Aufforderung zu diesem „Gespräch der Feinde“ ist auch über 70 Jahre nach Erscheinen seines Buches aktuell. Denn das echte, diskursive Gespräch auf Augenhöhe und mit offenem Visier ist in der Gegenwart schmerzlich selten geworden: Twitter bietet dafür einfach keine ausreichende Plattform. Die vielfältigen sozialen Netzwerke vervielfachen zwar das verfügbare Angebot an Informationen in bis dato ungekanntem Ausmaß, zugleich neigen sie aber dazu, ihre User und Userinnen in sozialen Blasen zu organisieren, in denen eigene Positionen tendenziell bestätigt und verstärkt anstatt an divergierenden Positionen geprüft werden. Meinungsbildungsevents, zu denen die Veranstalter ausschließlich Vertreter ihrer eigenen Position einladen, führen auch selten weiter. Und öffentliche Diskussionsrunden, in denen die Kontrahenten mehr auf Aufmerksamkeitsquoten abzielen denn auf den Austausch von Argumenten, dienen bestenfalls dem Voyeurismus des Publikums, aber keinesfalls der Findung von Wahrheit oder Lösungen.
Vielleicht kann die jesuanische Aufforderung zur Feindesliebe auch hier weiterhelfen: Echte Liebe verlangt immer auch den Raum der Diskretion und Intimität. Ihr geht es ja um das Gegenüber, nicht um sonstige Interessen. Vielleicht kann deshalb das auch in unserer modernen Mediengesellschaft so nötige Gespräch der Feinde nur gelingen, wenn es nicht sogleich an die Öffentlichkeit dringt. Vielleicht könnte es bei einem entspannten Glas Wein oder Bier eher geführt werden – zwischen Caritas-Vertreterinnen und Identitären, Regierungsmitgliedern und Oppositionellen, Gewerkschaftern und Finanz-Jongleuren, Modernisierungsverlierern und erfolgsverwöhnten Kosmopolitinnen. Es wäre jedenfalls ein dringendes Desiderat. Aber es verlangt nach einer Vorbedingung: die Anerkennung des Gegners als gleichrangig, die Würdigung des Feindes als Menschen. Es geht in dieser Akzeptanz der Anderen keineswegs darum, ihre Position einfach zu teilen; es geht vielmehr darum, die Position der Feinde ernst zu nehmen und zumindest als würdig zu erachten, dass man sich mit ihr gewissenhaft auseinandersetzt, weil auch Feinde Würde haben. Es wird auch nicht verlangt, das vom Feind allenfalls erlittene Böse einfach zu vergessen und zu verdrängen, weil Vergessen und Verdrängen niemals heilsam sein können. Es geht vielmehr darum, dieses Böse zu unterscheiden von dem, der es verübt hat: weil dieser niemals in sich böse und verdammenswert ist, sondern immer noch ein Mensch mit grundlegenden Rechten und Würde.
Als spirituelle Grundlage für eine solche Haltung der gegenseitigen Achtung und des Respekts sollten alleine schon die grundlegenden Passagen der UN-Menschenrechtsdeklaration über die unabdingbare Menschenwürde genügen. Das Christentum verankert sie noch zusätzlich in seiner Rede davon, dass alle Menschen – ob getauft oder nicht – Gottes Geschöpfe, seine geliebten Töchter und Söhne und sein Abbild sind. Einen interessanten Zugang bietet darüber hinaus eine Formulierung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth. Paulus fragt darin seine Adressaten: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“, und antwortet gleich selbst: „Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr.“ (1 Kor 3,16 f.) – Auch diese Worte sind eine Überforderung, wenngleich eine ungleich „angenehmere“ als die Rede von der Feindesliebe: Tempel, Wohnung Gottes sein – welcher Mensch vermag das? Unfertig, unvollkommen und ungenügend, wie wir alle sind! Eher noch ein Rohbau, eher eine ewige Baustelle als eine Wohnung, ein Tempel gar! Und dann auch noch: heilig – nicht als Forderung, sondern als Feststellung: „Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr“! – Nein, wenn diese Zusage gilt, dann muss sie für alle Menschen gelten. Welche Vorzüge hätte ein Einzelner schon vorzuweisen, dass sie diese Titulierung rechtfertigten in Unterscheidung zu anderen Menschen? – Nein, wenn schon „heiliger Tempel“, wenn schon „Wohnung Gottes“ – dann heißen alle Menschen so und sind alle heilig! – Heilig: also verehrungswürdig, unantastbar, unbedingt liebenswert. – Alle: also auch die ganz Anderen, letztendlich sogar die eigenen Feinde.
Vielleicht sind diese so zu lieben, wie man eben das Heilige liebt: nicht unbedingt mit derselben Wärme und Zärtlichkeit, mit der man Freunde oder gar Lebenspartner liebt – aber jedenfalls in unbedingter Ehrfurcht und Respekt und im Bewusstsein, dass dieser Andere, dass dieser Feind von unbedingter Bedeutung und Würde ist: Heilig auch er; auch er ein Tempel Gottes – selbst noch im brennendsten Konflikt!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.