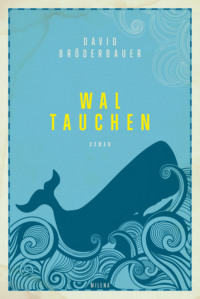Kitabı oku: «WALTAUCHEN»
DAVID
BRÖDERBAUER
WAL TAUCHEN
ROMAN


Inhalt
– EINS –
Probenraum
Sprechstunde
Vor-Haut
Schmetterlingskind
Fertigteilhaus
Oberflächenprotokoll
Das große Blau
Unser Meer
Phasenübergänge
Tiefenrausch
– ZWEI –
Maximalversuch
Amphibien
Landtiere
Rauchentwicklung
Fell
Der Ruf des weißen Wals
Die Evolution der Wale
Baulücke
Schrottreife
– DREI –
Wie das Meer entstanden ist
In der Stadt
Tauchgang
Er, ich
Die blaue Stunde
Saisonstart
Vera
Sprungschicht
Waltauchen
Überlauf
– EINS –
Probenraum
ICH BRAUCHE NOCH EINEN MOMENT. Ich warte noch, bis sich die Schritte der Arzthelferin entfernt haben. Mir ist die Vorstellung unangenehm, dass sie hört, wie ich die Tür verschließe. Sie hat mich darum gebeten, hat mir den Becher überreicht, verständnisvoll gelächelt hat sie und gesagt, ich möge doch bitte nicht vergessen, die Tür hinter ihr zuzusperren. Aber sie darf nicht hören, wie der Riegel einschnappt. Dann wäre ich nicht mehr imstande, meine Probe zu produzieren.
Das Einzige, was ich seit dem Betreten des Urologenzentrums von mir gegeben habe, war mein Name. Zum Schutz habe ich meinen Doktortitel vorangestellt. Oft glaubt man dann, ich wäre Arzt, und behandelt mich zuvorkommender. Und dass ich zur Probenabgabe komme, habe ich noch gesagt. Die Arzthelferin hat professionell reagiert, genauso, wie man es erwarten würde. Und doch hat man an ihrer Reaktion gemerkt, dass sie sich der besonderen Natur dieser Prozedur durchaus bewusst ist, an dem Blick zu ihrer Kollegin am Empfangsschalter hat man es gemerkt, an der gemessenen Handbewegung, mit der sie mir den Patientenbogen auf die Theke gelegt hat, an ihrer gedämpften Stimme beim Erklären des Ablaufs. Trotz täglicher Durchführung verweigert sich dieser Vorgang der Normalität. Es besteht ein Unterschied zur Abgabe anderer Proben, als wenn beispielsweise Harn oder Blut aus dem menschlichen Körper zutage gefördert werden. Diese Flüssigkeiten sind alltäglichere und gesellschaftlich akzeptiert, ein Mann kann öffentlich bluten oder in ein Gebüsch urinieren, ohne dass es einen übermäßigen Aufschrei gäbe, beim Arzt stellt man den Harnbecher auf ein Tablett im Patienten-WC, die Blutprobe wird von der Arzthelferin bei offener Tür abgenommen. Mit meiner Probe geht das nicht. Wie ich sie unter den gegebenen Umständen produzieren soll, ist mir im Moment noch nicht vorstellbar, oder dass ich in ein paar Minuten mit einem spärlich befüllten Becher in der Hand aus dem Zimmer gehe, den schmalen Gang entlang, vorbei an den wartenden Patienten, und der Arzthelferin den Becher übergebe. Es ist nicht vorgesehen, dass ein Mann so etwas im öffentlichen Raum tut. Trotzdem erwartet man genau das von mir. Auch wenn ich gleich die Tür versperre, kommt das Ganglicht unter der Tür herein, ich höre die Schritte des Personals, das Läuten des Telefons und die Stimmen der Patienten. Vor mir ist ein anderer Mann auf dieser Liege gesessen, und nach mir kommt der nächste. Alles hier ist öffentlich.
Aber es ist nicht nur das. Die Schwierigkeit besteht auch darin, dass alle möglichen Gefühle und Erinnerungen mit diesem Akt verknüpft sind, das Gefühl von Begierde, das Gefühl von Lust, von Ekstase und Glück und Erfüllung, Erinnerungen an Liebe und Sehnsucht, an Geilheit, Not, Wut, Scham und Selbstverachtung. Das alles gehört nicht hierher, ich muss es ausblenden, sonst wird es schwierig. Dazu kommt noch der schlechte Scherz, dass der Raum von dieser Lavalampe beleuchtet wird, die ihr blaues Licht auf die Wände wabert, als wäre das hier eine Meeresgrotte.
Ich kann immer noch abbrechen. Niemand weiß, dass ich hier bin. Ich muss Vera nichts erzählen, muss ihr nicht nachträglich erklären, warum ich es verheimlicht habe. Denn das würde sie fragen. Warum ich denn nichts gesagt habe. Ansehen würde sie mich, und auf die Erklärung warten. Eine Nebenhodenentzündung? Warum ich so etwas verschweige. Ob ich deshalb die letzten Wochen so unnahbar gewesen bin.
Sie würde nicht gleich nach den möglichen Folgen einer Nebenhodenentzündung fragen, sie würde auch nicht fragen, wann das Ergebnis zu erwarten ist. Aber sie würde mich ansehen, würde versuchen, in mich hineinzusehen, wenn sie meinte, ich merke es gerade nicht, sie würde zu verstehen suchen, was in mir vorgeht, und das so lange, bis das Ergebnis da ist und ich damit herausrücke.
Dass wir nie über das Kinderkriegen gesprochen haben, macht es nicht leichter. Bei Vera hat sich von Anfang an alles um ihr Studium gedreht, zuerst der Bachelor, dann der Master. Jetzt ist es der PhD, Vera hat die Ambition, ihn in der vorgegebenen Zeit und mit Publikationen in möglichst guten Journals abzuschließen, damit sie danach eine Stelle an einer möglichst guten Universität bekommt, obwohl solche Stellen seltener sind als Pottwale im Mittelmeer, aber Vera sagt, das wird schon funktionieren. Vera denkt, das Leben könne immer so weitergehen, es wird schon immer alles gut gehen. Bald wird auch Vera die Dinge anders sehen. Wenn man über dreißig ist, bekommt man eine andere Sicht auf das Leben, man begreift, dass die Zeit in Wahrheit rast, dass man trotz Doktortitel mit gebundener Monografie und Publikationen in diesen Proceedings und jenen Letters noch nichts Richtiges zustande gebracht hat, dass allem eine Frist gesetzt ist, dass auch Männer nicht bis an ihr Lebensende zeugungsfähig bleiben.
Vielleicht würde Vera auch einen Scherz machen, wenn ich ihr von diesem Arztbesuch erzähle. Alter Dummkopf, würde sie sagen, würde mir durch das schüttere Haarbüschel über der Stirn fahren und fragen, ob die Arzthelferin zumindest attraktiv gewesen ist, und wie genau sie mir denn bei der Probenabgabe geholfen hat. Und ich würde lügen und ihr nicht sagen, dass die Arzthelferin attraktiv gewesen ist, in meinem Alter oder sogar eine Spur älter, dass sie mich angelächelt und mir mit heruntergelassenem Visier in die Augen gesehen hat, als sie mir den Probenbecher in die Hand gedrückt hat. Ich würde Vera in dem Glauben belassen, dass ich mich nicht für andere Frauen interessiere, was an sich auch stimmt, aber diese Arzthelferin scheint eine interessante Frau zu sein. H. Sitte steht auf dem Schild an ihrer Weste. Ihr rechter Unterarm ist tätowiert, ein Ozean voller Symbole ist aus dem hochgeschobenen Ärmel hervorgetreten, als sie mir den Becher überreicht hat – eine Toga-tragende Frau mit durchscheinenden Brustwarzen auf einem Seepferd reitend, ein Tintenfisch im Kampf mit einem Pottwal, und auf dem Handrücken die Meeresgischt, die sich in den Becher zu ergießen schien. Beim Hinausgehen hat die tätowierte Hand das Dekkenlicht ausgeschaltet, den Raum plötzlich in das blaue Licht der Lavalampe tauchend, dann noch einmal ein Blick von ihr, und ich möge doch bitte nicht vergessen, die Tür zu verschließen.
Sprechstunde
Es gibt dieses alte Seemannsgarn, wonach ein Matrose von einem Wal verschluckt und für ein paar Tage in die Tiefe verschleppt wurde, bevor das Ungeheuer wiederaufgetaucht ist und ihn ausgespuckt hat. Nackt und vollkommen weiß ist er an Land zurückgekehrt, seine Kleider aufgelöst und die Haut gebleicht von der Verdauungsflüssigkeit des Wals. Wenn ich die Tür jetzt zusperre, treffe ich eine Entscheidung. Ich kann dann nicht mehr mit einem leeren Becher hinausgehen. Er muss weiß sein wie der Matrose, wenn ich die Tür wieder öffne.
Wofür wohl das H. auf dem Namensschild der Arzthelferin steht? Sie scheint etwas für das Meer übrig zu haben. Sonst lässt man sich nicht so ein Tattoo stechen und man schiebt den Ärmel der Weste nicht so weit hoch, dass es jeder sieht. Ich hätte ihr sagen können, dass ich meine Doktorarbeit über die Griechen geschrieben habe, dass ich weiß, welche Nymphe für die Frau auf dem Seepferd Patin gestanden hat. Ich hätte ihr die Geschichte von meiner Begegnung mit den Pottwalen erzählen können, von dem Tag, der mein Leben verändert hat, diese Geschichte beeindruckt jeden. Aber wenn man gerade einen solchen Becher überreicht bekommen hat, erscheint irgendwie alles, was man sagen könnte, unpassend.
Vielleicht ist die Lavalampe ihre Idee gewesen – ein entrücktes Unterwasserreich schaffen, in dem man entspannen kann. Ob sie auch taucht? Sie sieht nicht wie jemand aus, der nur ans Meer fährt, um sich in die Sonne zu legen. Wenn sie tatsächlich taucht, dann hat sie die Lavalampe nicht zufällig gewählt, dann hätten wir darüber sprechen können, wie man sich unter Wasser fühlt, dass man dort ganz bei sich ist. Alles andere löst sich auf. Die Anspannung verfliegt und man wird ganz ruhig, besonders beim Freitauchen. Davon hätten wir sprechen können, ich hätte sie mit meinen Freitauchkenntnissen beeindrucken können. Ein tiefer Atemzug, die Luft anhalten, loslassen und abtauchen ins Blau. Man muss lernen, für Minuten ohne Sauerstoff auszukommen, man muss dem Wasserdruck standhalten, der einem das Trommelfell zerreißen kann, dem Zwang, atmen zu wollen, dem Zucken im Bauch. Der Angst vor der beengenden Weite, der man sich ausliefert. Weil das so schwer ist, taucht kaum jemand frei.
Vera und ich sind schon lange nicht mehr am Meer gewesen. Die vielen Leute, das sinnlose Herumliegen, der Plastikmüll. Obwohl wir am Meer ein Paar geworden sind. Obwohl wir dort das erste Mal miteinander geschlafen haben, an diesem alles verändernden Tag, nach der Begegnung mit den Walen. Vielleicht fahren wir gerade deshalb nicht mehr ans Meer, weil man so etwas nur einmal erleben kann, weil man dieses Übermaß an Gefühlen ein zweites Mal gar nicht aushalten würde, und hielte man es doch aus, würde einen das Erlebnis verändern, und dieses Risiko geht man nicht mehr ohne Weiteres ein, wenn man einmal einen sicheren Stand gewonnen hat. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich seitdem nicht mehr getaucht bin. Gerade das Tauchen habe ich aufgegeben, obwohl es bis zu diesem Tag am Meer eines der wenigen Dinge gewesen ist, die meinem Leben einen Rahmen gegeben haben. Das Tauchen und die Wale.
Mein Vater würde nichts sagen, wenn er von meinem Arztbesuch erführe. Nicht einmal das kann er, würde er vielleicht denken, falls sich herausstellt, dass ich zeugungsunfähig bin. Ob er überhaupt traurig wäre, dass er von dieser Seite keine Enkel erwarten kann, von dem Sohn, der ständig in Fachtermini spricht, der immer alles hinterfragen und besser wissen muss, der sich schon als Knabe immer gegen alles gewehrt hat? Von dem Sohn, der sich nach seiner Schablone zu bilden versucht hat. Vielleicht wäre es nur folgerichtig, wenn ich keine Kinder zeugen kann. Ich schaffe es ja nicht einmal, diese Tür zuzusperren. Steht die Arzthelferin noch davor? Ich höre nichts. Bald muss ich abschließen. Ich werde nicht unbegrenzt Zeit haben. Eine Stunde höchstens. Die sollte ich nicht für Selbstgespräche verwenden. Der Nächste sitzt vielleicht schon im Wartezimmer, liest ein Magazin und wartet darauf, dass ich fertig werde. Ob es einem anderen Mann leichter fällt als mir? Unwahrscheinlich. Er muss sich ebenso ausliefern wie ich, muss sein Innerstes nach außen kehren, während zur gleichen Zeit jemand die Apparaturen vorbereitet, um ebendieses Innerste umgehend zu analysieren, es unter ein Mikroskop zu tropfen und auszuzählen, wie viel davon fertil ist, wie viel von der Norm abweicht, was deformiert und schlichtweg unbrauchbar ist. Wie kann es einem da anders gehen als mir? Aber ich will nicht verallgemeinern. Nicht allen Männern muss diese Situation unangenehm sein. Mancher empfindet vielleicht keine Scham dabei, schließlich ist der Akt an sich nicht schändlich. Und mancher wird auch keine Schwierigkeit damit haben, es zu tun. Diese Männer gibt es, die einfach Dinge können, sie können Fahrzeuge steuern, schwere Gegenstände heben, Frauen erobern und sie können kommen, wann und wo sie wollen, das alles können sie und tun es auch. Der eine oder andere schließt vielleicht nicht einmal ab. Es gibt auch die, man hat auch das Bild von diesen Männern im Kopf, die mit einer solchen Situation problemlos zurechtkommen, die problemlos in der Gegenwart anderer den verlangten Akt bewältigen, die von der Gegenwart Zusehender beflügelt werden, die dabei lachen und ohne Umschweife liefern. Mir ist das nie vorstellbar gewesen, es ist mir immer undenkbar gewesen, diesen intimen Akt unter anderen, wie auf einer Bühne, aufzuführen. Der Jugendliche hat sich immer hinter eine verschlossene Tür begeben und immer darüber geschwiegen, was hinter dieser Tür passiert.
Zugegeben, manchmal beneide ich die Könner. Besonders früher, als Heranwachsender, wollte ich gerade ein solcher Mann werden. Einen anderen hat die jugendliche Vorstellung gar nicht bereitgehalten. Mein Teenager-Ich hat versucht, in die Form hineinzuwachsen, die andere Jugendliche – wie der Bruder – so mühelos angenommen haben, aber es wollte ihm nicht recht gelingen.
Irgendwann ist mir dieser vorgestellte Mann verloren gegangen, ich bin vom Weg der eingebildeten Mannwerdung abgekommen, ich habe mich in der Person eingerichtet, die ich eben war – weder besonders groß noch besonders behaart noch besonders selbstbewusst oder zielstrebig, kurzum, kein besonders männlicher Mann. Ganz ohne Planung ist das passiert, eine allmähliche Gewöhnung ist es gewesen, ein Ergebnis, zustande gekommen ohne ausgeklügelte Rechenoperationen. Unscheinbare Additionen und Subtraktionen sind es gewesen, eine simple Mengenlehre, die zur Anhäufung einer Summe geführt hat, einem Ich, mit dem sich leben ließ, ohne dass seine Aufrechterhaltung zu viel Aufwand erfordert hätte. Jetzt steht eine weitere solche Operation an. Eine kleine Menge wird abgezogen – sie misst sich in Millilitern. Dafür wird das Ergebnis umso folgenreicher sein. Falls ich hier in diesem schummrigen Raum überhaupt dazu imstande bin, das erforderliche Volumen zutage zu fördern. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Tür zu verschließen und es zu versuchen.
Vor-Haut
Das erste Mal getaucht bin ich, noch bevor ich richtig schwimmen konnte. Wann genau das gewesen ist, könnte ich nicht mehr sagen, aber es muss bei einem dieser todesverachtenden Sprünge vom Beckenrand gewesen sein, wo mein Knaben-Ich mit einem Knall die Wasseroberfläche durchbrochen hat und für den Bruchteil einer Sekunde untergetaucht ist, desorientiert, den Geschmack von Chlor im Mund und vollkommen euphorisch. Wie die anderen Knaben auch, habe ich nichts mehr geliebt als das Wasser. Ich bin mit aufgeblasenen Schwimmflügeln am Beckenrand gestanden, habe wie verrückt geschrien, Ein Hai, ein Hai, hinter euch schwimmt ein Hai, ich rette euch!, und dann bin ich ins Wasser gesprungen, eine Hand an der Nase, die andere an der Badehose. Wie bei den anderen auch, ist meine Hand unweigerlich zur Badehose gewandert, wenn ich aufgeregt gewesen bin. Das Ziehen an der Vorhaut hat eine beruhigende Wirkung gehabt, es ist eine Form der Selbstversicherung gewesen, bevor ich mich ins Verderben gestürzt habe. Ich habe mich gespürt, wenn ich an meiner Vorhaut gezogen habe, bin ruhig geworden, mein Herzschlag hat sich verlangsamt, und von der Stelle hat eine Wärme in meinen Körper ausgestrahlt. Das Gefühl ist vielleicht mit dem vergleichbar, das ein Säugling beim Saugen an der Brustwarze empfinden muss. Nimm deine Hand da weg, hat mein Vater gesagt, wenn mein Knaben-Ich im Freibad vor allen Leuten daran gezogen hat, ohne zu erklären, warum die Hand da nicht hingehört. Der Knabe hat es nicht verstanden, er hat sich dabei nichts Böses gedacht, in Wirklichkeit hat er sich gar nichts gedacht, das Ziehen an der Vorhaut ist unbewusst erfolgt. Erst durch die Interventionen des Vaters ist es ein bewusster, aber heimlicher Akt geworden, der wohlüberlegt sein wollte. Der Vorgang hatte nichts Sexuelles, nichts Ungebührliches an sich, er hat zum Repertoire der Knabenbewegungen gehört, wie der Griff an die Nase vor dem Sprung. Zwar hat er sich ein wenig geschämt, wenn er beim In-die-Badehose-Schlüpfen kurz nackt gewesen ist, aber die Ursache für seine Scham war ihm nicht klar. Die zukünftige Funktion seines Glieds, die es aus dem öffentlichen Blickfeld verbannen würde, ist diesem Knaben noch unbekannt, er ist im Gegenteil ein wenig stolz darauf, weil ihm das Wasserlassen dadurch zum Spiel wird. Dass er als Mann Blut aus sich hinaus zwischen die Beine pumpen und dort anschwellen wird, davon hat dieser Knabe keine Vorstellung. Überhaupt ist sein Konzept vom Mannsein noch unfertig. Er ist sich zum Beispiel nicht sicher, dass er ein Mann werden wird, nur weil er ein Knabe ist. Er befürchtet, er könnte ein Mädchen werden, und mit Sorge observiert er seinen Oberkörper, ob ihm nicht Brüste wachsen. Für eine Weile erscheint ihm das so wahrscheinlich, dass er sich vorauseilend Entschuldigungen dafür zurechtlegt, warum er sich bald in ein weibliches Wesen verwandeln wird. Woher sollte man auch sicher wissen, dass das nicht möglich ist? Aus dem Fernsehen weiß er, dass es Fische gibt, die im Laufe ihres Lebens ihr Geschlecht ändern können. Ein Weibchen wird dann plötzlich ein Männchen, oder umgekehrt. Dass Knaben das nicht können, dass sie unweigerlich Männer werden, weiß er noch nicht. Männer sind für ihn unerreichbare Wesen, er beobachtet sie, wie sie durch das Freibad schreiten, umgeben von einer Aura aus Körperbehaarung, Bizepsen, tiefen Stimmen und dem betäubenden Geruch, der aus ihren Achseln strömt. Sein Knabenkörper schottet ihn von dieser Männerwelt ab, er steckt in seiner knabenhaften Vor-Haut fest. Vielleicht ist sein Blick deshalb besonders auf die anderen Knaben gerichtet. Mädchen interessieren ihn nicht, nur die gleichaltrigen Jungen, und noch mehr die ein wenig älteren, die ein oder zwei Jahre voraus sind, wie sein Bruder, die greifbar scheinen und gleichzeitig um so vieles anders, größer und stärker und mutiger, ausgestattet mit einer unbestreitbaren Autorität. Die an den tiefen Stellen ins Freibad springen, wo man nicht mehr stehen kann, die keinen Schwimmreifen und keine Schwimmflügel mehr brauchen, weil sie schwimmen können, und stolz ihren Freischwimmerausweis vorzeigen. Er steht daneben und sieht den Springern und Freischwimmern zu, fast ohne Neid, mit aufrichtiger Bewunderung und einer Portion Scham.
Als sie alle noch das Alter haben, wo Schwimmhilfen etwas vollkommen Natürliches sind, wo man als Träger dieser orangen Luftklötze noch nicht aus der Gruppe ausgestoßen wird, geht er gerne ins Wasser. Es ist das Selbstverständlichste auf der Welt, sich bei der Ankunft an einem der alten Fischteiche oder im Freibad die Kleider vom Leib zu reißen, die Schwimmflügel überzustreifen und ins Wasser zu springen. Bis zu dem Tag, als sein Bruder plötzlich ohne schwimmt, als hätte er es über Nacht im Schlaf gelernt. Und dem übernächsten Tag, an dem es der beste Freund seines Bruders auch schon kann, und dem darauffolgenden, als es schon vier sind, und dann acht und in exponentiellem Wachstum immer mehr, als wären diese Jungen Einzeller, die ihre Eigenschaften bei jeder Teilung an ihren Klon weitergeben, was dazu führt, dass bald alle in seinem Alter schwimmen können, alle sind sie Freischwimmer geworden, mit Ausnahme von ihm. Er sitzt reglos im Schatten der Freibadsträucher, das Wasser in seinem Körper zu Gallert gestockt, und sieht ihnen zu, studiert ihre Bewegungen, ahmt sie in Gedanken nach, und wenn sie untertauchen, hält er mit ihnen die Luft an, bis sie wieder nach oben kommen. Hineingehen und ohne Schwimmhilfen schwimmen, dazu ist er nicht in der Lage. Er ist sich sicher, dass er dann ertrinkt. Mit der Zeit merkt er allerdings, dass ihm das Luftanhalten leichtfällt und dass, wenn die anderen auftauchen, er noch einige Sekunden länger ohne Atem auskommen kann. Also übt er die Luft anzuhalten, solange es geht, dabei immer die anderen im Auge, sie werden seine Zeitmesser, der eine taucht ab und wieder auf, dann der Nächste, ein Weiterer steigt prustend an die Oberfläche, und er behält immer noch denselben Atemzug in sich, triumphiert über sie alle. Das Atemanhalten wird seine geheime Superheldenkraft. Niemand merkt etwas davon und er verrät es auch niemandem, aber bei sich selbst weiß er, dass er besser ist als sie alle. Bald schon interessiert es ihn nicht mehr, was die anderen im Wasser machen, er sitzt auf seinem Handtuch und hält den Atem an. Kommst du mit ins Wasser?, fragt manchmal einer der Gleichaltrigen, Den brauchst du gar nicht zu fragen, sagt dann sein Bruder, der geht sowieso nicht rein, der kann nicht schwimmen, und er wartet wortlos, bis sie weg sind, damit er ungestört trainieren kann.
Er treibt es so weit, dass ihm schwarz vor Augen wird. Mit Gewalt unterdrückt er das Zucken im Bauch und das Würgen im Hals. Dabei wird er von seinem Bruder ertappt, sein Bruder kniet über ihm, rüttelt ihn an der Schulter und schreit seinen Namen, Was ist mit dir, was ist mit dir? Er antwortet nicht und tut so, als hätte er nur geschlafen, setzt sich von nun an abseits, damit er ungestört bleibt. Das Luftanhalten gibt ihm trotz der gelegentlichen Ohnmacht ein Gefühl von Kontrolle, ganz anders als bei den epileptischen Anfällen später, die sich seiner Kontrolle entziehen und manche Nächte in reale Albträume verwandeln.
Eines Tages, noch im selben Sommer, ist es so weit. Vielleicht liegt es an der Hitze oder an dem Anblick der im Wasser tobenden anderen, oder es ist das Wasser selbst, die Bewegung der Wellen, sein Glitzern, das Geräusch, wenn es gegen die Betonwände des Beckens schwappt, jedenfalls steht er auf, geht zum Kinderbecken, das sich ein paar Meter abseits vom großen Becken befindet und so seicht ist, dass man nicht darin ertrinken kann, und legt sich mit dem Gesicht nach unten hinein, zwischen die plantschenden Kleinkinder und die Beine ihrer Mütter. Er legt sich einfach ins Wasser und bleibt so, für eine halbe Minute vielleicht, vor ihm der Boden mit dem abblätternden Lack, der vortäuschen soll, dass das Wasser blau sei, wo es in Wahrheit keine Farbe hat. Er betrachtet die vorbeigehenden Füße um ihn herum, bis ihn eine der Mütter an den Schultern hochzieht und fragt, ob alles in Ordnung sei. Ich übe tauchen, sagt er nur und taucht wieder unter, und von da an wird er nicht mehr gestört. Im Gegenteil wird er bald schon bestaunt. Noch am selben Tag bemerken ein paar von den anderen, was er da macht, sie stellen sich an den Rand des Kinderbeckens, um ihm zuzusehen. Eine Minute, sagt einer mit Uhr, als er von einem seiner Versuche auftaucht. Am nächsten Tag bildet sich schon eine Traube von Menschen um das Kinderbecken, nicht nur Kinder, auch Jugendliche und Erwachsene sind dabei, fasziniert von seiner Superheldenkraft. Ein paar Gleichaltrige und sogar der eine oder andere Jugendliche legen sich neben ihn ins Wasser, versuchen mitzuhalten, aber sie scheitern alle schon nach wenigen Sekunden. Sie sind chancenlos. Einmal steigt sogar ein Erwachsener, ein richtiger Mann mit Muskeln und Haaren auf dem Rücken, ins Wasser, um sich mit ihm zu messen. Die Ohren knapp unter der Wasseroberfläche, kann er das schallende Gelächter der Umstehenden hören, als der Mann nach kurzer Zeit aufgeben muss. Ein ekstatisches Gefühl überschwemmt ihn, und er schafft eine neue Bestzeit. Nicht dass er mitstoppen würde, aber die anderen tun es, und sie notieren die Zeiten auf der Schiefertafel der Freibadkantine, wo sonst die Getränke angepriesen werden.
Am Ende der Woche dann, es ist Samstag oder Sonntag, reißt ihn sein Vater aus dem Kinderbecken, Schämst du dich gar nicht, presst er zwischen den Zähnen hervor, wie alt er eigentlich sei, sagt er, und ob er sich vor gar nichts grause, und die umstehende Menge geht rasch auseinander. Er weiß nicht, ob sein Vater gerade zufällig in der Kantine auf ein Bier ist, oder ob es ihm sein Bruder erzählt hat. Vielleicht haben sich auch die Mütter beschwert, weil ihre Kinder, wann immer er zu seinen Versuchen angetreten ist, von einem Mitbewerber oder den umstehenden Zusehern aus dem Becken geräumt wurden. Widerspenstig wie er ist – Trotzig bist du, sonst nichts, sagt sein Vater oft, du glaubst, du weißt alles besser, aber nichts weißt du –, gibt er das Treiben unter Wasser nicht auf, sondern wechselt in das große Becken. Obwohl die Angst vor dem Ertrinken in seinem Nacken sitzt, ist er entschlossen, nicht aufzuhören. Außerdem hat er im Kinderbecken bemerkt, dass er auf dem Wasser treibt, ohne unterzugehen, solange er sich nicht bewegt. Also hält er sich in dem Bereich auf, wo das Wasser nur bis zur Hüfte reicht und schwebt dort ohne Schwimmflügel reglos auf der Oberfläche. Die Angst vor dem Ertrinken führt allerdings dazu, dass sein Herz schneller schlägt, und er schafft es nur noch halb so lange unter Wasser zu bleiben wie davor.
Schon am ersten Tag ohne neuen Rekord verschwinden die Zeiten von der Schiefertafel und machen wieder den Getränkepreisen Platz. Außerdem hat den anderen das Einschreiten seines Vaters gezeigt, dass er angreifbar ist. Sie springen nun direkt neben ihm mit angezogenen Beinen ins Wasser, um ihn zu sabotieren, was ihnen anfangs auch gelingt. Mit Bedacht zieht er sich Stück für Stück in noch seichteres Wasser zurück, bis sich einer der Jungen, die aus Begeisterung über das wehrlose Ziel ihrer Attacken die Vorsicht vergessen, beim Wasserbombenangriff das Knie blutig schlägt. Ab dann hat er wieder seine Ruhe. Schon bald wird er vom ganzen Freibad ignoriert, selbst der Bademeister achtet nicht mehr auf ihn, er ist wieder so ungestört wie zuvor, als er mit angehaltener Luft abseits auf seiner Decke gesessen ist. Nun werden seine Zeiten wieder besser. Mangels einer wasserfesten Uhr kann er sie nicht messen, aber er spürt es. Überhaupt potenziert das Liegen im Wasser sein Gespür. Nicht dass seine Sinne geschärft würden, eher treten sie in den Hintergrund. Dafür bildet sich das Gefühl für seinen Körper und die Umgebung immer stärker aus. Ein Zustand kontrollierter Ruhe tritt ein, wie er ihn an Land nie erlebt hat. Noch verstärkt wird dieser Zustand, wenn er die Augen schließt, was er schon deshalb tut, weil das Freibad damals noch keine biologische Filteranlage hat und das Chlor in den Augen brennt.
So vergeht im Wasser treibend der Juli. Im August kommen die Wolkentage, im Hochland wird es früh Herbst, es kommt der kalte Regen, der das Freibad leer wäscht. Es kommt der Tag, an dem sein Vater trotz der Wolken sagt, So, heute fahren wir an den Aichingerteich, und dann lernst du schwimmen, du brauchst gar nicht so zu schauen.