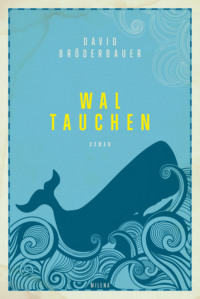Kitabı oku: «WALTAUCHEN», sayfa 2
Schmetterlingskind
Die Zeit hat aus meinem Knaben-Ich eine konturarme Schaufensterpuppe gemacht, die auch bei näherer Betrachtung seltsam unscharf bleibt. Was von ihm übrig ist, ist vage, zumindest erinnere ich mich an vieles nur ungefähr, ganz im Gegenteil zu meinem Bruder, Ich erinnere mich genau, sagt er, wenn ich eine Erinnerungslücke offenbare, und erklärt dann, wie es in Wahrheit gewesen ist, nämlich so und so. Gefolgt von der Bemerkung, dass ich doch Geschichte oder so was studiert habe und mich trotzdem an nichts erinnern kann. Ich sage nicht, dass man Familiengeschichte nicht so behandeln kann wie Thukydides den Peloponnesischen Krieg, aus Erinnerungsfragmenten kann man nicht Ursachen und Umstände rekonstruieren und dann erklären, genauso ist es gewesen, schon gar nicht, wenn verschiedene Menschen mit verschiedener Wahrnehmung beteiligt gewesen sind. Würde ich das sagen, würde mein Bruder sagen, wie überheblich ich nicht bin, also sage ich auch nicht, dass sich die Erlebnisse aus der Kindheit kausalen Erklärungen entziehen, dass Kindheitserinnerungen höchstens der mythischen Geschichtsauffassung Homers vergleichbar sind, in der Schicksal und Götter den Arm der Helden führen, dass im Erinnern am Ende immer die Erzählung über die Fakten siegt und dass Erklärungen oft nichts anderes als nachgereichte Rechtfertigungen sind.
Wie viel auch Fragment ist, an die Fahrt zum Aichingerteich kann ich mich noch gut erinnern. Das verdankt sich dem Umstand, dass die Erinnerung daran eine Reproduktion ist, eine Fotografie, gemacht an jenem Tag und bis heute von mir aufbewahrt. Sie zeigt einen Knaben mit goldblondem Haar, die Kamera schaut von oben auf ihn hinab, auf den gesenkten Kopf, der das Strahlen in seinem Gesicht nur erahnen lässt. Im Rücken des Knaben sieht man unscharf das Grün einer Wiese, das vom Orange seines T-Shirts überstrahlt wird. Der Knabe wendet der Kamera die Schulter zu, auf der ein Schmetterling Platz genommen hat. Nicht irgendein Schmetterling, sondern ein Schwalbenschwanz, der schönste Schmetterling, den sich der Knabe vorstellen kann, mit kunstvoll geschwungenen, frucadegelben Flügeln, die mit schwarzen Mustern bemalt sind, am Unterrand vier blaue Punkte, dunkelblau wie tiefes Wasser, daneben ganz am Rand noch ein roter, und die Flügelenden in die feinsten Spitzen auslaufend.
Der Vater fährt das Insekt auf dem Weg zum Aichingerteich an, es klatscht auf die Windschutzscheibe und der Vater steigt tatsächlich auf die Bremse, bleibt stehen, um nachzusehen, ob es noch lebt. Sein Vater ist zu der Zeit beeindruckt von Schmetterlingen, weil er in der Sonntagsbeilage einer Boulevardzeitung auf eine Bildergeschichte gestoßen ist, die zeigt, wie sich aus Raupen Schmetterlinge entwickeln – eine Tatsache, die jedem Kind bekannt ist, die sein Vater aber erst mit vierzig Jahren durch einen Zeitungsartikel lernt. Der Schmetterling lebt noch und setzt sich, weil er benommen ist oder weil ihn das Orange des T-Shirts anlockt, nach einem kurzen Flugversuch auf die Schulter des Knaben. Nicht auf die Schulter des Bruders, nicht auf die des Vaters, sondern auf seine. Er strahlt, auserwählt fühlt er sich, ein schamhafter Stolz steigt in ihm hoch, der Stolz eines Jünglings, der zum Ritter geschlagen wird, ein geadeltes Schmetterlingskind. Nicht bewegen, sagt der Vater, und der Knabe bewegt sich nicht, hält in Wahrheit schon seit einer halben Minute die Luft an, um den Schmetterling nicht zu verscheuchen. Der Vater holt die Kamera aus dem Auto und drückt so vorsichtig auf den Auslöser, dass man das Klicken der Kamera nicht hört. Für einen Augenblick erstarren Knabe und Schmetterling in vollkommener Reglosigkeit, als wären sie präpariert.
Zumindest erinnere ich mich so daran, wenn ich die Fotografie ansehe. Auch eine Erinnerung an danach ist noch vorhanden, als der Knabe unter Wolken im trüben Moorwasser des Aichingerteichs schwimmen lernen muss. Er mag den Aichingerteich nicht, unter Wasser sieht man keine dreißig Zentimeter, so schmutzig ist es. Der Vater sagt, Moorwasser ist gesund, er hat sich in den Kopf gesetzt, dass es heute sein muss, Schwimmen ist ja auch nicht schwer, der Bub muss sich nur einmal anstrengen und nicht immer so trotzig sein, und als der Bub mit verschränkten Armen dasteht, ein trotziger Achill, der sich weigert, in die Schlacht zu ziehen, packt ihn der Vater und trägt ihn ins Wasser, beide noch das T-Shirt an und in der Unterhose. Er wehrt sich nicht, schlägt nicht aus, schreit nicht, er hält einfach die Luft an und geht unter. Mit Trotz hat er seinen Vater noch jedes Mal bezwungen. Der Trotz verleiht ihm ungeheure Kraft, er macht ihn unbesiegbar, unüberwindbar, der Trotz verwandelt ihn in eine uneinnehmbare Festung. Die Anmaßung des Vaters weckt in ihm einen heiligen Zorn, schließlich kann er länger die Luft anhalten als jeder andere, alle wären sie längst ertrunken, müssten sie so lange unter Wasser bleiben wie er. Er weiß besser als sein Vater, wie man schwimmt, er hat es sich schließlich selbst beigebracht, man darf sich nur möglichst nicht bewegen, dann treibt man auf der Oberfläche, ohne unterzugehen. Aber diesmal lenkt sein Vater nicht ein, er fasst ihn um die Taille und fordert ihn auf, Schwimmbewegungen zu machen, Und wenn wir bis morgen hier stehen. Erst wenn er mit Armen und Beinen strampelt, lässt ihn der Vater los. Augenblicklich geht er unter und augenblicklich zieht ihn sein Vater wieder hoch. Er schluckt Wasser, hustet, versucht dem Griff zu entkommen, aber sein Vater hält ihn fest. Nochmal, sagt der Vater, und erst als es dem Knaben gelingt, mit strampelnden Bewegungen ein paar Meter zurückzulegen, bevor er doch wieder untergeht, lässt es der Vater sein. Mehr kann man da nicht machen, sagt er, und der Knabe weiß nicht, ob der Vater nur wieder die Geduld verloren hat und der Unterricht eine Fortsetzung finden wird, oder ob es das ein für alle Mal gewesen ist. Er weiß nur, dass er nicht schwimmen lernen will, nur untertauchen will er, im seichten Wasser treiben, dort wo es nicht zu tief ist, diese Schwerelosigkeit spüren, das will er.
Als sie nachhause fahren, ist der Himmel wolkenverhangen und grau wie Vulkanasche. Feine Tropfen sammeln sich auf der Windschutzscheibe, vor ihnen Blitz und Donner. Dann geraten sie in die Regenfront, von einer Sekunde auf die andere ist sie da, als hätten sie eine unsichtbare Wand durchstoßen in eine Welt aus Regen. So heftig regnet es, dass sein Vater auf Schritttempo herabbremsen und die Warnblinkanlage einschalten muss. Auf Sicht fahren sie weiter, niemand spricht. Schließlich taucht das Ortsschild am Straßenrand auf. Da begreift er, dass der Sommer wirklich vorbei ist. Das bedeutet, dass er bis zum nächsten Jahr warten muss, bevor er wieder tauchen kann. Dass er bis zum nächsten Sommer zuhause üben muss, in seinem Zimmer. Und üben will er, er will der beste Taucher der Welt werden.
Fertigteilhaus
Ich sitze im Arztzimmer und atme im blauen Licht der Lavalampe. Ich fülle den Bauch mit Luft, den Brustkorb, den Hals bis hinauf zum Kehlkopf, wie ich es damals im Tauchkurs gelernt habe. Ich bin voll mit Luft. Dann atme ich langsam aus, doppelt so lange, wie ich eingeatmet habe, damit der Puls sinkt. Entspannung ist der Schlüssel. Ohne Entspannung keine Erregung, ohne Erregung keine Erektion. Das Telefon am Empfang läutet. Niemand hebt ab. Ich atme wieder ein.
Wer lange die Luft anhalten will, darf nicht verkrampfen. Unter Wasser macht sich jede Verspannung sofort bemerkbar, verspannte Muskeln zehren am Sauerstoffdepot. Der Knabe sitzt reglos in seinem Kinderzimmer und versucht krampfhaft, so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Der Tag am Aichingerteich ist tatsächlich der letzte Badetag gewesen. Der Regen ist eine Woche geblieben und hat den Herbst dagelassen. Jetzt übt er das Luftanhalten in seinem Zimmer. Er verschließt die Tür, damit er ungestört ist, auch wenn der Vater das nicht gerne sieht.
Ganz langsam atme ich aus. Das Ausatmen ist das Wesentliche, loslassen und sich fallen lassen, innen hohl werden und Platz machen für die Erregung. Ich höre das Telefon am Empfang nicht mehr, ich bin ganz bei mir, bin ganz leer und warte darauf, dass Begierde in mir hochsteigt. Ich denke an nackte Frauen und halte die Luft an.
Das neue Schuljahr beginnt, es wird bald kalt, wie es für das Hochland üblich ist. Nächstes Jahr fahren wir nach Jugoslawien, an die Adria, sagen die Eltern mit verheißungsvollem Unterton, Dort ist es immer warm. Was das ist, Jugoslawien, Adria, versteht er nicht. Bedrohlich klingt es, ein möglicher Hinterhalt. Er will nächsten Sommer nur zurück in das Freibad, tauchen will er, so lange wie möglich unter Wasser bleiben, länger als jeder andere Mensch auf der Welt. Bis dahin will er in seinem Zimmer sitzen und die Luft anhalten.
Schritte nähern sich der Tür – habe ich sie wirklich verschlossen? Das Geräusch von Hausschuhen schlurft am Türspalt vorbei – meine tätowierte Arzthelferin in ihren Gesundheitssandalen? Ich verkrampfe und muss Luft holen. Es geht nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ich nehme einen der Bildbände aus dem Regal und klappe ihn auf. Das Lichtspiel der zerfließenden Wachskugeln wandert über die Seiten und lässt die Haut der Frauen schimmern.
Stundenlang sitzt der Knabe hinten in seinem Zimmer am Ende des langen Gangs, der die Räume des Hauses mehr trennt als verbindet, er versucht so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Regentropfen schlagen gegen die Scheibe. Sein Zimmer ist das einzige im Haus mit einem Fenster nach Osten. Bei schönem Wetter sieht er die Sonne aufgehen. Ihres ist das erste Haus in der Siedlung gewesen. Die Pioniere sind sie gewesen, eine Vorhut auf verlorenem Posten, in einem Hochland voller Menschen, die Häuser bauen, um sich darin einzuschließen. Rundherum hohes Gras, ein Sandweg zur Baustelle, am Morgen Hasen, die vor dem Auto herlaufen und abends Rehe, die stumm am Waldrand stehen und auf die Baustelle herabblicken. Eine Baustelle mit Sandhaufen, zwei Brüder im Sand mit Knieschonerhosen. Am Wochenende graben sie Tunnel für ihre Matchboxautos. Sticht die Schaufel des Vaters zu, stürzen die Tunnel ein. So manches Auto landet im Beton. Ein unfreiwilliger Pionier ist sein Vater. Das Haus ist eines der ersten Fertigteilhäuser im Ort. Ein leistbares Haus für die kleine Börse des kleinen Mannes. Ein grundloser Mann ist sein Vater, die Großeltern noch Kleinhäusler, die sich bei der Grafschaft verdient haben, aber der Vater arbeitet sich hoch, zumindest im kleinen Maßstab. Die Fertigteilhausfirma baut das Haus in Windeseile, der Vater hilft. Von den Kollegen, von den Freunden, erntet er schiefe Blicke, Ein Haus baut man selber, wozu hat ein Arbeiter seine Hände, wer lässt denn für sich bauen? Aber die Kosten sprechen dafür, die Teile sind schon fertig, man muss sie nur noch zusammenstecken, genauso wie die Knie des Vaters dafür sprechen, die schon immer kaputt sind, die ihn früh schon in einen Bürostuhl der Regionalbahn setzen, an eine Schreibmaschine, wo er mit seinen Händen nicht viel anzufangen weiß.
Das Fertigteilhaus wird alles haben, was man braucht, einen Keller für die Geräte, das Erdgeschoß für die Familie, einen Dachboden für die Staubluft und zum Rasenmähen einen Garten. Bald folgen weitere Pioniere, die Siedlung wächst, am Morgen hört man ihre Autos auf den asphaltierten Straßen, am Abend sieht man ihre Schemen in den Lichtquadraten der Häuser.
Der Vorteil seines Zimmers ist, neben dem Fenster nach Osten, die Ruhe. Es ist am Ende des Gangs gelegen, nach den Türen zum Keller und zum Abstellraum, der Gang ist fensterlos und verschluckt nicht nur das Licht, sondern auch die Geräusche von vorne. Fest wie ein Pfropfen sitzt er auf der Zimmertür und dämpft die Stimme des Sportkommentators im Fernseher, das Rauschen des Küchenabzugs und das Zufallen von Türen, er dämpft auch die Stille im Haus, die oft ganze Tage einnimmt. Das Zimmer ist wie gemacht dafür, ungestört das Luftanhalten zu üben, das Zimmer ist seine Taucherglocke.
Oberflächenprotokoll
Will man freitauchen, will man ohne technische Hilfsmittel in die Tiefe, muss man sich darauf vorbereiten. Man steigt nicht einfach ins Wasser. Erst muss man aus der Oberflächenhaut schlüpfen. Man hört auf zu sprechen, man sieht sich nicht mehr nach den anderen um, man kehrt die Augen nach innen. Bevor man taucht, visualisiert man den Tauchgang. Man stellt sich vor, wie es in der Tiefe aussieht, man hält den Atem an und versucht die Veränderungen im Körper zu spüren. Tut man das, geht nachher alles wie von allein.
Ob ich die Probe nicht zuhause produzieren und in die Ordination bringen kann, hatte ich am Telefon gefragt. Das hätte es um vieles einfacher gemacht. Natürlich geht das, hatte eine strenge Stimme erwidert, aber der Arzt könne in diesem Fall nicht für die Richtigkeit der Ergebnisse garantieren, denn der Transport müsse schnell gehen und die Probe dürfe nicht auskühlen. Ob es für mich denn ein Problem sei, in die Praxis zu kommen. Es sei natürlich kein Problem, habe ich geantwortet und einen Termin vereinbart. Dabei hätte es andere Lösungen gegeben. Ich hätte die Probe in Alufolie oder einen Schal oder beides einwickeln können. Ich hätte sie ganz eng am Körper tragen können, wie einen Säugling, unter dem T-Shirt, wo sie niemand sieht. Darüber noch einen dicken Pullover, damit sie auch wirklich nicht auskühlt. Die Leute auf der Straße hätten mich vielleicht komisch angesehen, weil ich bei der Hitze so warm angezogen bin, vielleicht hätten sie auch die Beule im Stoff bemerkt, aber welches Gefahrengut ich da außerhalb meines Körpers bei mir trage, hätten sie nicht erraten.
Stattdessen habe ich die zwei Wochen bis zum Termin die Frage mit mir durch die Straßen getragen, was es denn eigentlich bedeuten würde, wenn ich kein Vater werden kann. Was würde dieser Umstand aus mir machen? Wäre ich dann eine andere Art von Mann, gibt es einen Unterschied zwischen Vatermännern und den anderen, den Söhnen, die niemals die Rolle des Vaters übernehmen, den Nur-Söhnen?
Wenn es einen Unterschied gibt, müsste man ihn sehen können, habe ich mir gedacht. Es müssten sich gewisse Eigenschaften finden lassen, Merkmale, an denen sich festmachen lässt, ob ein beliebiger Mann ein Vater ist oder nicht. Nach diesen Merkmalen habe ich gesucht, während die Wartezeit verstrichen ist.
Vatermänner tragen oft Sachen und gehen schnell, ist mir aufgefallen. Eine Auswahl an Mehlspeisen in der Hand, queren sie wochenends den Zebrastreifen, in der anderen Hand eine vollgestopfte Leinentasche, und vor ihnen läuft ein Kind mit einem Laufrad. Nursöhne fahren Fahrrad, sie bremsen notgedrungen und schlängeln sich zwischen Vater und Kind durch, obwohl die Ampel für sie auf Rot steht. Nursöhne besitzen nicht zwingend einen Führerschein, wie meine Erkundigungen ergeben haben, und wenn, dann fahren sie Mietwagen. Vatermänner erwerben Eigentum, sie tragen am Samstagvormittag Trainingsanzüge und bauen auf ihren Balkonen Möbelstücke zusammen. Nursöhne sitzen am Samstagvormittag am Fenster, sie rauchen und sehen den Vatermännern gegenüber beim Handwerken zu. Wenn Vatermänner rauchen, dann heimlich, oder sie sagen, sie rauchen eigentlich nicht, während sie sich eine Zigarette anzünden. Nursöhne nehmen auch mal Drogen, sie wissen, wo man gute Ware bekommt. Vatermänner kaufen Babysachen, sie legen Wert auf Qualität. Stolz schieben sie Kinderwägen mit breiten Reifen vor sich her. Vatermänner legen eine Märchensammlung an, und wenn nötig, erzählen sie ihren Kindern kleine Lügen. Nursöhne suchen ihr wahres Selbst, und auf der Suche sammeln sie Reisen. Nursöhne gehen ins McFit. An ihren Trainingsgeräten wirken sie manchmal ein wenig einsam. Vatermänner gehen in ein Studio mit Wellnessbereich. Vatermänner schaukeln Säuglinge auf ihren kräftigen Armen in den Schlaf, die kleinen Babyköpfe lassen ihre Hände riesig wirken. Vatermänner sind fürsorglich, Vatermänner halten Hände. Nursöhne masturbieren. Manchmal hätten die Vatermänner gerne etwas mehr Zeit für sich. Vatermänner optimieren ihren Alltag. Nursöhne optimieren sich selbst. Vatermännern fehlt Schlaf, sie wirken immer müde. Die Nacht gehört den Nursöhnen. Sie sehen Filme im Kino und tanzen bis zum Tagesanbruch. Sie sind nie müde und sie schlafen lange. Der Morgen gehört den Vatermännern.
Je mehr dieser zweifelhaften Unterscheidungsmerkmale ich sammle, umso unschärfer werden die Unterschiede zwischen Vatermännern und Nursöhnen. Irgendwann erscheinen mir alle Männer gleich. Ich wechsle meine Strategie und frage die Männer selbst nach ihrer Meinung, ich frage Freunde von mir, werdende Väter, Männer mit Kindern und Männer ohne. Ob denn Vera schwanger sei, ist fast immer die erste Gegenfrage. Nein nein, sage ich, es interessiert mich einfach so, ob es da einen Unterschied gibt, zwischen Männern mit und ohne Kind, Vatermännern und Nursöhnen. Manche reagieren irritiert, Nursöhne, das klinge komisch. Manche erklären mir ohne Umschweife, worin der Unterschied liege, andere stellen fest, dass die Frage an sich kompletter Unsinn sei. Ein paar wirken ratlos und denken lange nach, bevor sie antworten. Zum Beispiel an den Falten, sagt ein Freund ohne Kinder, an den Falten erkennt man die Väter, oder nicht? An der schlechten Kleidung, sagen Väter über sich selbst. Sie ziehen an, was sich gerade findet. Was ja auch etwas Positives hat, sagen sie, man investiert das Geld in die Kinder statt in sich selbst. Und an den grauen Haaren, sagen sie, bei ihnen geht es halt schneller. Der A. zum Beispiel hat keine Kinder, sagen die Väter, siehst du, deshalb hat der auch keine grauen Haare, obwohl der gleich alt ist. Und sonst verändert man sich nicht, frage ich. Er findet nicht, dass er sich verändert hat, sagt einer, worauf sein Nebenmann einwirft, alles verändere sich doch durch Kinder. Und was genau, frage ich, und die beiden überlegen angestrengt. Nichts wird sich nach der Geburt ändern, sagt ein Dritter, mein Leben soll bleiben, wie es ist. Dann erzählt er von dem Tagebuch, das er noch am Tag der freudigen Botschaft zu schreiben begonnen hat. Außerdem ziehe er die Beschriftung auf seinen alten VHS-Kassetten nach, in zwanzig Jahren werden dem Kind die Augen übergehen, wenn es seine Filmsammlung erbt.
Seine Zeit müsse man schon besser einteilen, sagt einer nach ernsthaftem Nachdenken, man ziehe sich auf das Wesentliche zurück, die Zeit reiche nicht mehr für das ganze Drumherum – Übergepäck des Lebens nennt er es –, für schlechte Konzerte, nichtssagende Ausstellungen oder lange Abende mit überzähligen Freunden, Kinobesuche, ein Bier mit dem neuen Arbeitskollegen, solche Sachen halt. Man überlege nicht mehr ständig, was man unternehmen soll, viele Entscheidungen würden einem abgenommen. Man denke auch nicht mehr so viel über sich selbst nach, sagt er, die Gedanken kreisen nicht mehr in einem fort um einen selbst. Man mache sich stattdessen Gedanken über das Kind. Man bekomme einen völlig neuen Blick auf die Welt, denn man sähe sie plötzlich mit den Augen des Kindes. Da werde einem klar, wie blind man vorher gewesen ist. Wie eine riesige Befreiung habe sich das für ihn angefühlt, sagt er. Man müsse sich nicht mehr beweisen, Kinder akzeptieren einen, wie man ist. Der Umgang mit dem eigenen Kind falle ihm viel leichter als das aufgesetzte Gehabe früher mit den Freunden, die Eltern-Kind-Beziehung sei einfach um vieles befriedigender. Wie ein Gott fühlt man sich, formuliert es ein anderer Vater, Man erschafft die Welt neu, stell dir das vor, nicht nur, dass man aus sich hinauswächst, in das Kind hinein, man verändert das Leben anderer Menschen, aus der Partnerin zum Beispiel macht man eine Mutter, und die Eltern verwandelt man in Großeltern, ob sie wollen oder nicht. Und wenn man adoptiert, frage ich, ist man dann auch ein Gott? Ich weiß nicht, sagt er, das ist glaub ich nicht dasselbe. Schon allein wegen der Gene.
Die Vatermänner stellen auch Gegenfragen, sie fragen, warum ich glaube, dass es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Menschen mit und ohne Kindern, und wenn, dann doch bei den Müttern, für die würde sich wirklich etwas ändern. Aber die Männer, frage ich, ist denn da nichts besonders? Der Gedanke an den Tod spiele eine größere Rolle, sagen zwei Väter. Da sei die Angst davor, dass dem Kind etwas zustößt, dass es sterben könnte, die einen würge. Auch die Frage, was mit dem Kind passiert, wenn sie selbst plötzlich sterben, treibe sie um. Aber ist gerade das bei den Müttern nicht dasselbe, frage ich. Na ja, sagt einer, selbst wenn er nur einen Spielfilm sieht, wo einem Kind etwas zustößt, berühre es ihn extrem, früher habe ihn das vollkommen kalt gelassen. Man entwickle mehr Empathie, sagt er, die man als Mann sonst nicht so habe. Also hat dich dein Kind wirklich verändert, hake ich nach. Na ja, sagt er, schon, aber hauptsächlich liege das daran, dass man mit dem Kind so viel Zeit verbringt. Verbrächte man so viel Zeit mit dem Aufziehen einer Karotte, zum Beispiel, würde man für diese Karotte genauso viel Empathie empfinden. Aber es ist doch viel anspruchsvoller, ein Kind zu erziehen, als eine Karotte, sage ich. Eigentlich nicht, sagt er, so viel müsse man da gar nicht können, jetzt verglichen mit dem Aufziehen einer Karotte. Vielleicht für Frauen, für die sei es vermutlich etwas Besonderes, ein Kind großzuziehen, sagt er, aber für Männer nicht. Männer essen ja auch nicht gerne Karotten, sagt er.
Man glaubt immer, man verpasst etwas, wenn man kein Kind bekommt, sagt ein kinderloser Freund, aber umgekehrt kann man auch etwas verpassen, verstehst du? Manche Leute glauben einfach, man brauche ein Kind. Das findet er nicht. Er findet nicht, dass das Vatersein unbedingt zum Leben dazugehören muss. Das Kind steht dann zwischen dir und deiner Partnerin, man ist einander nicht mehr der wichtigste Mensch im Leben. Ich denke an Vera, wie sie ein Kind auf den Armen trägt. Aber es muss doch kein Entweder-Oder sein, sage ich. Man kann doch beide gleich lieben. Stell dir vor, sagt er, nur als Beispiel, Vera und das Kind werden in wenigen Sekunden von einem Zug überfahren und du kannst nur einen von beiden retten. Es ist doch klar, wen du retten würdest, oder nicht?
Je länger diese Gespräche dauern, umso schwerer fällt es mir, nicht den Faden zu verlieren. Vielleicht ist es ja so, denke ich, dass die Vaterschaft nicht verändert, wer man ist, sondern wer man in Zukunft noch werden, welche der verschiedenen Anlagen man in Zukunft zur Entfaltung bringen kann. Aber wenn die Antwort auf die Frage, was das Vatersein aus einem Mann macht, in einer Zukunft liegt, die sich nicht materialisiert, solange man kein Vater ist, wie soll man dann eine Antwort finden?
Ich versuche noch ein Letztes. Was sehe ich denn, wenn ich meinen Vater betrachte, frage ich mich. Wie hat er sich verändert? Die Antwort ist schwer zu geben, dieser Mann existiert für mich nur als Vater, es ist für mich nicht vorstellbar, dass es da vor meiner Geburt noch einen anderen Mann gegeben hat, einen Vor-Vater. Aber vielleicht lässt sich der Unterschied zwischen Vatermann und Nursohn aus den Unterschieden zwischen ihm und mir rekonstruieren. Davon gibt es tausende, zum Glück. Lassen sich davon welche darauf zurückführen, dass er ein Vater ist und ich nicht?
Zumindest einen Unterschied sehe ich. Nursöhne wie ich bauen nicht. Das bleibt den Vatermännern vorbehalten. Vatermänner bauen ein Haus und sperren die Zukunft darin ein. Manche von ihnen bauen das Haus sogar mit ihren eigenen Händen, oder machen zumindest der Baufirma den Handlanger, um etwas Geld zu sparen, schuften am Wochenende für zwei. Mein Vater, der Vater des Knaben, ist so einer. Auch wenn er am Wochenende mehr aufräumt als baut, ist das Hausbauen das Zentrum seines Lebens. Weil er ohne die Fertigteilhausfirmenarbeiter nicht viel tun kann, ist er oft gereizt, er ärgert sich über die beiden Söhne, die glauben, die Baustelle sei ein großer Spielplatz. Er ist ungeduldig, es kann ihm nicht schnell genug gehen, rastlos und sinnlos läuft er auf der Baustelle hin und her. Als das Haus dann fertig ist, wird er plötzlich still, er bewegt sich mit Bedacht, als wäre das Haus nicht seines, vorsichtig wie ein Mieter verhält er sich, und manchmal bekommt er keine Luft in seinem fertigen Haus, dann muss er hinaus, geht in die Garageneinfahrt und schlägt Holzscheite klein. Viel zu groß sind sie heuer wieder geliefert worden, so passen sie nicht in den Kachelofen, sagt er jedes Jahr, und der Sohn sieht zu, wie sich der Vater durch die Scheite hackt. Er sieht zu, wie der Vater langsam seinen Rhythmus findet und sich sein Atem beruhigt, wie sich die Falten auf der Stirn legen und die Schultermuskulatur vom Nacken ablässt. Das alles sieht der Sohn, liest es im Vatergesicht, und als der Vater nach dem nächsten Scheit greifen will, stellt ihm der Sohn schnell eines auf den Pflock, der Vater zögert kurz, dann haut er das Scheit mit einem Schlag durch. Gleich stellt der Sohn das nächste hin, und zack, wieder mit einem Schlag ist es gespalten, und so geht es weiter, die Bewegungen von Vater und Sohn fließen ineinander und immer mehr Scheite nehmen die passende Form für den Kachelofen im Winter an. Schließlich macht der Vater eine Pause, er geht in die Speisekammer, wo Mineralwasser und Bier warten. Die Axt haut er in den Pflock, bevor er verschwindet. Der Sohn stellt schon das nächste Scheit bereit. Neugierig betrachtet er die Axt. Sie ist nicht groß. Mit beiden Händen kann er sie halten. Er zieht daran. Sie sitzt fest. Er stellt den Fuß auf den Pflock und zieht stärker. Der Pflock wackelt, das Scheit fällt hinunter und gleichzeitig löst sich die Axt und fährt mit den Händen des Sohnes in den Himmel. Aber er hat aufgepasst, er hat den Moment erspürt, er stoppt ihren Flug am Zenit und hält sie fest mit ausgestreckten Händen. Er befühlt die Axt. Ihr Stiel ist glatt und warm, der Metallkopf kalt, die Schneid hat Kerben und schnappt nach der Haut des prüfenden Daumens. Schwer zieht die Klinge die Axt nach unten, aber er hält sie trotzdem sicher. Er sucht sich ein gutes Scheit – nicht zu groß, aber auch nicht zu klein – und stellt es auf den Pflock, dreht es noch ein wenig, damit es sicher steht auf der unebenen Fläche. Er blickt zur Kellertür, die sich nicht regt, hebt die Axt, und lässt sie nach unten stürzen. Daneben. Die Axt steckt im Pflock und das Scheit fällt zu Boden. Er versucht es noch einmal, stellt das Scheit genauso hin wie zuvor. Er holt aus, konzentriert sich, zielt etwas weiter nach links, und dieses Mal trifft er, hart am Rand schlägt er einen langen Splitter aus dem Holz, der hell singend durch die Einfahrt fliegt. Der Sohn reckt die Axt triumphierend in den Himmel. Der nächste Hieb wird es sein, nur ein wenig mehr noch nach links, der wird das Scheit spalten. Eilig stellt er das umgefallene Holz wieder auf, hebt die Axt über den Kopf – jetzt kommt es darauf an –, da sieht er den Vater, der in der Kellertür steht und ihn betrachtet. Der Vater ist nicht böse, man sieht es in seinem Gesicht. Er ist neugierig. Na, sagt er, bist du auch schon ein Großer? Der Sohn steht da und sieht den Vater an. Er weiß nicht, soll er die Axt sinken lassen? Aber der Vaterblick ist aufmerksam, erwartungsvoll. Nur zu, sagt dieser Blick. Probier es. Zeig mir, was für einer du bist.