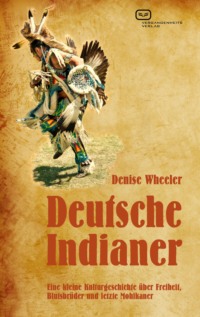Kitabı oku: «Deutsche Indianer»
Denise Wheeler
Deutsche IndianerEine kleine Kulturgeschichte über Freiheit, Blutsbrüder und letzte Mohikaner
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-86408-228-3
Lektorat: Berenike Schaak
Coverabbildungen: © ben44 / Shutterstock, © Nik Merkulov/ Shutterstock
© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2017, www.vergangenheitsverlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Der Indianerkult in Deutschland
Chingachgook. Die Missionierung der Delawaren in Pennsylvania
Edle oder arme Wilde? Gedanken über das Leben des Indianers im Naturzustand
Der letzte Mohikaner. Coopers Roman und die Folgen
Ritter der Prärie. Forschungs- und Abenteuerreisen zu den Indianern
Einigkeit und Recht und Freiheit. Der Indianer als Symbol für Patriotismus
Pflanzenmenschen. Indianer in der Völkerkunde und in den politischen Schriften des 19. Jahrhunderts
Sitting Bull. Die Dakota als Freunde der Deutschen
Winnetou. Der Indianer als Edelmensch
Blutsbrüder. Indianer und Deutsche in den 1920er- und 1930er-Jahren im deutschen Showbusiness
Der ‚‚Kampf ums völkische Dasein‘‘. Indianerliteratur der 1920er- bis 1950er-Jahre.
Winnetou im Kalten Krieg. Indianerfilme und Jugendkultur in Ost und West
Im roten Reservat. Das Indianer-Hobby in den 1970er- und 1980er-Jahren in der DDR
Traumtänzer. Die New-Age-Bewegung und die Indianer
Gelassenheit. Indianer im Zeitalter der Globalisierung
Anhang
Interview mit Robin Leipold, Kurator des Karl-May-Museums in Radebeul
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Der Indianerkult in Deutschland
Sind Sie als Kind Indianer gewesen? Haben Sie als stolzer Krieger für eine gerechte Sache gegen die Bleichgesichter und ihre korrupte Welt gekämpft?
Haben Sie sich darin geübt, Schmerzen und Demütigungen zu ertragen, getreu dem Sprichwort: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“?
Oder haben Sie in liebevoller Handarbeit Friedenspfeifen gebastelt und Mokassins aus Fensterleder mit Perlen bestickt?
Interessieren Sie sich immer noch für alles, was mit Indianern zusammenhängt? Und haben Sie sich schon einmal gefragt, warum?
In vielen Ländern Europas gehört das Cowboy-und Indianerspiel zur Kindheit. Dass aber die Indianer die Guten und die Cowboys die Schurken sind, das gibt es so nur in Deutschland. Seit Generationen laufen junge Deutsche zu den Indianern über. Die Deutschen bewunderten den Indianer nicht nur wegen seiner Kampftüchtigkeit, seiner Loyalität und seiner Selbstbeherrschung, sondern auch wegen seiner Großzügigkeit, seiner Bescheidenheit und seiner Friedensliebe. Sie glaubten vor allem, dass er ein glücklicheres und erfüllteres Leben führte als sie, in Harmonie mit seinen Mitmenschen und der Natur. Dieser Glaube konnte so weit gehen, dass manche daraus einen Beruf machten und sich als Ethnologen oder zumindest Hobby-Ethnologen ein Leben lang der Erforschung indianischer Kulturen widmeten, um den Indianern nahe sein zu können. Eva Lips zum Beispiel, die Frau des Indianerforschers Julius Lips, schrieb 1964 in einem Buch über die Forschungsaufenthalte ihres Mannes bei den Ojibwa-Indianern:
„So gehört es zu den allergrößten Erlebnissen, die mir geschenkt wurden, zu sehen, wie Jules im Land der Indianer eine Heimat fand, wie er, der sich ihrem Wesen von Kindheit anverwandt gefühlt hatte, diese Verwandtschaft nun leben durfte, wie sie ihn aufnahmen, wie sprachliches Verstehen […] sich anbahnte, und vertiefte, wie Jules unter ihnen ein Leben führte als Beschenkter und Arbeitender, als Lernender und Forscher, als ehrfürchtiger Gast und Kamerad – das Leben eines Bruders der Menschen der Wildnis, ihrer Tiere und Pflanzen“1
Dieses Buch möchte der deutschen Indianerbegeisterung auf den Grund gehen. Es möchte Fragen beantworten wie: Woher kommt dieses Gefühl der Verwandtschaft mit den Indianern? Seit wann gibt es dieses Phänomen? Warum identifizieren sich die Deutschen gerade mit den Indianern und nicht mit irgendeinem anderen „Naturvolk“? Warum sind ausgerechnet die Dakota unsere liebsten Indianer? Warum war die Indianerbegeisterung besonders in der DDR so lebendig? Was sagen die Indianer in den USA dazu, dass wir uns ihre Kultur aneignen? Und schließlich: Warum hat das Interesse am Indianer so sichtbar nachgelassen?
Zwei Bemerkungen möchte ich vorausschicken. Erstens, in diesem Buch wird es nur gelegentlich um die echten Indianer, um die Native Americans gehen. „Den Indianer“, von dem hier die Rede sein wird und der im Zentrum der Indianerbegeisterung steht, gibt es in der Realität nicht. Er ist eine Erfindung von Nicht-Indianern, von Missionaren, Dichtern, Abenteurern, Politikern, Zirkusdirektoren und Filmproduzenten.
Er ist ein Klischee, das sich im Laufe der letzten 200 Jahre immer wieder gewandelt hat und das dadurch lebendig geblieben ist. Neue Eigenschaften sind hinzugekommen, andere sind unverändert geblieben und nur etwas in den Hintergrund getreten. So konnte der Indianer nacheinander und oft sogar gleichzeitig all das sein: edler Wilder, Vertreter einer untergehenden Rasse, Freiheitskämpfer, Patriot, mutiger Krieger, Friedensbote, Blutsbruder, antiimperialistischer Widerstandskämpfer, Heiler und schließlich spiritueller Führer. Was dieses Buch zeigen wird ist, wie die Deutschen mit dem Indianer gedanklich immer wieder Entwürfe dessen durchgespielt haben, was es bedeutet „deutsch“ zu sein. Wie das vor sich ging, wird an konkreten Beispielen aus Literatur, Film, Kunst und Sachbuch vorgeführt.
Zweitens ist das Thema „Indianer“ sehr emotionsgeladen, eben weil es dabei eigentlich um uns selbst, um unsere eigene Identität geht. Bis in das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts sind Kinder in Deutschland mit dem Indianer sozialisiert worden, in dem sie Abenteuerbücher lasen, Indianerfilme sahen und Indianer spielten. Wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, dann tun wir das mit einer gewissen Portion Sentimentalität. Wir neigen dazu, die Helden unserer Kindheit und ihre Ideen zu verteidigen, ganz gleich ob wir nun die Bücher von Karl May, Fritz Steuben oder Liselotte Welskopf-Henrich gelesen haben oder ob uns mehr die Westernfilme der 1960er und 1970er Jahre geprägt haben. In diesem Buch wird die Geschichte der deutschen Indianerbegeisterung erzählt, aber nicht der Versuch unternommen zu entscheiden, welches Bild vom Indianer authentischer, realistischer oder besser ist als das andrere. Wenn es dabei Anregungen bieten kann, etwas genauer und kritischer über die Botschaften nachzudenken, die uns die Indianerfiguren unserer Kindheit vermittelt haben, um so besser.
Chingachgook. Die Missionierung der Delawaren in Pennsylvania
Die ersten deutschsprachigen Berichte über die Indianer Nordamerikas wurden Ende des 17. Jahrhunderts von Pietisten verfasst, die hohe moralische Ansprüche an sich selbst und ihre Mitmenschen stellten. Sie fühlten sich den Indianern oft sehr viel näher als ihren eigenen, weniger frommen Landsleuten, die sie als „alte Christen“ bezeichneten. Sie selbst sahen sich als „neue Christen“, als neu geboren im Glauben. Der Pietismus war eine Frömmigkeitsbewegung innerhalb der lutherischen Kirche, die sich zu dieser Zeit in Europa stark ausbreitete. Die ersten Pietisten waren Professoren, Juristen, Theologen, Studenten und gebildete Adlige, die sich in Privathäusern oder Gaststätten trafen, um in kleinem Kreis eifrig die Bibel zu studieren. Sie glaubten, dass man das wahre Christentum nur außerhalb der etablierten Kirche leben könne. Bei ihnen stand die persönliche Beziehung zu Gott im Mittelpunkt. Religion war für sie etwas, das den ganzen Menschen ergreift. Sie distanzierten sich von den für sie oberflächlichen Lippenbekenntnissen und den steifen Ritualen, wie sie in den Landeskirchen der absolutistischen Kleinstaaten üblich geworden waren.
Als die Jahrhundertwende näherrückte, glaubten viele Pietisten, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorstünde und dass man sich auf die baldige Ankunft des Heilands durch ein Leben in tätiger Nächstenliebe vorbereiten sollte. Einige wollten dies weit ab von den Ablenkungen der Welt in den unberührten Wäldern Nordamerikas tun. So folgte 1683 die Pietisten-Gemeinde in Frankfurt am Main einer Einladung William Penns, der schon seit Jahren unter deutschen Protestanten um Siedler für seine Quäkerkolonie in Amerika geworben hatte, und schickte den 32-jährigen, mittellosen Juristen Franz Daniel Pastorius nach Pennsylvania, um Land zu kaufen. Es entstand die erste deutsche Siedlung auf amerikanischem Boden: Germantown. Die Stadt wurde zu einem wichtigen Zentrum der deutschen Siedlungsbewegung in Amerika. Bis 1756 wanderten etwa 100.000 Deutsche nach Nordamerika aus, von denen die meisten in Pennsylvania blieben. Die ersten Einwohner von Germantown waren jedoch keine Pietisten aus Frankfurt, sondern 13 Mennonitenfamilien aus Krefeld. Sie waren keine hochgebildeten Akademiker, sondern einfache Weber. Pastorius wurde ihr Bürgermeister, Lehrer und Seelsorger.
In der Hoffnung, einige seiner Frankfurter Glaubensgenossen doch noch zu einer Übersiedlung in die Neue Welt überreden zu können, verfasste Pastorius fünf Jahre nach seiner Ankunft in Amerika eine ausführliche Beschreibung Pennsylvanias. Sie wurde 1700 in Deutschland veröffentlicht und ermutigte viele Ausreisewillige dazu, den Sprung nach Amerika zu wagen. Wie das in derartigen Pamphleten oftmals üblich war, schilderte Pastorius die Kolonie als eine Art Paradies: Der Boden sei fruchtbar, das Wasser süß, die Luft mild, der Gesang der Vögel lieblich, die Einwohner harmlos und unschuldig wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. In Pennsylvania hatten es die Siedler mit den Lenni Lenape zu tun, die die Engländer Delawaren nannten. Sie hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend vor den Weißen zurückgezogen, so dass Pastorius sie wohl kaum aus persönlicher Anschauung kannte, als er über sie schrieb: „Sie befleißigen sich einer auffrichtigen Redlichkeit/ halten genau über ihre Versprechen/ bekriegen und beleidigen niemanden; sie beherbergen die Leute gerne/ und sind ihren Gästen dienstfertig und treue.“2 Sie seien nicht schwatzhaft und es gehe ganz anständig bei ihnen zu. Vielweiberei oder lose Ehesitten gebe es bei ihnen nicht. Ihre Hütten bestünden aus gebogenen jungen Bäumen, die sie mit Baumrinde abdeckten und auch sonst bräuchten sie nicht viel:
„Ihre Tafel und Banck war die liebe Erde/ ihre Löffel waren Muscheln/ damit sie das warme Wasser aussuppeten/ ihre Teller waren des nechsten Baumes Blätter/ die sie nach der Mahlzeit weder mühsam abspühlen/ noch zu künftigem Gebrauch sorgsam bewahren dörffen. Ich dachte bei mir/ diese wilden Leute haben die Lehre von Jesu von der Mässigkeit und Vergnügsamkeit ihr lebtag nicht gehöret/ und thun es doch denen Christen weit hervor.“3
Pastorius berichtete weiter, dass die Indianer viel Zeit in „continuirlichen Müßiggang“4 vor allem mit Tabakrauchen, Gesang und dem Bemalen ihrer Gesichter verbringen. Sie schienen sich keine Gedanken um ihre Zukunft zu machen und zum Beispiel Vorräte für den Winter anzulegen. Aber auch daran fand Pastorius nichts zu tadeln. Denn war das nicht ein Zeichen von Gottvertrauen? Hatte nicht auch Jesus von den Vögeln auf dem Feld gepredigt, die sich nicht um Nahrung und Kleidung sorgen, und die Gott dennoch erhält?
Wohlwollend bemerkte Pastorius auch, dass die Delawaren keine Götzen anbeteten, wie die Heiden andernorts, sondern „einen allmächtigen und gütigen Gott/ der dem Teuffel seine Macht beschränke“. Sie glaubten an die Unsterblichkeit der Seele und an eine Art letztes Gericht, an dem ein guter Lebenswandel belohnt und ein schlechter bestraft werde. Der Schritt zum Christentum schien für sie also nicht besonders groß zu sein. Für Pastorius waren die Indianer ohne Sünde. Ihre paradiesische Lebensweise war jedoch bedroht, und zwar durch „das Babylonische“, durch die Verlockungen des Bösen in der Welt, von dem sich die Pietisten selbst abgewendet hatten. Den Indianern trat „das Babylonische“ vor allem in Gestalt von Händlern gegenüber, die sie betrogen, die ihnen Waffen und Alkohol verkauften und sie so von europäischen Gütern abhängig machten. Durch solche „Maulchristen“, wie Pastorius sie nannte, weil sie behaupteten, Christen zu sein, sich aber nicht wie Christen benahmen, lernten die Indianer Verhaltensweisen kennen, die es in ihrer Welt vorher nicht gegeben habe. Ihr guter Charakter werde durch Alkohol, Betrug und Raub verdorben.
Die Pietisten, die 50 Jahre nach Pastorius’ Ankunft in der neuen Welt, die Mission der Indianer tatsächlich in Angriff nahmen, bewunderten die indianische Lebensweise allerdings nicht, sondern hielten sie für sündhaft und teuflisch. 1741 gründeten die Brüder und Schwestern der aus der Oberlausitz stammenden Herrnhuter Brüdergemeine die Stadt Bethlehem in Pennsylvania, die zum Zentrum der Herrnhuter in Amerika wurde. Ihr Anliegen war es, die aus ihrer Perspektive armen Heiden aus den Fängen des Satans zu befreien und sie mit der frohen Botschaft von Gottes Gnade bekannt zu machen. Wobei ihnen bewusst war, dass dies keine leichte Aufgabe werden würde. Denn die Heiden in Amerika zeichneten sich „durch besondere Wildheit, Steifsinn, und Hartnäckigkeit aus, wovon sie vielleicht von keinem anderen Volk auf Erden übertroffen werden“.5 So steht es jedenfalls im Vorwort eines Buches, das die Geschichte der Herrnhuter Indianermission erzählt. Geschrieben hat es 1789 der damalige Bischof der Brüdergemeine Georg Heinrich Loskiel. Er stützte sich dabei auf die Tagebücher und Berichte der Missionare vor Ort.
Der Gründer der Herrnhuter, Graf Nikolaus von Zinzendorf, war in der pietistischen Erziehungsanstalt August Hermann Franckes in Halle erzogen worden. Gleich nach dem Studium der Rechtswissenschaften ließ er sich auf seinen Gütern in Ostsachsen nieder und versuchte, die Idee eines Lebens in tätiger Nächstenliebe mit einer Gemeinde von Gleichgesinnten in die Tat umzusetzen. 1722 hatte er einigen versprengten Anhängern von Wiedertäufersekten, die aus dem benachbarten Mähren vertrieben worden waren, auf seinem Gut Berthelsdorf Asyl gewährt. Mit ihnen gründete er den Ort Herrnhut. Während zur gleichen Zeit ihr Landesvater, König August der Starke, sich dem Ausbau Dresdens zu einer barocken Residenzstadt widmete und Schlösser wie den Dresdner Zwinger oder Schloss Pillnitz als Kulisse für rauschende Feste errichten ließ, beschlossen die Brüder und Schwestern in Herrnhut, nach dem Vorbild der urchristlichen Gemeinden, in Arbeits-und Gütergemeinschaft von der Feldarbeit zu leben. Sie verweigerten den Wehrdienst und leisteten keine Eide. Selbst die Gemeindeämter richteten sie nach dem Neuen Testament aus.
Angefeindet von anderen Adligen und von orthodoxen Theologen, wurde Zinzendorf 1732 aus Sachsen verbannt. Er ging mit einigen Anhängern nach Hessen und begann, viel zu reisen. In dieser Zeit des Exils fiel der Entschluss, sich der Heidenmission zu widmen. Jedes Mitglied der Brüdergemeine, egal ob Mann oder Frau, konnte Missionar werden. Zinzendorf besorgte das notwendige Geld beim Adel Europas. Da er verwandtschaftliche Beziehungen zum dänischen Königshof hatte, gingen die ersten Missionare in dänische Kolonien nach Grönland und auf die westindische Insel St. Thomas. Ab 1738 waren die Herrnhuter dann auch in Nordamerika tätig, zuerst in Georgia und in New York, dann vor allem in Pennsylvania.
1738 ließ sich ein Herrnhuter namens Christian Rauch in der Indianersiedlung Shekomeko in New York bei den Mahicans nieder, die bei Loskiel Mohikaner heißen. Ein Jahr später gab es bereits zehn, und zwei Jahre später sogar sechzig bekehrte Mohikaner. Das weckte große Hoffnungen bei den Herrnhutern, besonders bei Zinzendorf selbst. Die Siedler in der Nachbarschaft hingegen befürchteten, dass die in ihren Augen merkwürdigen Herrnhuter mit den Franzosen paktierten, und dass sie die Indianer gegen die Engländer aufrüsten und stärken wollten. Daher wurde 1744 das Missionieren in New York verboten. Daraufhin zogen die christlichen Mohikaner mit ihrem Missionar nach Pennsylvania. Einige Kilometer außerhalb Bethlehems wurde für sie eine Siedlung gebaut, die den Namen Friedenshütten erhielt. Etwas später entstand eine zweite Indianersiedlung namens Gnadenhütten, in die im Laufe der Zeit mehr und mehr Delawaren aus der Umgebung und Angehörige anderer Stämme zogen. 1750 waren bereits 500 Indianer getauft.
Die Herrnhuter bauten zusammen mit den Indianern Blockhütten und legten Gärten und Felder an, um die Selbstversorgung der Siedlung sicherzustellen. Eine Kirche und eine Schule wurden errichtet, ebenso eine Mühle, eine Schmiede und eine Bäckerei. Die Missionare hielten die Indianer dazu an, sich europäisch zu kleiden, oder wenigstens nicht nackt herumzulaufen, und mit ihnen auf den Feldern zu arbeiten. Sie legten großen Wert auf die Einhaltung der christlichen Gebote, ebenso auf Ordnung und Fleiß. Wer die Regeln nicht befolgte oder sich nicht an den Arbeiten beteiligte, musste den Ort verlassen. Händler, die den Indianern in der Regel Alkohol ausschenkten, durften Gnadenhütten nicht betreten.
Auch wenn die meisten Delawaren nichts von den Herrnhutern wissen wollten, so war diese Mission doch im Vergleich zu anderen Missionen, wie etwa die der Puritaner in Neuengland, recht erfolgreich. Es war ja niemals ein Anliegen der Herrnhuter gewesen, ganze Völker zu bekehren. Ihnen ging es um jede einzelne „Heidenseele“. Mit jedem Kandidaten führten die Missionare oder ihre indianischen Helfer individuelle Gespräche, vor allem darüber, welch große Gnade es für die Menschen bedeutete, dass Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für ihre Sünden hatte sterben lassen. Selbst als Heide konnte man an dieser Gnade Gottes teilhaben. Die erste „Heidenseele“, welche die Herrnhuter „gerettet“ haben, gehörte einem Mohikaner aus Shekomeko mit dem Namen Chingachgook (die große Schlange), der auch Tschoop genannt wurde. Er sollte das Vorbild für die berühmteste Indianerfigur der Weltliteratur werden, für James Fenimore Coopers Der letzte der Mohikaner. In Loskiels Buch findet sich ein Brief, den Tschoop diktiert haben soll und in dem er die Brüder und Schwestern in Bethlehem darum bittet, getauft zu werden:
„Ich bin ein armer wilder Heide gewesen, der 40 Jahre lang nicht mehr gewußt hat, als ein Hund. Ich war der größte Säufer, der willigste Sklave des Teufels unter den Wilden; und weil ich nichts von dem Heilande gewußt habe, so habe ich nichtigen Göttern gedient, die ich jetzt ins Feuer wünsche. Das habe ich mit vielen Thränen bereuet. Als ich hörte, daß er auch der Heiden Heiland wäre, und ich ihm mein Herz noch schuldig sey, so fühlte ich in meinem Herzen einen Zug zu ihm.[…] Der Feind hat mich oft wollen untreu machen, was ich aber zuvor noch lieb hatte, wird mir täglich mehr und mehr zu Koth. Ich bin der arme wilde Tschoop.“6
Chingachgook war ein sogenannter „Erstling“, der nach seiner Taufe (und nachdem er aufgehört hatte, Alkohol zu trinken) auf ideale Weise verkörperte, wie sich die Herrnhuter einen „neuen Christen“ vorstellten. Er war ein einflussreicher Mann und deshalb folgten viele seiner indianischen Bekannten seinem Vorbild und konvertierten ebenfalls.
Loskiel schildert, dass die Indianer während der Bekehrung oft anfingen zu zittern, zu stammeln und hemmungslos zu weinen. Nach solchen Zeichen emotionaler Ergriffenheit hielten die Missionare Ausschau. Das war der Beweis, dass Christus in das Herz des Wilden eingekehrt war und dass er bereit war, getauft zu werden. Am Ende eines längeren Reifeprozesses durften die Indianer schließlich am Abendmahl teilnehmen und wurden als vollwertige Mitglieder in die Gemeinde aufgenommen. In Bethlehem, wo auch einige der Konvertiten lebten, hatten die Indianer den gleichen Status wie die deutschen Brüder und Schwestern. Sie wohnten in den gleichen Häusern und Räumen, bekleideten Ämter und wurden auf dem Friedhof der Gemeinde begraben. Einige Missionare haben sogar Indianerinnen geheiratet.
Loskiels Buch brachte die Delawaren ins Bewusstsein eines großen Lesepublikums. Vieles, was später in Deutschland zu den Charakteristiken des Indianers gezählt wurde, stammt aus den Berichten der Herrnhuter. Hiernach sind die Indianer, auch wenn sie vorher sehr wild und unbeherrscht waren, meist sehr ergriffen von Gottes Wort und von der christlichen Botschaft der Versöhnung. Sie seien bildungsfähig und fügsam. Sie hätten Gemüt und sie lieben Musik. Wenn Karl Mays Winnetou beschloss, ein Christ zu werden, nachdem er ein Kirchenlied gehört hat, das Old Shatterhand komponiert hatte, so folgte er der Herrnhuter Tradition. Bei den Pietisten spielten in der Tat das Singen von Hymnen und die Musik, die sich so vortrefflich dazu eignete, das Herz zu ergreifen, eine wichtige Rolle.
Des Weiteren führt Loskiel in unzähligen Anekdoten vor, wie aufrichtig, ja geradezu kindlich naiv die Indianer an das Wort Gottes glaubten. Er gibt Gespräche meist in direkter Rede wieder. Dabei klingt das, was die Indianer sagen, oft wie eine Weisheit aus Kindermund: einfach, unverstellt und offen. Es kommt direkt von Herzen. Die Delawaren sind bei Loskiel voller Gottvertrauen, und beschämen damit die gebildeten Europäer. Den Pietisten, die gegen Zweifel und Zynismus ankämpften, war das ein Ideal. Der naive Wilde wurde so zum Sinnbild für einen sittlichen Menschen. David Zeisberger, der als Missionar 60 Jahre unter den Delawaren lebte und auf dessen Aufzeichnungen Loskiel sich stützte, behauptete, dass sie gar nicht in der Lage seien, zu lügen oder zu betrügen. Ihre Sprache erlaube das nicht, da sie so präzise sei. Wo im Deutschen viele Umstandsbeschreibungen nötig seien, um einen Sachverhalt auszudrücken, komme der Indianer mit einem Wort aus. Die Delawaren hätten zum Beispiel ein Dutzend Wörter für den Begriff des Fischens, je nachdem, ob sie angeln, Fische mit einem Speer oder einer Harpune erlegen oder mit einem Netz fangen wollten. Wenn der Indianer etwas sagt, dann nur, wenn es wichtig ist, nicht etwa um sich über Nichtigkeiten auszutauschen. Auch das begegnet den Lesern späterer Indianerromane wieder.
Vor allem aber zeigte Loskiel, dass die Indianer ein besonders inniges Verhältnis zu den deutschen Missionaren hatten und zwar deshalb, weil die Herrnhuter wirklich vorlebten, was sie predigten. Auch sie waren Exilanten in der Fremde und wurden wegen ihrer pazifistischen Haltung und ihrer fundamental-christlichen Lebensweise von anderen Amerikanern angefeindet. In den Missionsdörfern teilten sie ihren Alltag mit den Indianern: Sie gingen mit auf's Feld, unterrichteten die Kinder, hielten Gottesdienste ab und besorgten den eigenen Haushalt. Meist lebten sie kaum besser als die Indianer.
Der Versuch, die christianisierten Indianer vor den schlechten Einflüssen „der Welt“ zu schützen und sie zu isolieren, erregte allerdings den Argwohn der Siedler, die in der Nähe der Missionsdörfer lebten und die am Land der Indianer interessiert waren. So kam es immer wieder zu tätlichen Übergriffen. Im Jahre 1750 mussten die Herrnhuter Indianer zum ersten Mal ihre Siedlungen aufgeben und weiter westwärts neu aufbauen. Was nun folgte, war eine lange Geschichte von Vertreibung, Neuanfang und erneuter Vertreibung, die Loskiel detailliert beschreibt. Den Schutz, den sich die Indianer von den Herrnhutern vermutlich erhofft hatten, konnten diese ihnen letztlich nicht geben. Obwohl sie versuchten, sich aus den Konflikten des Pontiac Krieges und später des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges herauszuhalten, wurden die christlichen Delawaren, die in den USA Moravian Indians genannt werden, immer wieder Opfer von militärischen Aktionen, aber auch von Angriffen feindlicher Indianer. Einer der traurigen Höhepunkte ihrer Verfolgung war das Gnadenhütten-Massaker. Am 7. März 1782 ermordete eine pennsylvanische Militäreinheit im Missionsort Gnadenhütten am Sandusky Fluss in Ohio auf brutale Weise 96 Männer, Frauen und Kinder. Die Delawaren hatten sich freiwillig entwaffnen und gefangen nehmen lassen, in dem guten Glauben, in Sicherheit gebracht und nach Pittsburgh eskortiert zu werden. Nach Loskiel seien sie klaglos und zuversichtlich in den Tod gegangen, mit der Gewissheit, schon bald ihrem Schöpfer gegenüberzutreten.
Die Herrnhuter Mission in Amerika hatte so ihre Märtyrer. Die deutschen Missionare begleiteten ihre „Indianergeschwister“ weiter auf ihrem langen Leidensweg, der sie in den folgenden Jahrzehnten von Ohio und Indiana bis nach Kanada und schließlich zurück nach Ohio führte, und der letztlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Reservation in Kansas endete. Wahrscheinlich liegt hier der Anfang der Legende von der besonderen, innigen Beziehung zwischen Deutschen und Indianern, die darauf beruht, dass sie ein vermeintlich ähnliches Schicksal verbindet.