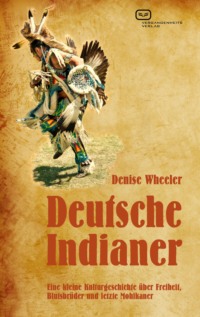Kitabı oku: «Deutsche Indianer», sayfa 2
Edle oder arme Wilde? Gedanken über das Leben des Indianers im Naturzustand
Der edle Wilde ist eine Erfindung französischer Aufklärer. Im 18. Jahrhundert diente diese Figur vor allem dazu, gegen die absolutistische Herrschaft von Sonnenkönig Louis XIV. und Louis XV. zu protestieren und dennoch der Zensur zu entgehen. Den Anfang machte 1702 das Buch eines verarmten Landadligen, des Baron de Lahontan, mit dem Titel Reisen durch das mitternächtliche Amerika. Lahontan hatte gute Gründe, mit dem Absolutismus ins Gericht zu gehen. Nach dem frühen Tod seines Vaters hatte die französische Krone die Baronie seiner Familie wegen Erbstreitigkeiten und Überschuldung eingezogen. Somit mittellos, war Lahontan in die Armee eingetreten und mit 17 Jahren als Kolonialoffizier nach Neufrankreich gekommen. Fast zwei Jahrzehnte lang hielt er sich in Kanada auf, befehligte ein Fort in der Wildnis, unternahm ausgedehnte Jagdexpeditionen, beteiligte sich an Kriegszügen gegen die Irokesen und lernte ein paar Indianersprachen. Dann überwarf er sich mit seinem Vorgesetzten und desertierte. Die restlichen Jahre seines Lebens zog er von einem europäischen Fürstenhof zum nächsten und versuchte, die Rückgabe seines Familienbesitzes zu erstreiten. In dieser Zeit verfasste er sein Buch, dessen dritter Teil Gespräche mit einem Wilden zu einer der am meisten gelesenen Geheimschriften der Aufklärung wurde.
Hier streitet ein Häuptling der Huronen namens Adario mit dem Autor darüber, wer glücklicher ist: die Wilden in Amerika oder die Zivilisierten in Frankreich. Dem Leser wird schnell klar, dass Adario die besseren Argumente hat. Er plädiert für ein selbstbestimmtes Leben in der Natur. Das sei viel vernünftiger als das Leben im zivilisierten Frankreich, wo die Menschen unfrei sind und sich vor der Obrigkeit erniedrigen müssten. Die europäische Zivilisation ist für Adario eine unbegreifliche Verirrung und Entartung. Das Christentum, sagt er, erziehe die Menschen zu Vorurteilen. Die Monarchie stelle die gottgewollte Gleichheit aller Menschen in Frage. Und die Justiz sei von Willkür und Korruption gekennzeichnet. Die Ursache für die schädlichen Leidenschaften wie Habgier und Neid und den daraus resultierenden Verbrechen sei das Privateigentum. Und deshalb, forderte Adario, gehöre es abgeschafft. Und Adel, Klerus und Händler dann gleich mit. Als Gegenmodell schlägt er eine Art primitiven Kommunismus vor: eine Gütergemeinschaft ohne Privateigentum, ohne soziale Hierarchie und ohne Arbeitsteilung, in der es brüderliche Hilfe aber keine Abhängigkeit gibt. Nur so könne man ein glückliches, weil selbstbestimmtes Leben führen. Geld, Macht und Abhängigkeit hingegen würden den Charakter verderben. Der edle Wilde ist ein sittlicher Mensch, weil er den Gesetzen der Natur folgt, und die sind nach Gottes Plan geordnet und vernünftig.
Lahontans Attacken auf das Ancient Regime waren immens populär. Über zwanzig Editionen seines Buches wurden zwischen 1703 und 1741 herausgegeben, auf Französisch, Holländisch, Englisch und Deutsch. Kein Thema wurde im 18. Jahrhundert so heftig, leidenschaftlich und oft diskutiert wie das angeblich glückliche Leben der Wilden.
Dass der edle Wilde in Frankreich ausgerechnet ein Hurone war, hat eine lange Vorgeschichte. So versuchten seit dem 17. Jahrhundert die Jesuiten die Huronen zu missionieren und schrieben in den Berichten an ihre Geldgeber in Rom und Paris viel Gutes über sie. Die Huronen schienen der christlichen Botschaft gegenüber aufgeschlossener zu sein als die wilden Irokesen, bei denen die Missionierung keine nennenswerten Fortschritte machte. Die Huronen erinnerten die Jesuiten, die in der Regel eine klassische Bildung genossen hatten, an antike Verhältnisse.7 Sie verglichen ihre Staatsform gern mit der frühen Kaiserzeit des Augustus. Die Huronen, so hieß es, bewegten sich mit der Gelassenheit und der Würde römischer Senatoren und die Reden, die sie bei ihren Beratungen hielten, standen den Reden Ciceros in nichts nach. Sie waren gastfreundlich und hielten sich gewissenhaft an einmal getroffene Abmachungen und an geschlossene Verträge. Obwohl es auch gewichtige Gegenstimmen gab, wie die des Jesuitenpaters Francois Lafitau, der 1724 versuchte, die von Lahontan aufgestellten Behauptungen über die Wilden in Amerikas Wäldern Punkt für Punkt zu widerlegen, so blieb der Hurone über ein Jahrhundert lang das Synonym für den edlen Wilden.
Der bekannteste Hurone der deutschen Literatur findet sich in Gottfried Seumes Gedicht Der Wilde aus dem Jahr 1793. Es beginnt mit den Worten: „Ein Kanadier, der noch Europens/ Übertünchte Höflichkeit nicht kannte,/ Und ein Herz, wie Gott es ihm gegeben,/ Von Kultur noch frey, im Busen fühlte“.8 Seumes Hurone kehrt eines Tages vom Markt zurück, wo er seine Jagdbeute verkauft hat, und wird von einem Unwetter überrascht. Er bittet am Haus eines weißen Pflanzers um Obdach, doch der herzlose Mann jagt ihn weg. Kurz darauf verirrt sich der Pflanzer auf der Jagd im Wald und findet schließlich die Hütte des Indianers. Dieser vergilt jedoch nicht Gleiches mit Gleichem, sondern er nimmt den Weißen als Gast für eine Nacht auf und bewirtet ihn reichlich. Am nächsten Morgen führt er ihn auf den rechten Weg zurück und gibt sich am Schluss zu erkennen: „Ruhig lächelnd sagte der Hurone:/ Seht, ihr fremden, klugen, weißen Leute/ Seht, wir Wilden sind doch beßre Menschen!/ Und schlug sich seitwärts in die Büsche“.9 Solch edle Indianer tauchen auch in Anekdoten als Vorbilder für tugendhaftes Verhalten in deutschen Familienzeitschriften wie Die Gartenlaube noch bis in die 1860er-Jahre auf.
In Deutschland war der edle Wilde längst nicht so populär wie in Frankreich. Hier war man mehrheitlich der Ansicht, dass der Wilde gefährlich und grausam lebe und eher Mitleid verdiene als Bewunderung. Diese Ansicht äußerte zum Beispiel Friedrich Schiller 1789 in seiner Antrittsvorlesung als Professor für Universalgeschichte an der Universität Jena. Die Wilden, so erklärte er, kennen weder Eisen noch Pflug. Sie hätten keine Ehegesetze, kein Eigentumsrecht und kein Bewusstsein für Tradition. Vor allem hätten sie keinen Sinn für das Höhere und Schöne. Überall bei den Randvölkern der Erde gebe es Krieg, Sklaverei, Dummheit und Aberglauben. Es sei geradezu die Pflicht der Zivilisierten, also der Europäer, die „armen Wilden“, die sich gewissermaßen noch auf der Kindheitsstufe der Menschheitsentwicklung befänden, zu sich hinaufzuziehen und sie auf ihrem Weg in die Zivilisation zu geleiten.10
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts konnte man leicht mit dem edlen Wilden argumentieren, denn er war ja nur eine Figur in einem philosophischen Disput gewesen. Über das wirkliche Leben der Eingeborenen wusste man nur sehr wenig und man interessierte sich auch nicht sonderlich dafür. Nun aber, im Rahmen der schnell voranschreitenden „Vermessung der Welt“, kamen mehr und mehr Reiseberichte auf den Markt, die den Leser mit handfesten Informationen versorgten. Und diese wiederum schienen die Ansicht Schillers zu stützen. 1789, im Jahr der Französischen Revolution, in dem Schiller seine Antrittsvorlesung gehalten hatte, erschien neben Loskiels Buch über die Delawaren auch die deutsche Übersetzung eines Berichtes, den der Amerikaner Jonathan Carver verfasst hatte. Er trug den Titel Reisen durch die inneren Gegenden von Nord-Amerika in den Jahren 1766, 1767 und 1768. Carver stammte aus Massachusetts und hatte in den Franzosen- und Indianerkriegen, wie der Siebenjährige Krieg in Amerika hieß, in der britischen Armee gekämpft. Drei Jahre nach Kriegsende nahm er als Kartenzeichner an einer Expedition teil, um die Regionen am Oberen Missouri und am Lake Superior zu erkunden, die Frankreich an das siegreiche England abtreten musste. Dort traf er auf Ojibwa-, Winnebago-, Sauk- und Fox-Indianer. Mit den Dakota verbrachte Carver fünf Monate im Winter 1767, während er darauf wartete, dass die Flüsse wieder auftauten und er weiterreisen konnte. Die Franzosen nannten die Dakota Naudowessioux, wovon sich die kürzere Bezeichnung Sioux ableitet. Carver beschrieb ihr Äußeres, ihre Lebensweise und ihre Kultur.
Sein Bericht, den er zehn Jahre nach seiner Reise in London verfasste, und in den Texte anderer Autoren, unter anderem von Lahontan, eingeflossen sind, war in den nächsten hundert Jahren eines der am meisten gelesenen Bücher über die amerikanische Wildnis. Im Literaturolymp Weimar ging das Büchlein von Hand zu Hand. Herder und Goethe haben es gelesen und Friedrich Schiller wurde 1797 durch einen darin enthaltenen Totengesang zu seinem Gedicht Nadowessische Totenklage angeregt, das Zeilen wie diese enthält: „Legt ihm unters Haupt die Beile,/Die er tapfer schwang,/ Auch des Bären fette Keule,/ Denn der Weg ist lang;/ Auch das Messer scharf geschliffen,/ das vom Feindesschopf/ Rasch, mit drei geschickten Griffen/ Schälte Haut und Schopf.“11 Richtig populär wurde Carvers Bericht allerdings erst in der Verarbeitung durch den Aufklärungspädagogen und Kinderbuchautor Joachim Campe, der ihn 1807 als vierten Band seiner Sammlung interessanter und durchgängig zweckmäßig abgefaßter Reisebeschreibungen für die Jugend herausgegeben hat. Dieses Buch wurde in viele europäische Sprachen übersetzt.
Was Campe an den Indianern gut fand, war ihre körperliche Fitness, ihre Gesundheit und ihre scharfen Sinnesorgane. Das unterschied sie in seinen Augen wohltuend von der degenerierten Stadtjugend Europas: „Sie haben gute Zähne und ihr Atem ist so rein als die Luft, die sie einathmen, beides eine Folge ihrer natürlichen und simplen Lebensart.“12 Ihren mangelnden Sinn für Schönheit konnte man daran erkennen, wie sie sich selbst verunstalteten. Sie rissen sich die Haare bis auf eine Skalplocke aus, durchlöcherten sich Ohren und Nase und bemalten ihre Gesichter auf eine groteske Weise. Die Indianer hätten keinen Begriff von der Menschenwürde, sondern tauschten billig erzeugten Tand wie Messer und Feuerahlen gegen Sklaven ein. Auch die Frauen behandelten sie nicht gut. Vor allem aber ärgerte die Aufklärungspädagogen, mit welchem Starrsinn sie ihrem Aberglauben anhingen und wie leicht verführbar sie zu sein schienen. Die Aufklärer waren felsenfest davon überzeugt, dass die Medizinmänner bei den Indianern ihre Klientel mit billigen Taschenspielertricks und Schauspielereien bewusst hinters Licht führten. An den Vorteil oder überhaupt die Realität einer Gesellschaft ohne Hierarchien, wie sie den Indianern nachgesagt wurde, glaubte Campe ohnehin nicht. Er selbst bevorzugte eine Monarchie mit einem aufgeklärten König an der Spitze.
Ebenso widerspüchliche Ansichten über die Indianer vertrat die Schriftstellerin Sophie La Roche in ihrem 1798 veröffentlichten Roman Erscheinungen am See Oneida. Darin geht es um Carl und Emilie Wattines, ein Ehepaar aus den besten gesellschaftlichen Kreisen Frankreichs, das vor der Französischen Revolution in die amerikanische Wildnis flieht und dort auf sich allein gestellt vier Jahre lang in Robinson-Crusoe-Manier lebt. Sie tun das recht erfolgreich, einmal weil sie erfinderisch und fleißig sind und zum anderen, weil sie zivilisatorisches Wissen in Form einer kleinen Bibliothek mit in die Wildnis genommen haben. Dort können sie nachlesen und sich Hilfe holen. Emilie wird schließlich schwanger. Kurz vor der Geburt des Kindes schwimmen die Wattines von ihrer Insel im See Oneida hinüber ans andere Ufer. Sie suchen Hilfe bei einer Gruppe von Irokesen, die dort lagern, und von denen sie hoffen, dass sie Emilie bei der Geburt beistehen können. Die Irokesen sind in der Tat gastfreundliche edle Wilde. Sie gehören zur Familie eines Obristen, der als Offizier während der Amerikanischen Revolution für die Kolonisten gekämpft, sich dann aber in seinem Wigwam zur Ruhe gesetzt hatte. Im Gespräch mit Carl Wattines gibt der Irokese folgende Begründung für seinen Entschluss, der Zivilisation den Rücken zu kehren und wieder als Indianer zu leben:
„O, ich habe lange genug bey den Weißen gelebt, um überzeugt zu seyn, daß sie, nicht die Menschen im Walde, Wilde genannt werden sollten. Haben wir Gefängnisse und Prozesse? Sind wir nicht frei wie die Vögel, und sie Sclaven wie Hunde? Haben wir so viele Leidenschaften, Laster, Krankheiten und Kummer als sie? Nein, wir ehren das Alter und sie verachten es. Ihre brennenden Wasser machen uns oft toll, aber ich und die Meinigen sagen: das Land, wo der Tag anfängt, ist ein böses Land, die Sonne geht nur vorbey, es ist nicht so gut wie das Unsere, wo sie zur Ruhe geht. Hört ihr! ein Jesuit sagte mir in meiner Jugend, daß unser Leben zu leer sey. Ich weiß jetzo, daß der Europäer ihres zu voll ist; daß ein böser Geist sie treibt und ihnen keine Ruhe läßt, bis sie sterben.“13
Das ist eine Kurzfassung der Idee vom glücklichen Leben im Naturzustand, wie sie schon Adario in Lahontans Buch vertreten hat und wie sie bis ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder aufleben wird, zum Beispiel bei dem Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung.14
Die Irokesen in La Roches Roman zeigen, wie das von edlen Wilden zu erwarten ist, ihr Mitgefühl mit den Franzosen und bedauern zutiefst deren Schicksal, ja sie vergießen sogar Tränen. So erlebt zumindest Carl die Indianer. Seiner Frau Emilie hingegen fällt vor allem auf, wie reizlos, farblos, unbequem und schmutzig alles bei den Indianern ist. Welch ein Unterschied zu der Idylle, die sich die Wattines auf ihrer Insel geschaffen haben. Sie haben ein hübsches Häuschen, um das Emilie ein Mosaik aus Muscheln gelegt hat. In ihrem Garten gibt es Gemüse, Obstbäume und Blumenrabatten. Sie haben Wege angelegt und Gedenktafeln aufgestellt, die sie an geliebte Freunde und Verwandte erinnern. Von Bänken aus kann man die Aussicht auf den See genießen. Das alles scheinen die Indianer nicht zu kennen. Wie schon Campe und Schiller festgestellt hatten: Den Wilden fehlt der Sinn für das Erhabene und das Schöne. Gerade das aber mache das Leben doch erst lebenswert, meint Emilie. Das Schlimmste, was einem passieren kann, sagt sie im Gespräch mit dem Erzähler des Romans, sei, kulturell auf die Stufe des Indianers herabzusinken, lieber würde sie sterben. „Going native“ ist zu dieser Zeit völlig undenkbar.
Wie man hingegen aus den armen Wilden nützliche und zufriedene Zivilisierte macht, das schilderte das beliebteste Kinderbuch des 19. Jahrhunderts: Robinson der Jüngere. Verfasst hat es wiederum Joachim Campe. Es ist eine Adaption des Romans Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Erstmals 1779 erschienen, fehlte es in den folgenden 100 Jahren in keinem bürgerlichen Haushalt. Dieses Buch nährte die Idee, dass die Deutschen, die in Wirklichkeit keinen Anteil an der Kolonialisierung der Welt hatten, diese Aufgabe besser gelöst hätten als die Kolonialmächte England und Spanien. Sie wären nicht mit Feuer und Schwert gegen die Eingeborenen vorgegangen, sondern hätten ihnen vor allem Erziehung und Bildung angedeihen lassen.
Bei Campe ist Robinson ein Hamburger Kaufmannssohn, der aus purer Leichtsinnigkeit sein Elternhaus verlässt und schließlich als Schiffbrüchiger auf einer Insel in der Karibik endet. Im Gegensatz zu Defoes Robinson kann er nichts von dem Schiffswrack retten, sondern er muss sich nur auf seine Erfindungsgabe und sein Geschick verlassen. Alles, was er zum Leben braucht, muss er selbst herstellen. Ihm steht nur zur Verfügung, was die Natur der Insel bietet. Im Zeitraffer durchläuft Robinson die Stadien der Menschheitsentwicklung vom Sammler und Jäger hin zum Landwirt und Viehzüchter. Auf diese Weise wird auch dem Leser bewiesen, dass Robinson dem Wilden, den er dann trifft und den er Freitag nennt, auf natürliche Weise überlegen ist.
Weil Robinson sich nach menschlicher Gesellschaft sehnt, beginnt er, den Kariben zu zivilisieren und ihn nach seinem Bild zu formen. Er bringt Freitag zunächst bei, sich zu kleiden, zu arbeiten und Deutsch zu sprechen. Am Ende bekehrt er ihn zum Christentum und beginnt mit seiner moralischen Erziehung. Robinson ist kein typischer Kolonisator. Er übernimmt die Erziehung Freitags nicht etwa aus Eigennutz oder um sich zu bereichern. Das einzige, was er gewinnt und von der Insel mit nach Hause nimmt, ist einen guten Freund und einen reichen Schatz an Erfahrungen. Freitag ist am Ende so assimiliert, dass er mit Robinson nach Hamburg zieht, wo ihn niemand als Rothaut wahrnimmt. Beide treten in das Handelshaus von Robinsons Vater ein und betreiben nebenher eine Tischlerwerkstatt, weil sie so gern mit ihren Händen arbeiten – anstatt Profit aus dem Handel zu ziehen. Robinson heiratet nicht und gründet auch keine Familie. Mit Freitag lebt er in „Frieden, Gesundheit und nützlicher Geschäftigkeit“, wie es bei Campe heißt, bis ins hohe Alter zusammen. In Deutschland kannte fast jedes Kind die Geschichte dieser platonischen Männerfreundschaft zwischen dem Deutschen und seinem sanften Indianerfreund. Eine Idee, die einhundert Jahre später mit der Freundschaft und der Blutsbrüderschaft zwischen Old Shatterhand und Winnetou noch zu viel größerer Popularität kommen sollte.

Der letzte Mohikaner. Coopers Roman und die Folgen
In einer der spannendsten Szenen des Romans Der letzte der Mohikaner von James Fenimore Cooper steht Unkas als Gefangener der Delawaren am Marterpfahl und soll verbrannt werden. Ein junger Delaware springt auf ihn zu, reißt ihm das Jagdhemd vom Leib und erstarrt in ungläubigem Erstaunen. Was er sieht, ist eine Tätowierung auf Unkas Brust: eine blaue Schildkröte, das Hoheitszeichen der Delawaren. Immer mehr Krieger umringen nun den Gefangenen und begreifen, dass sie gerade ihren König gefunden haben, den letzten Vertreter ihres Herrschergeschlechts. Sie binden ihn los. Unkas tritt schließlich mit großer Geste vor die Männer und richtet ein paar Worte an sie: „Männer der Lenni Lenapes! Mein Geschlecht trägt die Erde! Euer schwacher Stamm ruht auf meiner Schale. […] Mein Geschlecht ist der Stamm von Völkern“.15 Das bedeutet: Mit den Mohikanern, dem Herrschergeschlecht der Delawaren, steht und fällt das ganze Volk der Delawaren, ja die ganze indianische Nation. Der uralte Tamenund kann sich an Unkas Vorfahren erinnern und bestätigt die edle Abkunft des jungen Kriegers.
Den historischen Hintergrund für seinen Roman, der während der Franzosen- und Indianerkriege in den 1760ern-Jahren spielt, entnahm Cooper dem 1819 erschienenen Buch eines Herrnhuter Missionars namens John Ernestus Heckewelder, der 40 Jahre lang unter den Delawaren gelebt hatte.16 Er beschrieb sie deshalb sehr positiv, während er die Feinde der Delawaren, die Irokesen, die bei ihm Mingos heißen, verteufelt. Diesem Muster folgte Cooper. Bei Heckewelder fand er auch die Namen für seine Indianerfiguren Unkas und Chingachgook.
Die Delawaren, so ist bei Cooper zu lesen, waren einst ein zahlreiches und mächtiges Volk mit vielen Verbündeten. Ihre Feinde, die Irokesen, konnten sie im Kampf nicht besiegen und griffen deshalb zu einer List: Sie überredeten die Delawaren, als Friedensstifter zwischen den verfeindeten Stämmen des Ostens zu dienen. Dafür mussten sie sich verpflichten, ihre Waffen niederzulegen und sich von anderen schützen zu lassen. Metaphorisch gesprochen, sollten die Delawaren die Rolle einer Frau annehmen, die selbst nicht wehrfähig ist, die aber den Streit zwischen den „Männern” schlichtet. Die Delawaren erklärten sich einverstanden und schworen, nicht mehr zu kämpfen. Schon Gottfried Herder, der die Geschichte aus Loskiels Beschreibung der Herrnhuter Mission kannte, lobte diese Institution der Völkerverständigung in seinen Briefen zur Beförderung der Humanität. Der Abschnitt ist betitelt „Zum Ewigen Frieden. Eine irokesische Anstalt“.17 Nach Herder waren die Europäer daran schuld, dass dieses Vorgehen zum Scheitern verurteilt war, denn die Irokesen drückten den Delawaren wieder das Kriegsbeil in die Hand, damit sie sich an der Abwehr der fremden Eroberer beteiligen. Bei Cooper hingegen stachelten die hinterhältigen Irokesen die anderen Stämme dazu an, die Delawaren zu überfallen. Auf diese Weise führten sie deren Untergang herbei. Die Delawaren werden also Opfer eines Verrats. Moralisch aber sind sie ihren Feinden überlegen, denn sie halten sich an einen einmal gegebenen Schwur und wehren sich nicht. Für einen Moment gibt Unkas den Delawaren die Hoffnung, dass sich ihr Schicksal noch einmal wenden könnte, dass sie unter diesem wiedergefundenen König zu neuer Größe erwachen könnten. Aber wie wir wissen, wird Unkas nur wenige Stunden später von dem Übeltäter Magua getötet. Sein Tod besiegelt den Untergang der Delawaren. Übrig bleibt nur sein Vater Chingachgook. Er ist der letzte Mohikaner.
In Der letzte der Mohikaner geht es also um den Untergang eines Volkes, einer Rasse, einer Nation. Das waren Begriffe, die damals noch austauschbar waren. Dieser Untergang ist zwar tragisch, aber unvermeidlich, denn die Delawaren sind bei Cooper Helden eines längst vergangenen heroischen Zeitalters. Sie passen nicht in die moderne Zeit. Sie müssen der neuen Ära weichen, wie die alten Römer oder die alten Kelten einer neuen Ära weichen mussten. Das wissen sie selbst auch, weshalb sie sich nicht wehren, sondern ihr Schicksal mit Würde tragen. Nur ab und zu erscheint um ihre Augen ein Zug von Melancholie. Sie reden auch wie die Heroen aus den antiken Epen in einer bildhaften archaischen Sprache voller Allegorien und Metaphern, mit großer Ernsthaftigkeit und viel Pathos. Wie Chingachgook, der am Grabe seines Sohnes Folgendes spricht:
„Warum trauern meine Brüder? […] Warum weinen meine Töchter? Weil ein Jüngling zu den glückseligen Jagdgefilden dahingegangen ist? Weil ein Häuptling seine Laufbahn mit Ehren vollendet hat? Er war gut. Er war gehorsam. Er war tapfer. Wer kann das leugnen? Manitu bedurfte eines solchen Kriegers, darum rief er ihn zu sich. Ich, der Sohn und der Vater von Unkas, ich bin nur eine verdorrte Fichte auf einer Lichtung des Waldes, die von dem Feuer der Bleichgesichter zerstört wurde. Mein Stamm hat die Ufer des Salzsees und die Berge der Delawaren verlassen. Aber wer kann sagen, die Schlange seines Stammes habe seine Klugheit vergessen? Ich bin allein ...“.18
Das Motiv des einsamen Sängers, der seinen Sohn überlebt und der den Untergang seines Volkes beweint, kannten die damaligen Leser schon durch den Ossian. Das war ein angeblich spätantikes Epos aus Schottland, das 1760 entdeckt und in ganz Europa mit großer Begeisterung als Zeugnis der heidnischen Frühzeit gelesen, übersetzt und nachgeahmt worden war. Goethe zum Beispiel ließ seinen Werther den Ossian rezitieren, bevor er sich am Ende eine Kugel durch den Kopf schießt. Diese Untergangsstimmung bei Cooper, die Melancholie und die Trauer über das Vergängliche, traf den Nerv der Zeit. Auch in Deutschland beschworen die Romantiker alte, bessere Zeiten. Sie schwärmten vom Mittelalter und konvertierten zum Katholizismus. Man hatte das Gefühl, einer Zeitenwende beizuwohnen und ein Unbehagen vor dem Neuen, vor der Industrialisierung und der modernen Massengesellschaft machte sich breit. Das Altbewährte, das Konstante und das Unvergängliche wie Volk, Natur und Religion wurden hochgehalten und besungen.
Die Leser in Europa hielten Coopers Schilderungen des Lebens in der amerikanischen Wildnis für realistisch. Sein Erfolg war unerhört, was auch damit zu tun hatte, dass er ein geschickter Geschäftsmann war. Um den Absatz seiner Bücher zu fördern, zog Cooper 1826, dem Erscheinungsjahr von Der letzte der Mohikaner, mit seiner Familie von New York nach Paris, wo er bis 1833 blieb. Hier verkehrte er in den besten gesellschaftlichen Kreisen und den exklusivsten literarischen Zirkeln. Die Franzosen hatten eine sentimentale Beziehung zu Amerika und besonders zu den Indianern in ihrer ehemaligen Kolonie Louisiana, die sie 1803 an die USA verkauft hatten. Ihr Interesse an Indianergeschichten war groß. Aber auch in Deutschland wurden die Lederstrumpferzählungen mit Begeisterung aufgenommen. Cooper ließ seine Bücher in den USA und in England gleichzeitig und kurze Zeit später in Übersetzungen in den anderen europäischen Ländern erscheinen. Auf diese Weise konnte er unautorisierte Übersetzungen und den Druck von Raubkopien verhindern, an denen er nichts verdiente. Dieses Vorgehen kreierte jedoch auch eine Art „Cooperwelle“, die über ganz Europa hinwegrollte, und die wiederum die Nachfrage an seinen Büchern in den einzelnen Ländern erhöhte.
Dreißig deutsche Verlage wetteiferten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts darum, Coopers Werke zu verlegen. Ab 1850 wurden die Lederstrumpferzählungen für Jugendliche bearbeitet, indem man viele der langatmigen philosophischen Dialoge und ausführlichen Naturbeschreibungen herausstrich. Teilweise wurden die Texte dadurch auf die Hälfte gekürzt. Seitdem gehören Coopers Bücher zum festen Bestandteil der Kinder-und Jugendliteratur. Cooper machte seine Leser mit Worten wie Wigwam, Tomahawk, Squaw und Manitu vertraut. Er prägte Sprachbilder wie Feuerwasser und Bleichgesichter, die aus der deutschen Sprache nicht mehr wegzudenken sind. Und egal, welchem Stamm seine Indianer auch angehörten, sie beendeten ihre Reden immer mit einem bekräftigenden „Hugh” (Ich habe gesprochen).
In den 1820er-Jahren, als die ersten Bände der Lederstrumpferzählungen erschienen, begann in den USA die Regierung unter Präsident Andrew Jackson, die Indianer aus den östlichen Territorien hinter den Mississippi zu vertreiben. Sie wurden im Indianerterritorium, das ungefähr dem heutigen Bundesstaat Oklahoma entspricht, angesiedelt. Reisende, die zufällig Zeugen dieser Vertreibung wurden, waren entsetzt. Auch deutsche Zeitungen berichteten darüber. Und viele Zeitungsleser fragten sich: Wie konnte man nur solch edle Geschöpfe, wie Cooper sie beschrieben hatte, so grausam behandeln? Insbesondere, da es sich bei den Vertriebenen nicht um wirkliche Wilde handelte, sondern um die sogenannten „fünf zivilisierten Stämme“, die Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muskogee (oder Creek) und Seminolen, die auf ihrem Territorium eine Regierung mit Senat und Repräsentantenhaus, Schulen, Gerichte und Zeitungen hatten und von denen nicht wenige als Plantagenbesitzer wirtschaftlich erfolgreich waren.
Einige romantische Dichter entdeckten mit Cooper den Untergang des Indianers als ein literarisches Thema. So schrieb Adelbert von Chamisso 1833 das Gedicht Rede des alten Kriegers Bunte-Schlange im Rate der Creek Indianer.19 Seine Quelle war ein Artikel in der Berliner Zeitung, die ihn wiederum aus einer amerikanischen Zeitung übernommen hatte. In seiner Rede an den Rat erinnert Bunte-Schlange an die Geschichte der Verträge, die General Jackson mit ihnen geschlossen hatte. Als Jackson das erste Mal zu ihnen kam, sei er ein unbedeutender Soldat gewesen. Die Creek hätten die Friedenspfeife mit ihm geraucht, ihn an ihrem Feuer empfangen und ihm Land zum Jagen gegeben. Sie hätten Jackson geholfen, seine Feinde, die Briten und Spanier, zu besiegen. Im Gegenzug hätte Jackson seine „roten Kinder“ geliebt und für sie gesorgt. Nun aber, da er ein großer Mann (nämlich Präsident der USA) geworden sei, befürchte er, dass die Creek unter seinen Füßen zertrampelt werden könnten und befiehlt ihnen deshalb, auf das westliche Ufer des Mississippi überzusetzen. Dreimal mussten die Creek schon westwärts ziehen, und obwohl Jackson ihnen versprochen habe, dass das neue Land ihr eigenes sein würde, brach er immer wieder sein Wort. Bunte-Schlange endet seine Rede nicht mit einem Ruf zu den Waffen, sondern er verfällt resigniert in Schweigen.
Nikolaus Lenaus Gedicht Der Indianerzug von 1832 beschreibt den Pfad der Tränen, und beginnt mit den Worten: „Wehklage hallt am Susquehannaufer,/ Der Wandrer fühlt sie tief sein Herz durchschneiden; Wer sind die lauten, wildbewegten Rufer?/ Indianer sinds, die von der Heimat scheiden.“20 Eine Prozession von Indianern überquert hier bei Cooperstown, dem Wohnort Coopers, den Susquehanna Fluss, um in Richtung Westen zu ziehen. Unter Tränen nehmen die Indianer Abschied von den Gräbern ihrer Vorfahren und von ihren angestammten Jagdgründen, die schon bald von den Weißen unter den Pflug genommen werden sollen. Ein letztes Mal noch ehren sie ihre Toten, bevor sie in den Sonnenuntergang schreiten, der ein kraftvolles Symbol ihres eigenen Unterganges ist. Noch während sie auf dem Marsch sind, sehen sie, wie die Weißen den Wald abbrennen, um Felder anzulegen. Nichts wird bleiben von der Heimat der Indianer.
Die fortschreitende Industrialisierung, die Lenau auf einer mehrmonatigen Amerikareise 1832 sah, bereitete ihm Unbehagen. Die Amerikaner, schrieb er an die Freunde daheim, seien „himmelan stinkende Krämerseelen. Tod für alles geistige Leben, maustodt“.21 Ihnen gehe es nur ums Geld. Sie kennen keinen Wein und keine Nachtigall, was heißen sollte, dass ihnen der Sinn für Schönheit und Muße fehlt. Die Kehrseite der romantischen Liebe zum roten Mann, der aus seinem paradiesischen Dasein in den Wäldern vertrieben wurde, war die Ablehnung der Moderne, wie die USA sie verkörperte.
Im Gegensatz dazu hatten die Deutschen, die nach Amerika auswanderten, in der Regel eine völlig unromantische, pragmatische Sicht auf die Indianer. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts emigrierten Deutsche jährlich zu Hunderttausenden in die USA. Sie ließen sich nicht mehr nur in Pennsylvania nieder, sondern auch im sogenannten „German belt”, der sich über Ohio nach Wisconsin und Minnesota im Norden und nach Missouri und Arkansas im Süden erstreckte. Jeder hier konnte sein Herr auf der eigenen Scholle sein, versprach die üppig blühende Ratgeberliteratur, wenn er sich nur genügend anstrengte. Hier war man frei. Frei von Despoten, von Armut und von Steuern. Die Auswanderer wollten in erster Linie wissen, ob sie auf ihren Farmen vor Überfällen sicher sein konnten. Sie waren froh, keinem Indianer begegnen zu müssen.
Charles Sealsfield (ein Pseudonym für Karl Postl) schrieb 1833 so etwas wie den ersten deutschsprachigen Western, ein Buch mit dem Titel Der Legitime und die Republikaner. Der Legitime ist in diesem Roman ein Indianerhäuptling vom Stamm der Creek namens Tokeah. Die Republikaner sind die Siedler an der Indianergrenze in Georgia, wo der Roman spielt. Als „Legitime“ bezeichnete man während des Wiener Kongresses 1815 Adlige, die legitime Besitzansprüche anmelden konnten und die nun ihre unter der Napoleonischen Herrschaft enteigneten Länder und ihre Privilegien zurückerstattet bekamen. Sealsfield, ein ehemaliger Mönch aus Prag, der wegen seiner republikanischen Ansichten nach Amerika geflohen war, setzt hier also die Indianerhäuptlinge mit den Despoten in Europa gleich. Beide haben in seinen Augen keine Daseinsberechtigung mehr, sondern werden früher oder später einer demokratisch legitimerten Republik freier Bürger weichen müssen. Und so macht Andrew Jackson im Roman nach der Schlacht bei New Orleans 1815 gegen die Briten in einer Rede an die Indianer klar, was sie von der zukünftigen amerikanischen Republik zu erwarten haben:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.