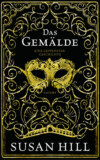Kitabı oku: «Die alte Wassermühle»
Diana Menschig
Die alte Wassermühle
Ein Schauerroman nach alter Art
Gatsby
Gewidmet
den guten Geistern
Prolog ~ Jetzt ~
Ist es vorbei?
Ich bekomme allmählich kalte Füße, weil das taufeuchte Gras meine Hausschuhe durchnässt. Es kann nicht mehr lange dauern, bis jenseits des Waldrandes die Sonne aufgeht. Fröstelnd ziehe ich meine Strickjacke enger. Bald wird es Herbst sein, schon jetzt ist es nicht mehr die richtige Jahreszeit, um im Morgengrauen an einem Bachlauf im Wald herumzustehen. Aber es sind besondere Umstände.
Mein Mann Gregor ist bei mir, doch die Nähe seines Körpers wärmt mich nicht. In seinem Blick spiegeln sich die gleichen Gedanken, die auch in meinem Kopf kreisen. Die verzweifelte Weigerung, die Geschehnisse als real anzunehmen, weil unser Verstand etwas anderes verlangt. Dieses Gefühl, einer Macht ausgeliefert zu sein, die sich rationalen Betrachtungen entzieht, die Befürchtung, dem Wahnsinn näher zu sein als dem klaren Denken. All das, was in den letzten drei Nächten passiert ist, hat nichts mit unserem normalen Leben zu tun, nichts mit Logik, nichts mit Wissenschaft oder Naturgesetzen. Im Gegenteil, es ist wider die Natur. Und dennoch müssen wir uns irgendwie mit dem Geschehenen abfinden.
Ich betrachte das Mühlrad. Es dreht sich, angetrieben vom Fließen des Bachs, stetig, beständig. So, wie es sein sollte, so, wie es seit Hunderten von Jahren gewesen ist. Nichts deutet darauf hin, dass mit diesem Ort etwas nicht stimmt. Der Bach gluckert an der kurzen Seite des Hauptgebäudes der Mühle und dem gemauerten Becken mit dem Mühlrad entlang, schlägt einen sanften Bogen, fließt unter dem Steg des Zufahrtsweges hindurch und verschwindet zwischen den dichter werdenden Bäumen, um sich viele Kilometer später mit einem größeren Wasserlauf zu vereinen, bis er irgendwann im Meer endet.
Es wirkt friedlich.
»Ist es vorbei?« Gregor spricht laut aus, was wir beide denken. Er legt den Arm um mich und zieht mich an sich. »Was meinst du, haben wir alles richtig gemacht?«
Ich zucke mit den Schultern, lasse meinen Blick schweifen, suche nach einer möglichen Bedrohung. Dabei wandern meine Gedanken zurück zu dem Tag, an dem sich unser Traum in einen Albtraum verwandelt hat.
Willkommen im Mühlencafé!
Sie befinden sich im ältesten Teil unserer schönen Mühle am Fichtenbruch. Die Inschrift über dem Türsturz ist auf 1391 datiert, doch die Urkunden des Kreisarchivs erwähnen bereits ein Mühlenrecht im 13. Jahrhundert. Über sechshundert Jahre wurde hier nicht etwa Mehl gemahlen, sondern Raps- und Leinöl gepresst.
Hinter der Theke sehen Sie einen Kollergang: zwei senkrecht stehende Mahlsteine, die mithilfe des Mühlrads über eine dritte Steinplatte gedreht wurden und so das Öl aus den Samen gepresst haben.
Viele Jahrhunderte bewirtschaftete die Familie van de Wiele die Mühle. Ihr Name spielt vermutlich auf das Mühlrad an (Rad = Wiel im Niederländischen). Sämtliche umliegenden Höfe wie der Mühlen-, der Velten-Hof oder das Gut Fichtenbruch haben Flachs und Raps an diese Mühle geliefert. Im 18. Jahrhundert wurde sie verkauft. Es folgten wechselnde Inhaber, bis 1936 ein alleinstehender Mann namens Peter Verhoven die Mühle vom damaligen Besitzer Franz Sips pachtete. Er bewirtschaftete sie kaum ein Jahr, bevor er unter mysteriösen Umständen verschwand. Nach dem Zweiten Weltkrieg war kein Eigentümer mehr zu ermitteln, und die Mühle ging in den Besitz des Kreises über, bis wir sie aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt haben. Nach vielen Monaten intensiver Renovierung freuen wir uns, Sie in unserem Café willkommen zu heißen.
Genießen Sie eine Tasse Kaffee oder einen Latte macchiato, unseren hausgemachten Kuchen oder die leckeren Mühlenkekse. Und falls es etwas später geworden ist, laden wir Sie herzlich ein, die Nacht in einem unserer sieben liebevoll hergerichteten Gästezimmer zu verbringen. Jedes Zimmer ist individuell nach einem Märchen gestaltet. Für besondere Anlässe empfehlen wir die Rumpelstilzchen-Suite. Das leise Plätschern des Mühlrads wird Ihnen garantiert schöne Träume bereiten.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Kornelis
1. Kapitel ~ Freitag – vier Tage zuvor ~
Selbstverständlich werden wir Ihnen mit dem Preis entgegenkommen. Wir können absolut verstehen, dass Ihnen eine gute Nachtruhe wichtig ist. Sind Sie mit einem Rabatt von fünfzig Prozent und einem Zehn-Euro-Gutschein für Ihren nächsten Besuch im Mühlencafé einverstanden?« Inzwischen fiel es mir schwer, einen geschäftlichen Ton anzuschlagen und das Flehen aus meiner Stimme herauszuhalten.
Zu meiner Erleichterung lächelte die grauhaarige Frau versöhnlich. »Ihr russischer Zupfkuchen sucht seinesgleichen, das muss ich Ihnen ja lassen. Also gut, ich bin einverstanden.« Sie hatte das allein entschieden und blickte sich nicht einmal zu ihrem Mann um, der einen halben Meter hinter ihr stand, verlegen mit dem Riemen seines Rucksacks spielte und so tat, als ginge ihn das alles gar nichts an.
Ich rang mir ein Lächeln ab, von dem ich hoffte, dass es dankbar wirkte, verwünschte im Stillen diese empfindlichen Touristen, korrigierte die Rechnung und stellte den Gutschein aus. Währenddessen zog sich die Frau ihre Wanderjacke an, natürlich die gleiche, wie ihr Mann sie trug. Der hatte inzwischen den Rucksack geschultert und mit einem stummen Abschiedsgruß den Empfangsbereich verlassen. Kaum waren die beiden verschwunden, rumpelte es an der Tür. Gregor stieß sie mit dem Ellbogen auf und trat mit einem Armvoll Brennholz ein. Hinter ihm sah ich die Schubkarre, in der weitere Holzscheite lagen.
»I’m a Lumberjack and I’m okay. I sleep all night and I work all day«, dröhnte Gregors freie Interpretation des Monty-Python-Songs durch den Raum und erstarb, als er meine Miene erblickte. »Bianca, was ist los? Alles okay?«
»Hast du die beiden Wanderer gerade gesehen? Das waren unsere letzten Übernachtungsgäste.«
»Wie meinst du das?« Gregor versuchte vergeblich, mit seinen schlammbespritzten Stiefeln den Teppichen auszuweichen. Der Empfangsraum, einst Lagerstätte für die Säcke mit den Leinsamen, war klein und nicht für meinen Mann mit seinen breiten Schultern und den fast ein Meter neunzig gemacht. Wenn er nicht aufpasste, stieß er nahe den Wänden an die Decke, da sie sich dort noch weiter nach unten wölbte.
Ich lehnte mich über den Empfangstresen und vergrub das Gesicht in den Händen. Dabei hatte ich wieder dieses merkwürdige Gefühl. Als würde ich beobachtet werden. Als säße jemand oder etwas hinter mir und genösse mein Elend. Unwillkürlich erschauderte ich, widerstand jedoch dem Impuls, mich umzudrehen. Hinter mir befand sich ein kleines Fenster mit Butzenscheiben, durch das ich den Bach sehen und sogar ganz leises Plätschern hören konnte. Und das Mühlrad, das sich quietschend drehte. Sonst nichts.
Erst kürzlich hatte ich einen Artikel über eine Studie gelesen, in der wissenschaftlich widerlegt wurde, dass eine Person spüren konnte, wenn sie beobachtet wurde – auch wenn Filme und Bücher gerne das Gegenteil behaupteten. Niemand konnte Blicke spüren, das war einfach unmöglich. Dass ich dieses Gefühl in den letzten Wochen wieder und wieder hatte, war einfach zu erklären: Meine Psyche spielte mir Streiche. Ich machte mir eine Menge Gedanken um das Risiko, das wir eingegangen waren, als wir den Plan gefasst hatten, die Mühle zu kaufen und instand zu setzen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wir hatten uns zwar beide sofort in das alte Gemäuer verliebt und von einem Leben hier geträumt, aber ich war die treibende Kraft dabei gewesen, es Wirklichkeit werden zu lassen. Ich hatte Gregor überredet, dass wir beide unsere Jobs aufgeben und uns ganz in das Abenteuer Selbstständigkeit und Gastwirtschaft stürzen sollten. Jetzt sorgte ich mich um das Auskommen unserer Familie, um die Frage, was wir tun sollten, falls wir scheiterten. Was ziemlich wahrscheinlich war, wenn es so weiterging.
Da ich ihm nicht geantwortet hatte, sondern weiter reglos über dem Tresen hing, war Gregor zu dem Ofen an der linken Wand gegangen und hatte sein Holz im Regal daneben gestapelt. Jetzt stand er vor mir, seine kräftigen Arme verschränkt, und starrte auf mich herab. Ich blickte auf und musste wider Willen lachen. Mit diesem uralten blau-rot karierten Hemd, dem Vollbart und seinem wirren Haarschopf sah er wirklich aus wie ein Holzfäller aus einem alten Märchenbuch. Lotte hatte neulich abends beim Vorlesen zu ihrem Vater gesagt, er erinnere sie an Rübezahl. Das hatte Gregor wenig schmeichelhaft gefunden. Vater und Tochter einigten sich schließlich auf den Vater von Hänsel und Gretel, wobei Lotte mir am nächsten Abend anvertraute, dass er mit den buschigen Augenbrauen und der kleinen Narbe auf der linken Wange auch ein Wikingerkönig sein könnte. Mir wurde sehr schnell klar, dass sie sehr wohl mitbedacht hatte, dass es sie zu einer Prinzessin machen würde, wäre ihr Vater ein König. Was mich wunderte. Unsere Tochter war eher ein weiblicher Robin Hood oder die Rote Zora; rosa Tüll oder Puppenkaffeekränzchen konnte sie wenig abgewinnen, erst recht nicht, seitdem wir in der Mühle mitten im Wald lebten. Aber für Wikingerprinzessinnen galten sicherlich wieder andere Regeln, und Lotte ging es vielleicht auch um Segelschiffe und Ponys.
»Was ist nun?« Gregor nahm meine Hände in seine Riesenpranken und rieb sie sanft. Erdbröckchen und Holzfasern krümelten auf das aufgeschlagene Gästebuch, und der Geruch von Wald und Harz stieg mir in die Nase. Ich erinnerte mich wieder. Dafür hatten wir das getan. Diese Mühle gekauft. Über Monate renoviert. Um zu diesen ursprünglichen, einfachen Dingen zurückzukehren: die Natur, der Bach und das Wasser, Holz und Erde. Für uns, unsere Tochter und unsere Gäste. Nur die Sache mit den Gästen wurde allmählich zum Problem.
»Das Paar vorhin wollte eigentlich zwei weitere Nächte bleiben und ist stattdessen heute schon aufgebrochen. Sie haben letzte Nacht kein Auge zugemacht.« Ich schluckte beklommen. »Außerdem kamen per Mail vier Stornierungen für die kommenden Wochenenden. Zwei begründen ihre Absage sogar mit den schlechten Bewertungen im Internet.« Ich zeigte auf den Bildschirm neben mir. »Wir haben 2,4 von 5 Sternen, und das nur, weil Cafébesucher gute Wertungen hinterlassen. Wir können nur hoffen, dass sich das nicht auch auf den Cafébetrieb auswirkt, ansonsten sind wir schneller pleite, als wir Mühlrad sagen können.«
Gregor brummte zustimmend. »Es ist das Mühlrad, ja? Das Quietschen.«
»Es ist verrückt, oder? Weißt du noch, die ersten Tage hat es uns fast wahnsinnig gemacht. Aber inzwischen höre ich es gar nicht mehr, vor allem wenn der Bach viel Wasser führt und rauscht.«
»Tja.« Er zupfte sich am Ohrläppchen, eine typische Geste, wenn er unsicher war. »Geht mir genauso, aber du sagst ja auch immer, dass unter meinen Vorfahren Bären gewesen sein müssen.«
Ich lächelte. Gregor hatte kaum Schwierigkeiten gehabt, sich einzugewöhnen. Wenn er schlief, dann schlief er, da könnte um ihn herum die gesamte Mühle zusammenbrechen.
»Wie viele Gäste haben sich denn bisher beschwert?«, fragte er.
Ich schloss kurz die Augen und fegte mit der Hand den Dreck vom Gästebuch. Dann schlug ich es zu und holte tief Luft. »Alle.«
»Ist das dein Ernst?«
»Ja.« Ich wandte mich dem Monitor zu und öffnete die Buchungsübersicht. »Na ja, ich frage beim Check-out, und niemand war richtig glücklich und zufrieden. Ungefähr die Hälfte hat von sich aus etwas gesagt, davon wiederum habe ich einem Drittel den Preis zumindest teilweise erstattet. So wie diesem Paar eben gerade. Bei denen besteht zumindest die Hoffnung, dass sie uns nicht bewerten werden. Die sind zu alt fürs Internet.«
»Darauf würde ich mich nicht verlassen.« Gregor seufzte leise. »Dann sollten wir das Mühlrad vielleicht doch blockieren.«
Ich strich mir eine blonde Strähne hinters Ohr, die sich aus meinem Zopf gelöst hatte. »Willst du das wirklich wagen?«
»Hast du eine bessere Idee? Erst mal nur für die Nacht. Morgen früh können wir es ja wieder quietschen lassen.«
Ich nickte unsicher. Ich hatte keine bessere Idee, natürlich nicht. Aber der städtische Verwalter, der uns vor dem Kauf der Mühle mit allen relevanten Informationen versorgt hatte, hatte uns eindringlich davor gewarnt, das Mühlrad anzuhalten. Wir hatten beharrlich nachgefragt, doch keine seiner Antworten befriedigte uns. Er hatte etwas von Statik erzählt, von den Schwingungen, die das Gebäude benötigte, um im Gleichgewicht zu bleiben. In meinen Ohren klang das ziemlich esoterisch. Eine Mühle, die ihr Mühlrad braucht, um im Takt zu schwingen? Ich hatte eine Freundin zurate gezogen, die Architektin war. Rebekka hatte nur mit den Schultern gezuckt und sich herausgeredet. An Schwingungen und dergleichen glaubte sie nicht, hatte sie gesagt, doch die Mühle war über sechshundert Jahre alt und stand zweifellos auf weichem Untergrund. Das Waldgebiet um uns herum war vor Urzeiten ein Moor gewesen, jahrhundertelang überall systematisch be- und entwässert worden, um Torf abzubauen. Alte Gebäude und Statik, das wäre ohnehin eine heikle Sache, hatte Rebekka ergänzt, und das Risiko, dass sich irgendein Gebälk verschiebe, wenn das Mühlrad stillstünde, würde sie nicht eingehen wollen. Mit anderen Worten: Gregor und ich könnten machen, was wir wollten, eine Garantie, dass nichts passiere, bekämen wir von ihr nicht.
Wir beließen es zunächst dabei und stürzten uns in die Sanierung. Ein Mühlrad, das sich drehte, war ohnehin besser fürs Geschäft, dachte ich damals, und wer konnte schon sagen, ob uns nicht sogar dieser Stappen von der Denkmalschutzbehörde einen Strich durch die Rechnung machen würde, weil ein stillstehendes Rad weniger authentisch wäre? Die ganzen Auflagen der Behörden machten uns das Leben ohnehin schwer genug.
Gregor war schon an der Tür, als mich wieder dieses Gefühl beschlich, dass mir jemand über die Schulter schaute. Jemand mit ziemlich schlechter Laune. Es fühlte sich an, als würde mir jemand vor lauter Empörung kalten Atem in den Nacken pusten. Mir lief ein Schauder über den Rücken. Hektisch drehte ich mich um, ein Reflex, ich konnte mich gar nicht dagegen wehren. Natürlich war da nichts. Ich stieß einen Laut aus, der irgendwo zwischen Frust und Erleichterung lag.
Gregor war stehen geblieben, die Eingangstür stand halb offen. »Bianca, ist wirklich alles in Ordnung? Du wirkst nervös.«
Ich fuhr wieder herum und blinzelte in den warmen Streifen Sonnenlicht, der durch die Tür schien. »Ja, ich bin nervös. Aber wir kriegen das schon hin.«
»Na klar!«
»Willst du es nicht noch einmal mit Kriechöl versuchen?« Meine Stimme überschlug sich ein wenig, und das machte mich wütend. Ich war sonst wirklich nicht empfindlich. Aber vor meinem Mann musste ich auch nicht die starke Frau markieren. Er wusste schließlich so gut wie ich, um was es hier ging. Die Mühle war unser gemeinsamer Traum, und den wollten wir beide unter keinen Umständen aufgeben.
»Mach ich.« An seinem Tonfall hörte ich, dass er es nur tun würde, um mich zu beruhigen. »Ich glaube aber nicht, dass es dieses Mal helfen wird. Ich habe schon mindestens ein Dutzend Dosen reingesprüht.«
»Ich weiß.«
Ich wollte nicht weiter darüber reden, die Entscheidung war gefallen. Während ich ins Café ging, um unsere Aushilfe Martina abzulösen, trug Gregor das restliche Brennholz herein. Der Anblick des großen Kamins und des Holzstapels daneben ließ mich wieder zu mir kommen. Noch war es zu warm, doch ich freute mich schon auf ein prasselndes Feuer. Die Mauern der Mühle waren alt und dick, die Temperatur in den unteren Räumen das gesamte Jahr über konstant kühl. Darauf schob ich mein inneres Frösteln und die Gänsehaut. Mir ging es im Moment einfach nicht so gut. Das war doch ganz normal, wenn nicht nur ein Lebenstraum, sondern gleich die gesamte wirtschaftliche Existenz der Familie auf dem Spiel stand, oder?
*
Grimmig stemmte ich die Fäuste in die Hüften und schaute mich um. Es war kurz nach zehn, die letzten Frühstücksgäste saßen zufrieden vor ihren vollgekrümelten Tellern und würden gleich zahlen. Jetzt würde es eine gute Stunde ruhig werden, bevor zum Mittag der nächste Schwung kam. Wir hatten nur eine kleine Lunchkarte mit einigen Suppen, warmen Baguettes und natürlich unsere Kuchen.
Martina legte sich ihre Strickjacke über den Arm und hängte sich die Handtasche über die Schulter. »Bist du sicher, dass ich erst um zwei Uhr zurückkommen soll?«
Ich nickte. »Bis dahin schaffe ich es allein. Es sieht nach Regen aus, da werden die Radfahrer ausbleiben.«
»Falls ich doch früher kommen soll, ruf einfach an.«
Ich winkte ihr nach, während sie das Café verließ. Martina Küppers war eine Perle. Eine ehemalige Bauersfrau Ende fünfzig, die sich langweilte, seit ihre Kinder aus dem Haus waren. Den eigenen Betrieb hatten sie und ihr Mann schon vor einigen Jahren aufgegeben, da er zu klein war und sich nicht mehr lohnte. Mit den Pachteinnahmen für ihre Felder kamen sie gut über die Runden, dazu hielt Martina ein paar Dutzend Hühner und baute Gemüse an, das sie bisher nur in der Nachbarschaft verkauft hatte. Kaum dass sie mitbekommen hatte, dass wir die alte Mühle zu neuem Leben erwecken wollten, hatte sie sich gemeldet, resolut und ohne Widerspruch zu dulden mit angepackt, Ideen und Wissen beigesteuert und sich spätestens seit der Eröffnung des Cafés im Frühsommer unentbehrlich gemacht.
»Können wir bezahlen, bitte?« Eine ältere Frau an einem Vierertisch winkte.
»Ich komme!« Ich ging zur Theke und holte das Portemonnaie.
»Warten Sie.«
Ich schrak zusammen, weil die Stimme unmittelbar hinter mir ertönte. Die Frau war mir gefolgt, ohne dass ich es gemerkt hatte. Jetzt hob sie abwehrend die Hände und blickte mich mit zerknirschter Miene an.
»Ich wollte Sie nicht erschrecken, Entschuldigung!«
Ich lächelte tapfer. »Nicht Ihre Schuld, ich war in Gedanken.«
»Wir nehmen noch vier Stücke mit.« Die Frau wies auf die Vitrinen.
Ich nickte, packte den gewünschten Kuchen ein, kassierte und war danach allein im Café. Im Hintergrund lief sanfte Lounge-Musik, die Martina ausgesucht hatte. Ich atmete tief durch und blickte mich um. Sah ich alles zu negativ? Konnten wir ohne Übernachtungen auskommen?
Das Café war ein Juwel. Es befand sich im Mahlraum und dem früheren Wohnhaus. Ursprünglich hatte eine Wand die beiden Räume getrennt, die wir nach langen Diskussionen mit den Denkmalbehörden hatten einreißen dürfen, sodass wir eine L-förmige Fläche zur Verfügung hatten. Das Mahlwerk, im kurzen Ende des L gelegen, hatten wir in seinem ursprünglichen Zustand erhalten, nicht mehr funktionstüchtig, aber wunderschön anzusehen. Der sogenannte Kollergang dominierte die Holzkonstruktion: zwei senkrecht stehende Mühlsteine, die sich von einem Zahnrad angetrieben über eine Platte drehten, auf der in alten Zeiten Lein- und Rapssamen zu Öl gepresst wurden. Das Zahnrad war über zwei weitere Zahnräder mit dem Mühlrad verbunden gewesen, doch die waren nicht mehr erhalten. Über dem Eingang zum Café war die Jahreszahl 1391 in den steinernen Türsturz gemeißelt. Laut Urkunden war die Mühle bis in die späten 1930er-Jahre in Betrieb gewesen, danach hatte ihr Verfall begonnen.
Wir hatten den Kollergang gesäubert und mehrere kleine Regale eingezogen. Rechts und links waren gläserne Kühltheken aufgebaut, in denen wir den Kuchen, Süßspeisen und Getränke präsentierten. Entlang der Wände befanden sich Anrichten mit Herd und Arbeitsplatte, der Siebträgermaschine und meinen beiden Profi-Backöfen. Dazwischen hatten wir alle alten landwirtschaftlichen Geräte ausgestellt, die wir während der Renovierung finden konnten: einige Sensen, eine kaputte Leiter, Holzharken und dergleichen. In großen Weidekörben wurden Eier von Martinas Hühnern und Gemüse aus ihrem Garten angeboten – solange der Vorrat reichte. Die Leute kauften mehr, als sie nachliefern konnte. Auch meine Kuchen gingen an manchen Tagen schneller weg, als ich sie backen konnte. Mein Vater war Konditormeister, und auch wenn ich keine professionelle Ausbildung habe, verstehe ich das Handwerk – solange es keine dreistöckigen Sahnetorten mit Zuckerguss sein müssen.
Die Verkaufstheke stand genau dort, wo früher die Wand zwischen Wohnung und Mahlraum verlaufen war, und trennte die offene Küche vorschriftsmäßig vom Gastraum ab. Daneben befand sich der ehemalige Lagerraum mit Empfang und Büro. Diesen hatten wir auch integrieren wollen, doch dann verwies der von der Behörde beauftragte Statiker darauf, dass es sich um eine tragende Wand handele. Und im Gegensatz zu Rebekkas vagem Ausweichmanöver bei dem Mühlrad stimmte sie in diesem Fall ihrem Kollegen nachdrücklich zu. Anfangs war ich ziemlich sauer, weil wir nun diesen toten Raum mit der niedrigen Decke hatten und weniger Platz fürs Café vorhanden war, aber im Nachhinein erwies sich die Entscheidung sogar als besser. So war der Küchenbereich optisch getrennt und dennoch für die Gäste einsehbar. Die große rechteckige Fläche war zum Sitzen und Genießen, dominiert von dem Kamin im hinteren Drittel, der einst die gute Stube der Müllersfamilie geheizt hatte. Früher müsste es weitere Wände gegeben haben, aber wie die Raumaufteilung in alten Zeiten gewesen war, blieb mir schleierhaft.
Wir wohnten in einem schlichten Backsteingebäude aus dem späten 19. Jahrhundert neben dem älteren Mühlengebäude. Dort hatte auch der letzte Müller, ein alleinstehender Mann namens Peter Verhoven, gelebt, bis er von der Bildfläche verschwunden war. Soweit ich das verstanden hatte, hatte er die Mühle nur gepachtet. Was mit ihm geschehen war, hatte mir bisher niemand sagen können. Ich wollte es unbedingt noch herausfinden, leider fehlte mir die Zeit. Mich interessierten solche alten Geschichten, obwohl am Ende selten etwas Mysteriöses dahintersteckte. Sicher ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg keine Eigentümer mehr zu ermitteln waren und die Mühle in den Besitz des Landkreises überging. Bis Gregor und ich sie entdeckten und beschlossen, sie zu neuem Leben zu erwecken. Und nach einem arbeitsreichen Frühjahr und sehr viel Papierkram hatten wir nun unser erstes Etappenziel erreicht.
Das Café war in freundlichem Gelb gestrichen, entlang der Wände zwischen den Fenstern waren rote Mohnblumen aufgemalt. Dazu helle robuste Kiefernmöbel und eine Loungeecke mit Korbsesseln und blauen Kissen seitlich des Kamins. In den vergangenen vier Wochen hatten wir auf dem breiten Seitenstreifen neben der Zufahrt sogar noch die Freiluftsaison eröffnet. Gegenüber der Mühle war ein Wanderparkplatz, die Wege durch den Wald und das ehemalige Moor begannen hinter dem Bach, über den eine schmale Holzbrücke führte. Wir waren die Endstation für Autos, danach gab es nur noch Fahrräder und Fußgänger. Ich bezweifelte ohnehin, dass der Steg einen modernen SUV aushalten würde.
Das Wetter war traumhaft, unsere Kasse füllte sich. Aber wir waren weit davon entfernt, Rücklagen zu bilden. Unser Wohnhaus musste wärmegedämmt werden, über die Kredite für die Renovierungen wollte ich gar nicht nachdenken. Das Café war es, was ich wollte. Ich war nie scharf darauf gewesen, eine Pension zu betreiben. Aber wir hatten hin und her gerechnet, und ohne die Übernachtungsgäste reichte es nicht. Wir wussten noch nicht, wie das Geschäft im Winter laufen würde, wenn die Leute lieber in ihren eigenen vier Wänden blieben. Ein verregneter Sommer konnte uns das Genick brechen. Wir mussten in den warmen Monaten verdienen, was wir im Winter brauchten, so einfach war das. Die regelmäßige Belegung der Zimmer in der Saison war notwendig. Zwingend erforderlich.
Ein junges Paar mit einem beigen und einem schokobraunen Labrador betrat das Café, schaute sich suchend um und wählte einen Tisch an der langen Wand gegenüber dem Kamin. Gute Wahl, fand ich. Ich füllte einen Wassernapf und ging zu ihnen.
Als ich an den Tisch trat, hatten die beiden Hunde sich bereits hingelegt. Die Frau, vielleicht Mitte zwanzig, zog ihren Anorak aus, während sie sich in alle Richtungen umsah. Ich stellte dem braunen Labrador den Wassernapf vor die Nase, wischte mir die Hand an der Jeans trocken und lächelte unwillkürlich. Ich kannte diesen Blick.
»Ich wusste gar nicht, dass hier in der alten Mühle ein Café ist. Was für ein Traum, wunderschön!«
Ich hätte den nun folgenden Dialog fast wörtlich vorhersagen können, so häufig hatte ich solche und ähnliche Gespräche in den letzten Wochen geführt.
»Das muss eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein!«
Aber das Lob tat dennoch verdammt gut. »Das war es, aber wir hatten auch eine Menge Glück.« Hatten wir. Bis jetzt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.