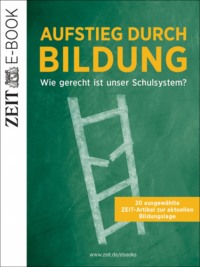Kitabı oku: «Aufstieg durch Bildung?», sayfa 2
Diesen Artikel dürfte es also gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einer großen, angesehenen Zeitung einen Text von einem Arbeiterkind lesen, geht gegen null. Was bedeutet: Bestimmte Erfahrungen und Sichtweisen existieren nicht in den Medien, jedenfalls nicht in bestimmten Medien.
In einem Artikel im SZ-Magazin heißt es: »Ich weiß noch, wie ich erschrocken bin, als ich zum ersten Mal einen Schulfreund besuchte, der mit seinen Eltern in einer 75-Quadratmeter-Mietwohnung lebte.« Der Autor schreibt darüber, wie es ist, ein Jahr lang Mitglied der Linken zu sein. Er ist erstaunt über das unbekannte Milieu, in dem er sich auf einmal bewegt: »In meiner Familie ist keiner arbeitslos, keiner in einer Gewerkschaft, die meisten sind selbstständig, gut situiert, viele Ärzte, ein paar Anwälte.«
Derartige Artikel sind seit einigen Jahren in Mode. Mal wird ein halbes Jahr lang das Internet boykottiert, mal ein ganzes Jahr lang jeden Tag dasselbe Kleid getragen. Eine Freundin, in der DDR aufgewachsen, vermutet, hier versuchten Leute, die nie vor existenziellen Problemen standen, ein wenig Aufregung in ihr Leben zu holen. Sie nennt sie »Vertreter der Milchbrötchen-Generation«.
Meine Mama grübelt derweil darüber nach, wie sie nach bald 50 Jahren Haareschneiden im Alter über die Runden kommt. Noch zwei, drei Jahre will sie in ihrem Salon arbeiten. Zurzeit hat sie einen Rentenanspruch von 734,58 Euro im Monat.
Die Milchbrötchen-Abenteurer gehören zur Oberschicht. Meine Mama steht sozial einige Etagen unter ihnen. Und ich? Ich stehe irgendwo zwischen ihnen und ihr.
Manchmal male ich mir aus, wie es wäre, die beiden Welten zusammenzubringen. Ich stelle mir vor, ich würde eine große Party veranstalten, auf der sich Michael, Textchef der deutschen Ausgabe des Magazins Wired und heute einer meiner besten Freunde, und Rudi, ein Elektromeister aus meinem alten Sportverein, begegneten. Eine Party, auf der meine erste Freundin, die Molkereifachfrau, sich mit den Feuilletonistinnen und Psychologinnen unterhielte, mit denen ich später zusammen war. Eine Party, auf der meine Eltern mit den Herzchirurgen, Journalisten, Professorinnen ins Gespräch kämen, mit deren Kindern ich jetzt befreundet bin. Sie würden miteinander reden, anstatt sich zu ignorieren oder aufeinander herabzuschauen. So stelle ich mir das vor. Und dann schiebe ich den Gedanken wieder weg. Wahrscheinlich wären alle überfordert von so viel Nähe.
Vielleicht wäre auch ich überfordert. Wenn ich ehrlich bin – sind mir die Menschen aus meinem früheren Leben nicht manchmal peinlich? Ist mir meine eigene Familie nicht manchmal fremd? Mein Hund damals hieß Wastl, meine langjährige WG-Katze heute heißt Gretchen. Meine Familie kauft bei Aldi, ich erlaube mir, soweit es geht, Bioprodukte. Es ist nicht so, dass die soziale Kluft sich aufgelöst hätte, bloß weil sie inzwischen mitten durch meine Familie geht. Ich spüre an mir selbst, wie stark das Magnetfeld sozialer Kreise ist. Ich muss zugeben, dass auch ich in Schichten denke. Ich orientiere mich an denen, die mir ähnlich sind. Oder an denen, die ich für ähnlich halte. Vielleicht ist diese Erkenntnis der wichtigste Grund, warum ich glaube, dass die Schule die sozialen Grenzen durchbrechen muss.
Herr Proksch wohnt noch immer in Lauterbach, dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wo er unterrichtete.
Die Tür öffnet sich, er steht vor mir, ich erkenne ihn sofort wieder.
Erster Satz: »Marco, schön, dass du da bist.«
Zweiter Satz: »Sag mal, die ZEIT, wie hast du es denn dorthin geschafft?«
Diese Worte schnüren mir den Hals zu. Wir gehen zu einer Sitzecke, ich sehe Zinnpokale, gestickte Bilder in dunklen Holzrahmen, setze mich auf ein Sofa und sinke so tief ein, dass ich meine, ich säße wieder zusammengesunken auf der Schulbank. Dazu passt, dass Herr Proksch – heute 66 Jahre alt und in Pension – noch immer Du zu mir sagt.
»Wissen Sie, was Sie mir damals empfohlen haben, Herr Proksch?«
»Nein. Ich kann mich nicht erinnern.«
Ich erzähle es ihm. Er sagt: »Da muss ich mich bei dir und deiner Mutter entschuldigen. Ich bin sprachlos, das ist eine schlimme Sache.«
Nach einer kleinen Pause fügt er an: »Eigentlich finde ich es sogar unanständig.«
Diese Worte fühlen sich gut an. Sie erinnern mich an die Reaktion von Frau Bäumler, der Realschuldirektorin, die uns zunächst hinauskomplimentieren wollte. Sie sagte nach unserem Vortrag, man müsse »letztlich« für unsere Arbeit dankbar sein. Sie lächelte sogar, als sie das sagte, obwohl man ihre Zähne dabei fast knirschen hören konnte.
In Herrn Prokschs Wohnzimmer ist es still geworden. Die Wanduhr tickt vor sich hin, und ich frage meinen alten Lehrer, was er davon hält, dass in diesen Wochen überall in Deutschland wieder Variationen des Wortes »Hauptschulempfehlung« auf Zeugnisse gedruckt werden. Welchen Wert haben solche Begriffe, wenn sie manche Schüler auf Jahre hin entmutigen und Begabungen vernichten?
»Marco, das frage ich mich jetzt auch«, sagt Herr Proksch.
Bildungskluft
Die geteilte Straße
Victor und Ercan wohnen in Berlin nur wenige Schritte voneinander entfernt – doch Victor wird einmal studieren, Ercan um eine Ausbildung kämpfen. Wie viele Kinder in Deutschland trennt sie eine fast unüberwindbare Bildungskluft
VON JULIA FRIEDRICHS
DIE ZEIT, 04.07.2013 Nr. 28
Es gibt einen Ort, an dem sie sich dann doch treffen: die Eltern und Kinder von beiden Seiten der Bildungskluft. Im Metrobus der Linie M 41 stehen sie ineinander verkeilt: die poppigen Kinderwagen von Bugaboo, in denen Nepomuk und Mathilda und Nathan sitzen, und die abgenutzten Buggys mit Kindern namens Suad und Yassir und Esraa. Die M 41, ein langer gelber Bus, durchquert Berlin vom Hauptbahnhof über den Potsdamer Platz bis ans Ende Neuköllns. Nach planmäßigen 23 Minuten, auf der Hälfte der Strecke, hält der Bus am Schauplatz dieser Geschichte und entlässt die Kinderwagen auf den Bürgersteig am Rande der vierspurigen Urbanstraße.
Im Film würde man nun in die Vogelperspektive schneiden, und man könnte sehen, wie sich unten in Berlin-Kreuzberg Reich und Arm, Blond und Dunkel, Bugaboos für 800 bis 1000 Euro das Stück und No-Name-Buggys auf sonderbare Weise sortieren.
Die blonden Kinder werden von ihren Eltern in Seitenstraßen geschoben, die nach Norden führen, in Richtung frisch sanierter Altbauten. Als »beste Kreuzberger Lage« preisen die Makler das Viertel an, in dem es eine japanische Galerie gibt, unzählige Babymode-Läden und Quadratmeterpreise, die 40 Prozent über dem Mietspiegel liegen. Hier im »Graefe-Kiez« buchen manche Väter und Mütter Breikochkurse, singen mit ihren Kleinkindern englische Lieder und nutzen die Elternzeit, um die Welt zu bereisen. Viele aber versuchen einfach, ihre Töchter und Söhne gut großzuziehen.
Die No-Name-Buggys biegen in eine Achtziger-Jahre-Siedlung südlich der Urbanstraße ab: viel Beton, 3000 Bewohner, 80 Prozent Einwanderer. 60 Prozent leben mit Unterstützung vom Amt. Manche Familien wohnen zu acht in dreieinhalb Zimmern. Mütter und Väter, die selbst nie richtig lesen und schreiben gelernt haben, schütteln ratlos den Kopf, wenn ihre Kinder ihnen die Hausaufgaben zeigen. Einige der Erwachsenen versumpfen vor Fernsehern, in denen arabische Digitalsender laufen. Viele aber treibt auch hier nur eines an: ihre Töchter und Söhne möglichst gut großzuziehen.
Das Altbauviertel und die Neubausiedlung liegen im Einzugsbereich derselben Grundschule. Doch die Menschen auf beiden Seiten der Straße leben in unterschiedlichen Universen.
Die Urbanstraße ist 33 Meter und 80 Zentimeter breit. Das ist sie: die viel zitierte »Bildungskluft«.
Pisa-Studie, OECD-Bericht, Bildungsbericht der Bundesregierung, die Grundschulstudien Iglu und Timss, die jüngste Erhebung der Bertelsmann-Stiftung – immer und immer wieder wird das deutsche Bildungssystem untersucht, mit unterschiedlichen Methoden und unterschiedlichen Fragestellungen. Die Diagnose ist immer dieselbe: In Deutschland sind die Bildungschancen extrem ungleich verteilt.
Die Schule ist eine Sortiermaschine. Erfolgreich sind vor allem die Kinder, deren Eltern ihnen viel mitgeben können. 15 Prozent der Kinder dagegen gelten als abgehängt, meist die Armen, meist von Anfang an. Jeder siebte Viertklässler kann kaum lesen. Fast jeder Fünfte hat am Ende seiner Pflichtschulzeit nicht mal Basiskenntnisse im Schreiben, Rechnen, Lesen und einer Fremdsprache. Es gebe »einen stabilen Sockel der Abgehängten«, heißt es im Bildungsbericht der Bundesregierung. »Wir produzieren eine homogene Gruppe von Bildungsverlierern«, lautet das Fazit des Autors der Deutschen Jugendstudie.
Das alles ist bekannt – und bleibt doch abstrakt. Als seien es unbeschreibbare Kräfte, die Kinder in Gewinner und Verlierer unterteilten. Aber das ist ja nicht so. Deshalb der Versuch, im Kleinen nach Gründen für diese Unwucht im Großen zu fahnden. Auf beiden Seiten der Urbanstraße. Auf beiden Seiten der Kluft.
Schon bald wird klar, dass es das eine, entscheidende Hindernis nicht gibt. Wer begreifen will, muss sich auf ein Puzzlespiel einlassen.
Die Architekten der Neubausiedlung haben Anfang der achtziger Jahre eine Burg gebaut: Betonblöcke gruppieren sich um einen großen Hof. Zur Straße hin verriegeln Schlagbäume die schmalen Durchfahrten. An beiden Seiten wird die Siedlung von Lebensmitteldiscountern flankiert. Wer will, kann leben, ohne die Burg zu verlassen. Wer von außen schaut, sieht keinen Anlass, sie zu betreten.
Ein regnerischer Dienstagnachmittag. Trotz des Wetters sind Dutzende Kinder in der Siedlung unterwegs. Eine Gruppe Neun- oder Zehnjähriger rennt über den Hof, verschwindet, kommt wieder. Teenager kicken auf dem Bolzplatz. Zwei Mädchen schieben Babys in Buggys umher. Ein Bild, das im Rest des Landes über Jahre Alltag war und heute ungewohnt erscheint: so viele Kinder und kein Erwachsener, der aufpasst.
Schließlich quert doch einer den Hof: Hussein Erim, 49, ein kleiner Mann mit rundem Gesicht. Er hat seine zehnjährigen Drillinge aus der Schule abgeholt. Jetzt bringt er sie zum Nachhilfeunterricht in den türkischen Nachbarschaftsverein.
Wer mit Hussein Erim reden will, braucht einen Dolmetscher. Hussein Erim lebt seit zehn Jahren in Berlin und spricht noch immer kaum Deutsch. Seine Lebensgeschichte ist wie die vieler Menschen in der Siedlung unübersichtlich. Etliche pendeln zwischen der alten Heimat und Deutschland hin und her. Später wird eine Mutter von der anderen Seite der Kluft erzählen, sie fürchte, die Menschen in der Siedlung seien kulturlos, weil sie entwurzelt seien. Deshalb wolle sie ihre Kinder nicht mit Kindern aus der Siedlung auf eine Schule schicken. Es ist eine der Vermutungen, die Menschen übereinander anstellen, die nie miteinander reden.
Hussein Erim lernte seine Frau Selma in der Türkei kennen. Er lebte dort, sie war in Berlin aufgewachsen und zum Urlaub in der Türkei. Sie waren zwanzig und heirateten sofort – gegen den Willen der Eltern. Mit den Jahren bekam das Paar drei Kinder. Sie lebten mit Selma Erim in Deutschland. Hussein Erim blieb in der Türkei. Erst, weil er musste, das Militär zog ihn ein, dann, weil er wollte. Selma blieb lieber in Berlin. Jahrelang führte das Ehepaar eine Fernbeziehung. Erim hatte in der Türkei Arbeit als Gärtner, Selma die Familie in Deutschland. »Eigentlich lief das gut«, übersetzt der Dolmetscher. Dann aber, mit Ende 30, wurden die Erims noch einmal Eltern – von Drillingen. Ein Mädchen, Sevcan, und zwei Jungs: Erkan und Ercan, der sich »Erdschan« ausspricht, als sei er die weichere Version seines Bruders. Wenn der Vater erzählt, ragen einzelne deutsche Worte wie Inseln aus seinem türkischen Redefluss: »Familienzusammenführung«, »Ein-Euro-Job«, »Elternabend«.
Vor der Geburt der Drillinge siedelte Erim nach Berlin über. Ein Mann, der stolz darauf war, dass er mit seiner Gärtnerschere aus einer Hecke einen Frauenkörper formen konnte. Ein Mann, für den es in Deutschland keine Arbeit gab. Als Ein-Euro-Jobber sammelte er Müll und reinigte Parks. Aber das ist vorbei. Seine Frau ist seit Jahren schwer krank. Sie sieht schlecht, hat Diabetes und verlässt die Wohnung nur noch selten. Deshalb ist Hussein Erim nun vor allem Mann und Vater.
Der Übersetzer sagt für ihn: »Ich will die Kinder sicher durch den Alltag führen, ihnen Moral und Respekt beibringen. Ich bin bereit, alles für sie zu tun.«
»Warum können Sie noch immer nicht so gut Deutsch, Herr Erim?« Er erzählt, dass er einen Deutschkurs besuche, aber viel zu oft sei es so wie am Vortag. »Da saß ich da, die Aufgaben vor mir: Ich komme. Ich komme nicht. So habe ich geschrieben. Und da kam ein Anruf: Erkan hat Ärger in der Schule.« Er sei hingefahren. Später habe er sich um seine beiden Enkel gekümmert. »Die Drillinge, die Enkel«, sagt Erim. »Es ist anstrengend. Mein Kopf ist zu voll mit Problemen.«
»Anstrengend« – ein Wort, das man häufig hört. Als Antwort auf die Frage, warum Eltern nicht mit ihren Kindern lesen, warum an den Nachmittagen der Fernseher läuft, warum die Familien so selten den Weg aus der Siedlung finden. Anstrengend – zunächst klingt das nach einer zu einfachen Entschuldigung. Aber schnell wird klar, dass Hussein Erim ernsthaft um seine Drillinge bemüht ist, und man fragt sich: Wie würde man selber das Leben meistern? Verantwortlich für drei große Kinder, drei kleine Kinder, zwei Enkel und eine kranke Frau? Und ohne feste Arbeit?
Eine Woche später, wieder ein Dienstag. Diesmal auf der anderen Seite der Straße, hundert Meter vom Bolzplatz der Siedlung entfernt. Im Seminarraum eines Elterncafés liegen türkisfarbene Yogamatten im Kreis. Sieben Frauen und ein Mann sitzen darauf. Sie schwingen Seidentücher und zählen dazu auf Englisch. Dabei schauen ihnen Kleinkinder zu: begeistert die einen, entsetzt die anderen, fragend die dritten. Little Music Makers heißt der Kurs, musikalische Frühstförderung auf Englisch. 135 Euro für zehn Stunden.
Am Ende der Stunde kippt die Leiterin eine riesige Tasche mit Trommeln, Rasseln und Triangeln aus: ein Berg, auf den die Kleinkinder zuwanken. Das Bild brennt sich ein: Hier gibt es mehr als genug für jedes Kind. Die Nachfrage nach ihren Kursen sei gewaltig, sagt die Leiterin, genau wie in privaten Kinderschwimmbädern, bei Ballettkursen und in der Zirkusschule.
Es ist die Folge eines gesellschaftlichen Großtrends: Akademiker bekommen relativ spät relativ wenige Kinder. Sie sind bereit, für deren Förderung einiges zu tun, einiges zu zahlen. Man ahnt, dass Hussein Erim da nicht mithalten kann.
Katharina von Borcke, eine der Mütter, sitzt nach dem Kurs noch mit ein paar anderen bei einer Waffel zusammen. Die Mütter sind sich einig: Man bleibe hier schon sehr »unter sich«. Beim Babyschwimmen, beim PEKiP-Krabbelkurs, im evangelischen Kindergarten. Katharina von Borcke sagt: »Ich weiß, dass durch vieles, was wir machen, eine Riesenschere zu den ärmeren Familien entsteht. Das ist hart. Aber natürlich ist mein Kind mir am nächsten.«
Ihr Kind heißt Victor und ist fast zwei Jahre alt. Ein dunkelblond gelockter Junge, der gerade um sich tritt. Victor ist müde. Katharina von Borcke ist alleinerziehend; kurz nach der Geburt ging sie wieder arbeiten. Morgens bringt sie Victor in die Kita, dann fährt sie ins Büro, in eine PR-Agentur. Nach der Arbeit holt sie Victor wieder ab, der Abend gehört ihm. Auch das klingt nach einem anstrengenden Leben. Aber Katharina von Borcke hat den Ehrgeiz, ihrem Kind alles zu bieten.
Hussein Erim und Katharina von Borcke haben weder dieselbe Sprache noch dieselbe Heimat oder dieselben Erfahrungen. Dass sie sich fremd sind, verwundert nicht. Weder auf dem Hof der Siedlung noch im Little Music Makers-Kurs werden ihre Kinder sich begegnen. Auch nicht auf einem der beiden Spielplätze des Viertels, denn auf dem einen toben die Kinder aus der Betonburg, auf dem anderen die aus den Altbauten. Diese Teilung wäre in Ordnung, wenn nicht die Chancen auf eine Zukunft ebenso aufgeteilt wären: viele Chancen für die Kinder in den Altbauten, wenige für die in der Betonburg.
Je vielfältiger eine Gesellschaft ist, schreibt der Soziologe Heinz Bude, desto dringender brauchten die Menschen Orte, an denen sie das Zusammenleben übten. Das, sagt Bude, sei die Kernaufgabe der staatlichen Institutionen: der öffentlichen Kindergärten und Schulen. Hier müsste es egal sein, wer auf welcher Seite der Kluft geboren wurde.
Das Fatale ist, dass das Bildungssystem diesen Auftrag nicht erfüllt. Ob ein Kind lesen lernt, hängt laut der Grundschulstudie vor allem von dessen sozialer Herkunft ab. Statt Unterschiede zwischen Kindern auszugleichen, vergrößert das Schulsystem sie. Wie kann das sein?
Die Schule liegt auf der wohlhabenden Seite der Kluft. Jeden Morgen ziehen die Kinder aus der Neubausiedlung in einer Art Prozession zu dem Backsteinbau im »beliebten Gründerzeitviertel«; so steht es auf der Homepage der Grundschule. Es ist unwichtig, wie diese Schule heißt. Denn das, worum es geht, geschieht in fast jeder Schule in fast jeder deutschen Stadt.
Wie in fast allen Bundesländern sind die Grundschulen auch in Berlin Einzugsbezirken zugeteilt. In Kreuzberg hat das Bezirksamt Straße für Straße, Haus für Haus festgelegt, wohin welcher Schüler gehört. Eigentlich sollen die Kinder beiderseits der Urbanstraße an dieser Schule sechs Jahre lang miteinander lernen.
Hussein Erim denkt gerne an seine Schulzeit zurück. Noch heute ist er traurig, dass er nur zwei Jahre lang lernen konnte. Er war schon neun, als er eingeschult wurde, und erst elf, als er anfangen musste zu arbeiten. Die Familie war arm. Eigentlich sei es ein großes Glück, dass sie jetzt hier seien, sagt er. »Ich will, dass meine Kinder viel lernen«, sagt Hussein Erim – beziehungsweise: Der Dolmetscher sagt es für ihn. Und dann, auch wenn man kein Wort versteht, hört man, wie das Gespräch kippt. Erim spricht lauter, wird wütend. Auf wen? »Es ist die Schule. Die Kinder sind unglücklich dort.«
Weil das, was jetzt kommt, ihm offenbar besonders wichtig ist, wechselt Erim ins Deutsche. »Ich frage meine Kinder: ›Die Klasse gut?‹ – ›Nein, Baba‹, sagen sie.« Erim schreit jetzt fast. »Ich frage: ›Die Schule gut?‹ – ›Nein, Baba.‹ Warum? Warum?« Seine Söhne Ercan und Erkan zählen die Tage, die es dauert, bis sie mit der Schule fertig sein werden. Hussein Erim fragt sich: »Wie kann das sein, dass ein Kind die Schule nicht liebt?«
Andere Familien werden diese Klage in etlichen Varianten wiederholen. Sein Sohn sei in der dritten Klasse und habe noch nicht mal alle Buchstaben gelernt, sagt ein Vater. Die Lehrer seien alt und oft krank, ihr Sohn habe in sechs Jahren nicht einen Ausflug gemacht, sagt eine Mutter. Ihr Kind sitze in einer Klasse mit 22 ausschließlich türkischen und arabischen Mitschülern, erzählt eine andere Mutter. Sie fände es schön, wenn wenigstens ein paar Deutsche da wären, »mehr unterhalten, mehr sozialisieren«.
Die Direktorin der Schule lehnt ein Interview ab. Es wird dauern, bis sich der Konrektor und zwei sehr engagierte Lehrer doch zu einem Gespräch bereit erklären.
Ercan Erim aber, Hussein Erims Sohn, möchte reden. »Darf ich?«, fragt er höflich.
Ercan, ein schmaler, blasser Junge mit wachen Augen und einem breiten Lachen, sitzt am Tisch im türkischen Nachbarschaftsverein. Wie so oft trägt er seinen schwarzen Trainingsanzug. Ercan liebt Fußball. Er hat nicht nur eine doppelte Staatsbürgerschaft, er ist auch Doppel-Fan: FC Bayern und Fenerbahçe Istanbul. Für ihn, den Zehnjährigen, ist das mit den zwei Heimaten kein Ding. Ercan versteht schnell. Seine Englischaufgaben hat er längst fertig, nun lässt er seinen Bruder Erkan abschreiben. Erkan ist oft wütend, weil bei ihm alles länger dauert. Vor Kurzem wollte er im Internet googeln, wie man schnell schlau wird. Er hat keine einfachen Antworten gefunden. Ercan hofft, dass sein Bruder mit den geschenkten Englischlösungen zumindest gut durch den nächsten Schultag kommt.
»Ich möchte, dass Erkan glücklich ist«, sagt Ercan. Das ist eine seiner Sorgen. Die andere ist dieser Backsteinbau, in den er jeden Morgen gehen muss.
Ercan sagt: »Ich liebe meine Familie, es ist die beste von allen. Wir basteln, wir malen, wir kriegen aber auch Tadel. Ich überlege, später Sänger zu sein, weil ich Lieder liebe. Ich bin glücklich im Leben. Aber die Schule liebe ich nicht.« Atemlos redet er weiter: »Wenn ich höre, dass einer zu meiner Schule gehen will, sage ich immer: Nein, soll er nicht machen. Wir lernen nicht so viel. Die Hälfte der Klasse macht die Hausaufgaben nicht. Es ist immer laut. Und wenn einer furzt oder schlimme Ausdrücke sagt, macht die Lehrerin nichts. Ich will mehr lernen. Ich freu mich, wenn ich nicht mehr auf dieser Schule bin.«
Der Bildungsforscher Klaus Hurrelmann sagt, dass vor allem Schwache starke Institutionen brauchen. Orte, die ihnen Halt geben. Klare Regeln, feste Zuständigkeiten. »Fehlen diese Strukturen, ist das für die schwachen Schüler eine Katastrophe.«
In Berlin hat man, wie überall im Land, in den vergangenen Jahren eifrig an den Schulen herumreformiert. Die ersten zwei Klassen sind zu einer fusioniert worden. Die Kinder sollen im »jahrgangsübergreifenden Lernen« im eigenen Tempo vorankommen. Die Einschulung ist vorgezogen worden. Viele Berliner Kinder sind an ihrem ersten Schultag gerade mal fünfeinhalb Jahre alt. Wie in den meisten Bundesländern wurde die Schulzeit auf zwölf Jahre verkürzt. Die Kinder sollen früher, schneller, eigenständiger lernen. Inzwischen legen erste Studien nahe, dass schwache Schüler seit den Reformen nicht aufgeholt haben, sondern sogar teilweise weiter zurückgefallen sind.
Nach Wochen gewährt die Schule von Ercan Erim und den anderen Kindern aus der Siedlung doch einen Termin. Es kommen: eine Sportlehrerin, die nichts beschönigt, ein Mathelehrer, der ein großes Herz hat, und der stellvertretende Schulleiter, der entschieden hat, so offen zu sprechen, wie es seine Funktion erlaubt. Die drei machen den Eindruck, dass sie sich bemühen. Das ist, bei den Bedingungen, unter denen sie arbeiten, ein echtes Kompliment.
Ein Schulhof ist wegen Baufälligkeit gesperrt. Auf dem zweiten, der auch bald dichtgemacht werden soll, parken zurzeit die Lastwagen der Arbeiter. Das Foyer ist dunkel und staubig. Die Toiletten in einer Turnhalle sind seit Langem unbenutzbar. Die Schule sei verdreckt, sagen die Lehrer. Sie und die Eltern putzten manchmal selber. Bis vor einigen Jahren hatte die Schule feste und zuverlässige Reinigungskräfte. Aber dann vergab die Stadt die Aufträge neu, um zu sparen. Jetzt putze eine Privatfirma und lasse ihren Leuten sehr viel weniger Zeit. Die Lehrer klagen: Es gibt großen privaten Reichtum, aber öffentliche Armut.
Kann man Kindern unter diesen Umständen die starke Institution geben, die sie brauchen?
Die drei Lehrer erzählen, das Kollegium der Grundschule sei betagt, wie überall in Berlin. Der Altersdurchschnitt der Lehrer in der Stadt liegt bei 50 Jahren, fast 1500 Lehrer sind dauerhaft krank. Im Winter waren an der Schule drei Kollegen langfristig ausgefallen. Hatten dann noch vier, fünf Lehrer die Grippe, brach alles zusammen.
Was das bedeutet, beschreibt der Konrektor so: »Wenn nur so viele Lehrer da sind, dass wir irgendwie alle Kinder betreut bekommen, dann kann man keine Rücksicht darauf nehmen, ob Kinder noch Deutsch als Zweitsprache haben, ob eine Klasse in zwei Gruppen geteilt werden sollte, ob es Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf gibt.«
Inzwischen sind zwei Stellen an der Schule neu besetzt worden. Für den Senat ist die Versorgung damit »ausreichend«. Der Konrektor sieht das anders. Das System funktioniert, wenn niemand krank ist. Und nur dann. Auch eine Pressesprecherin des Senats äußert sich. Sie teilt mit, die Erfahrungen der Kinder aus der Siedlung seien nicht verallgemeinerbar. »Wir haben sehr gute Schulen mit hohem Lmb-Faktor und hohem NdH-Faktor«, sagt sie.
Lmb und ndH sind die amtlichen Maßeinheiten für Berliner Schüler. Lmb – das heißt »lernmittelbefreit«. Es bedeutet, dass die Familien Hefte und Bücher nicht selber zahlen können. Es ist ein Codewort für »arm«. NdH ist auch so ein Codewort und steht für »nichtdeutsche Herkunftssprache«. Die Grundschule hat 80 Prozent Lmb- und 90 Prozent NdH-Kinder.
Wo also sind die Kinder aus den sanierten Altbauten?
Katharina von Borcke, die Mutter des zweijährigen Victor, will nichts dem Zufall überlassen. Sie hat den Bildungsweg ihres Sohnes früh und genau geplant. Dieser Weg wird Victor aus dem Viertel herausführen, weit weg von den Kindern aus der Siedlung. Katharina von Borcke hat eine Kita in Berlin-Mitte ausgesucht, weil es dort auch Englischstunden gibt. Später, so hofft sie, wird Victor eine bilinguale Grundschule besuchen. Victors Vater ist Engländer, und Katharina von Borcke glaubt, dass man Kinder schon früh fördern kann.
Katharina von Borcke kommt aus einem Dorf in Niedersachsen. Sie ist vor 20 Jahren nach Berlin gezogen, weil die Vielfalt der Großstadt sie anzog. Seit sie ein Kind hat, blickt sie anders auf ihre Umgebung. Sie sehnt sich für ihren Sohn nach einem sicheren und überschaubaren Umfeld, das so ist, wie damals ihr Dorf war. »Seit er da ist, falle ich in alte Muster zurück«, sagt sie. Zunächst habe sie sich keine Gedanken darüber gemacht, ob man hier im Viertel ein Kind in die Schule schicken könne. Dann habe sie gelesen, dass die Kinder sich an den Schulen gegenseitig die Handys klauten. Ein befreundeter Rechtsanwalt habe ihr von Strafanzeigen gegen Schüler erzählt, wegen Schlägereien. »Ich weiß nicht, was davon stimmt«, sagt sie. »Aber mir reicht schon ein Restrisiko, um zu entscheiden, dass ich das nicht will.« So abstrakt formuliert, klingt das nachvollziehbar. Konkret heißt es aber: Mein Sohn wird mit einem wie Ercan Erim nie in dieselbe Schule gehen.
An diesem Nachmittag sitzt Ercan im Nachbarschaftstreff der Siedlung über einem Jutebeutel, den er mit Hieroglyphen bedruckt. »Das wird mein Name auf Ägyptisch«, sagt er, »ich liebe Hieroglyphen.« Sein Tischnachbar, ein großer Junge mit kurzem, schwarzen Haar, sagt: »Ich mag die auch und Nofretete, die Königin. Nur Ausmalen ist übelst langweilig.« Wer die Tasche fertig und die Nofretete studiert hat, bekommt ein Zertifikat und darf am nächsten Morgen mit ins Ägyptische Museum. Für die Kinder ist das ein großes Ereignis.
200 000 Euro, gut 60 Euro pro Bewohner und Jahr: Das ist das Budget des Siedlungsmanagements. Teilzeitkräfte und Ehrenamtliche, Praktikanten und Studenten organisieren mit diesem Geld verschiedene Kurse, einen Kindertreff, einen Treff für Jugendliche und das sehr erfolgreiche Lernpatenprojekt, bei dem ehrenamtliche Nachhilfelehrer in die Familien gehen. Rund 50 solcher Patenschaften gibt es. »Mehr schaffen wir nicht. Dabei ist die Nachfrage riesig«, sagt ein Student, der das Patenprogramm betreut.
In der Siedlung gibt es mehr als 1000 Kinder. Seit 2008 spart das Land Berlin bei den Ausgaben für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Je nach Bezirk wird das Budget jährlich um fünf bis acht Prozent gekürzt, das sind vier bis sieben Millionen Euro im Jahr. Aber wenn der Staat sich zurückzieht, entscheidet das Geld der Familien darüber, wer sich welche Förderung leisten kann.
»Wir fahren dann also morgen mit der U-Bahn nach Mitte«, sagt ein Student, der den Ausflug organisiert. »Mitte, ist das wie Ostsee?«, fragt Ercan. Die Ostsee ist sein Sehnsuchtsort. Im Januar 2010 war er mit seinen Geschwistern und seiner Mutter dort zur Kur. »An der Ostsee, das war wie ein Hotel«, sagt Ercan. »Jeden Morgen gab es Cornflakes zum Frühstück. Wir haben da gelebt wie Reiche. Die Ostsee – das ist das Schönste. Aber Morgen: Ägyptisches Museum, da freue ich mich auch. Ich mag das Abenteuer.«
Zwölf Kinder werden am nächsten Tag zu diesem Abenteuer aufbrechen. Auf der U-Bahnfahrt wird klar werden, dass viele ganz selten die Siedlung verlassen. Das sei zu anstrengend, wird Hussein Erim entschuldigend erklären.
In diesen Tagen hängen überall im Viertel Zettel aus. Eine Elterninitiative wirbt um Gleichgesinnte wie Katharina von Borcke. Eine Grundschule in der Nähe, heißt es in den Schreiben, werde bald bilinguale Klassen einrichten. Die Schule sei deshalb nicht an die amtlichen Grenzen gebunden. »No Einzugsbereich!«, heißt es auf dem Zettel.
Der Mathelehrer der Grundschule im Viertel zuckt resigniert mit den Schultern. »Wir wissen, dass viele Eltern versuchen, mit ihrem Kind an eine andere Grundschule zu kommen«, sagt er.
Der Integrationsrat der deutschen Stiftungen hat vor einem halben Jahr 108 Berliner Schulen untersucht. Die Forscher stellten fest, dass etliche Eltern die ihnen zugewiesene Schule meiden, wenn diese einen hohen Ausländeranteil hat. Sie schreiben Bewerbungen an andere Schulen. Sie klagen gegen die Zuweisung. Bei einer Umfrage gaben sechs Prozent der Eltern zu, sich eine Scheinadresse im Bezirk einer anderen Grundschule besorgt zu haben. All das vertieft die Kluft.
Schwache brauchen starke Institutionen. Wenn das gelingen soll, dürfen Schulen nicht nach Marktgesetzen funktionieren. Denn sonst passiert das, was auf der Urbanstraße zu beobachten ist: Wer kann, flüchtet dorthin, wo er ein besseres Angebot vermutet. Zurück bleiben die, deren Eltern nicht nach Alternativen suchen wollen oder können. Zurück bleiben die, die eine hervorragende Schule besonders nötig hätten.
Wer sich weiter umhört, auf beiden Seiten der Kluft, der lernt noch etwas. Einmal entfesselt, funktioniert der Bildungsmarkt wie andere Märkte: Wer die attraktivsten Produkte feilbietet, darf die Regeln bestimmen, nach denen man ins Geschäft kommt.
Die Kita in der Neubausiedlung ist – anders als die Schule – bei den Eltern dort sehr beliebt. Man trifft regelrechte Fans. Frauen mit Kopftuch, die schwärmen, wie wichtig die Kita sei – je früher das Kind sie besuche, desto besser. Ältere Damen, die sagen: »Kindergarten hat uns viel, viel beigebracht. Wir sind sehr dankbar.«