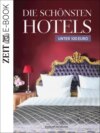Kitabı oku: «Genießen mit gutem Gewissen», sayfa 2
Wochenlang lässt Küchenchef Artur Celuch das Rindfleisch abhängen, dann schmecken die Steaks zart und buttrig. Er findet, dass man nicht täglich Fleisch essen sollte – aber wenn, dann nur allerfeinste Qualität.
»Das Fleisch, das wir anbieten, stammt von Black-Angus-Rindern aus Nebraska. Im Keller des Restaurants haben wir eine Kühlkammer, in der wir die etwa zehn Kilo schweren Stücke Rindfleisch nach der Dry-Aged-Methode vier bis sechs Wochen lang abhängen lassen. Das Verfahren, bei dem die Fleischstücke in einer Art Pilz-Rinde ruhen, wurde im New Yorker Restaurant Wolfgang’s Steakhouse entwickelt. In Deutschland sind wir die Einzigen, die Fleisch auf diese Weise reifen lassen. Das wochenlange Abhängen macht das Fleisch ganz zart und saftig. Das Steak-Menü kostet im Goldfisch für zwei Personen hundert Euro und ist für unsere Gäste etwas Besonderes, niemand leistet sich das jeden Tag. So mit Fleisch umzugehen, finde ich genau richtig: Es sollte ein Genuss sein, den man sich nur manchmal gönnt. Für meine Familie koche ich im Alltag oft Pasta und Gemüse, Fleisch gibt es nicht täglich. Vielleicht zweimal im Monat mache ich zu Hause zum Beispiel ein Schmorgericht, eine Rinderbacke oder eine Kalbshaxe, die vier bis sechs Stunden im Ofen gart. Dazu eine kräftige Soße, so esse ich Fleisch besonders gern.«
Artur Celuch, Küchenchef im Hamburger Restaurant Goldfisch
Worauf man achten sollte
Wichtig ist, auf die Maserung zu achten. »Wenn im Muskelfleisch feine Fettadern gleichmäßig verteilt sind, wird das Steak oder der Braten später saftig«, sagt Artur Celuch, Küchenchef im Restaurant Goldfisch.
Die Farbe verrät, ob das Fleisch frisch ist. Graue oder grün schimmernde Stellen sind ein schlechtes Zeichen. »Leider täuschen hier viele Anbieter die Käufer, zum Beispiel indem sie die Ware mit Infrarotlampen anleuchten«, sagt Celuch. »Diese Lampen sollten einen skeptisch machen, denn sie haben keinen anderen Zweck, als das Fleisch schön rot aussehen zu lassen.«
Beim Braten sollte nur wenig Fleischsaft austreten. »Sonst bedeutet das, dass die Ware gefroren war oder von vornherein mindere Qualität hat«, sagt Celuch.
Fisch: Guter Fang
Fisch essen mit gutem Gewissen – geht das überhaupt noch? Wichtig ist, auf die Arten und die Fangmethoden zu achten und bei Zuchtfischen auf Bio-Aquakultur.
Seit Hauke Neubeckers Kindheit hat sich viel verändert. »Damals war Lachs etwas Besonderes, es gab ihn nur zu Weihnachten«, sagt der Inhaber des Restaurants Jellyfish. »Aber in den vergangenen zwei Jahrzehnten ist er zur Massenware verkommen und in der gehobenen Gastronomie fast verpönt.« Der Besuch einer Aquakultur in Norwegen war ein einschneidendes Erlebnis. Ihn irritierte, dass so viele Fische auf engem Raum gehalten wurden und unnatürliches Trockenfutter aus einem Spender bekamen.
So beschloss Neubecker, in seinem Lokal keinen Fisch aus Aquakultur anzubieten. Lachs etwa kommt nur in seltenen Fällen auf die Karte, und wenn, dann wild gefangener.
Grundsätzlich sind Aquakulturen ein wichtiger Beitrag dazu, wilde Fischbestände zu schonen. Problematisch ist aber die Art der Tierhaltung: Zuchtlachse zum Beispiel leben meist in Netzkäfigen im Meer, wo sie zwischen Artgenossen eingepfercht sind. In konventioneller Aquakultur werden um die 25 Kilogramm Lachs pro Kubikmeter Wasser gehalten, was etwa zwei ausgewachsenen Tieren entspricht.
Ob es dem Lachs gut ging, kann man schmecken: Weiches Fleisch ohne klare Struktur, dafür große Fettablagerungen weisen darauf hin, dass der Fisch schlecht gehalten wurde.
In Bio-Zuchtfarmen haben Lachse etwa doppelt so viel Platz wie in konventionellen. Auch müssen Bio-Farmer darauf achten, dass für das Futter der Zuchttiere nicht extra gefischt wurde, wie es in konventionellen Farmen üblich ist – denn so wird der Ansatz, mit Aquakulturen die Meere zu entlasten, ad absurdum geführt. Fisch aus biologischer Aquakultur kann man also mit besserem Gewissen kaufen.
Trotzdem bietet Küchenchef Ludwig Ernst seinen Gästen nur Fisch an, der wild gelebt hat. Denn der ist sein Leben lang geschwommen und hat viel Muskelfleisch aufgebaut.
Beim Einkauf achtet Ludwig Ernst darauf, wie die Fische gefangen wurden. Die hoch industrialisierte Fischerei mit Schleppnetzen, in denen ganze Schwärme gefangen und sofort verarbeitet werden, lehnt er ab: Es werden dabei viele Tiere versehentlich mitgefangen und weggeworfen oder zu Fischfutter verarbeitet.
Wichtig ist ihm auch, ob die Arten schon überfischt sind. Statt Rotem Thun, der stark bedroht ist, nimmt er lieber Gelbflossenthun, der in vielen Fanggebieten noch in ausreichender Zahl zu finden ist. Ganz konsequent ist er hier allerdings nicht – Schwertfisch ist schon stark überfischt und steht trotzdem auf der Karte.
Eine gewisse Sicherheit, dass die Fischfang-Unternehmen auf umweltverträgliche Fangmethoden geachtet haben und die Bestände schonen, gibt das MSC-Siegel auf Verpackungen. Zwar wird das Label der Organisation Marine Stewardship Council dafür kritisiert, dass die Anforderungen zu gering seien. Umweltschützer bewerten das Gütesiegel dennoch in der Regel als hilfreich.
Wer im Fischgeschäft Lachs auswählt, sollte sich auf ein Kriterium nicht verlassen: die Farbe. Zwar hat Lachs, der wild gelebt hat, oft dunkelrot gefärbtes Fleisch. Die Farbe entsteht, weil sich der Fisch unter anderem von rötlichen Krebsen ernährt. Es gibt aber auch wilden Lachs, der andere Nahrungsquellen hatte und dessen Fleisch deshalb blass aussieht.
Lachs, der in Gefangenschaft gelebt und Pellets aus Fischmehl gefressen hat, entwickelt auf natürliche Weise kein rosiges Fleisch. Damit er in der Packung nicht fahl aussieht, versetzen die Produzenten das Futter oft mit Farbstoffen, meist Carotinoiden.
Leuchtet der Lachs also appetitlich orange, kann das auch ein Trick sein.
»Es soll auch in 20 Jahren noch Fische in den Meeren geben«
Küchenchef Ludwig Ernst serviert nur Fisch, der mit Leinen oder Angeln gefangen wurde. Schleppnetze, mit denen Industriefischer die Meere im großen Stil leeren, lehnt das Restaurant Jellyfish dagegen ab.
»Ich fahre jeden Morgen zu unseren Fischhändlern hier in Hamburg und gehe direkt in die Abteilung für Fische, die mit Leinen geangelt wurden. Bei dieser Fangart gehen von einem Boot etwa 20 Angeln aus. So kann der Fischer in der Bretagne gezielt einen Loup de Mer mit Ködern, die nur diese Fischart gern frisst, fangen. Während in der industriellen Großfischerei viele Tiere aus Versehen in den Netzen landen, ist Beifang bei dieser Methode so gut wie ausgeschlossen. Und der Fisch hat die Qualität, die wir in unserem Restaurant anbieten wollen, in Bezug auf Geschmack und Nachhaltigkeit. Ich serviere zum Beispiel Filets, auf der Haut gebraten, dazu nur einen Salat oder die südamerikanische Spezialität Ceviche, also in Limettensaft gegarte Filetstücke etwa vom Skrei – so esse ich selbst Fisch auch gerne. Natürlich kostet ein Fisch bei uns auch viel mehr als in Lokalen, die ihre Ware von Großfischereien beziehen, deren Fangmethoden den Meeren schaden. Deshalb erklären wir jedem Gast unsere Mission: Es soll auch in zwanzig Jahren noch Fische in den Meeren geben. So bekommen die Gäste bei uns nicht nur ein gutes Essen, sondern auch ein gutes Gefühl.«
Ludwig Ernst, Küchenchef im Restaurant Jellyfish
Worauf man achten sollte
Wenn mehrere Fische exakt gleich groß sind, deutet das darauf hin, dass sie aus einer schlechten Aquakultur stammen, in der die Fische alle exakt gleich viel Futter bekamen, gleich wenig Bewegung hatten und im gleichen Alter geschlachtet wurden.
Klare Augen und kräftig rote Kiemen gehören zu den Kriterien, die zeigen, dass der Fisch frisch ist. Allerdings tricksen manche Anbieter und färben die Kiemen künstlich ein.
Rote Flecken in Filets können Blutergüsse sein. Sie können entstehen, wenn die Fische mit Schleppnetzen gefangen und dabei stark zusammengequetscht werden.
Vegetarismus
Tiere sind auch nur Menschen
Dürfen Menschen Rinder, Schweine und Hühner töten? Eine ethische Rechtfertigung fürs Fleischessen gibt es nicht. Ein Plädoyer für den Vegetarismus.
Von Iris Radisch
Das Wichtigste
Vegetarisch essen kommt in Mode – und ist die einzig moralisch vertretbare Ernährungsform. Alle Argumentationen, die das Fleischessen rechtfertigen sollen, halten einer genauen Betrachtung nicht stand: Weder liegt es in der Natur des Menschen, Tiere zu essen, noch hat er das Recht dazu, weil er ihnen genetisch oder kulturell überlegen wäre. Manche sehen die Lösung darin, den Fleischkonsum einzuschränken, konsequent ist nur totaler Verzicht.
Immer weniger Menschen essen Fleisch. Der Grund: die Belastungen von Umwelt und Gesundheit durch die Massentierhaltung, vor allem aber die Einsicht, dass die Tiere unsere nächsten Verwandten sind.
Die alles entscheidende Frage, dürfen wir Tiere töten, um ihre Leichen zu essen, haben wir seit Ewigkeiten beantwortet. Vielleicht nicht mit dem Kopf, aber doch mit den Zähnen. Der Tieresser steht auf der Siegerseite der Evolution. Er ist der König der Nahrungskette.
Ausgiebiger Fleischgenuss signalisierte lange Zeit Wohlstand, und Wohlstand signalisierte soziale Integration. Je bedeutender der Mensch, desto größer die Fleischportion auf seinem Teller. Vegetarismus hingegen war eine Lebensweise mit dem zweifelhaften Odium einer sektiererhaften Marotte. Sie berief sich zwar gelegentlich auf eine ferne antike Überlieferung (die Orphiker und die Pythagoräer waren Vegetarier), entstand aber eigentlich erst in den Umtrieben der Lebensreformbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts, die ihrerseits eine widerspenstige und anarchische Reaktion auf die Zwänge der beginnenden Industrialisierung war.
Der Vegetarier war ein Sonderling, ein Außenseiter der Gesellschaft. An ihm haftete der Makel, sich einem zentralen Übereinkommen des vernünftigen Zusammenlebens zu widersetzen. Wer nicht wie alle anderen Fleisch aß, war womöglich auch sonst zu nichts Ordentlichem zu gebrauchen. Zahlreich waren die Anekdoten, die das berufliche Missgeschick dieses oder jenes Großonkels auf die in meiner Familie seit Generationen verbreitete Unfähigkeit, Tiere zu essen, zurückführten.
Das alles scheint lange her zu sein und ist doch erst seit Kurzem vorbei. Heute ist der Vegetarismus in jedem Sinn in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Vegetarische Gaststätten gibt es überall in den Innenstadtvierteln, in Berlin hat erst kürzlich die erste vegetarische Mensa eröffnet. Es gibt viele Intellektuelle und Künstler, die sich für den Vegetarismus einsetzen. Und es gibt einen Vegetarismus-Chic in den besseren Kreisen. Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer veröffentlichte im Jahr 2010 ein viel diskutiertes Buch, das uns in schönster Offenheit dazu auffordert, am besten keine und am zweitbesten weniger Tiere zu essen. Alles schön und gut. Bleibt nur noch die Frage, ob wir Tiere überhaupt töten dürfen.
Normalerweise werben die Vegetarier für ihre Lebensart, indem sie den Fleischessern die gesundheitlichen Nachteile ihrer Ernährungsweise mahnend vor Augen halten. Dazu zählen unter anderem Herz- und Krebsleiden und eine mögliche Übertragung von Keimen und Giftstoffen. Das alles ist bedenkenswert. Für die Frage nach unserem Recht, Tiere zu töten, um sie zu essen, sind diese luxuriösen Diskussionen um die möglichen Zuwachsraten unseres ohnehin bereits beträchtlichen leiblichen Wohlergehens aber unerheblich.
Das gilt auch für den noch viel gewichtigeren Trumpf in der Hand der Vegetarier: ihren Hinweis auf die ungeheuere Belastung der Erde durch die Treibhausgasemissionen, die durch die Massentierhaltung entstehen. Nach Messungen des unabhängigen Washingtoner Worldwatch Institute ist die Massentierhaltung nicht nur, wie bisher angenommen, für 18 Prozent, sondern sogar für über 50 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Fleisch essen ist schlimmer als Auto fahren. Von dem unverantwortlichen Wasserverbrauch, der unwirtschaftlichen Vernichtung von Anbaufläche, der Rodung der Wälder zur Vermehrung von Weideflächen noch gar nicht zu reden. Niemand bezweifelt diese für unsere Überlebensaussichten äußerst betrübliche Diagnose. Sie ist ein starkes Argument für eine drastische Senkung des Fleischkonsums. Doch erspart auch sie uns nicht die alles entscheidende Frage, die man auch unseren ökologisch korrekten Urahnen hätte stellen müssen: Wer darf wen töten und warum?
Die Entscheidung ist bereits gefallen. Der Mensch genießt das Recht auf leibliche Unversehrtheit. Das Recht des Tieres, das wir ihm einräumen, besteht demgegenüber darin, vor dem Zerstückelt- und Ausgenommenwerden durch einen Metallbolzen, der ihm den Schädel spaltet, betäubt oder an einem Haken kopfüber aufgehängt durch ein elektrisches Wasserbad gezogen zu werden. Das Ungleichgewicht der Rechte springt ins Auge, wird aber außer von einigen Tierethikern wie Peter Singer, Tom Regans, Helmut F. Kaplan, Ursula Wolf und den unermüdlich, teils auch radikal kämpfenden Tierrechtsorganisationen wie Peta kaum infrage gestellt. Es ist die Grundlage dessen, was wir als Normalität bezeichnen. Aber was, wenn wir uns einfach geirrt haben? Ist es möglich, dass, was seit Jahrtausenden als normal gilt, dennoch ein ungeheueres Unrecht ist?
Ja, es ist möglich. Die Gründe, die wir für das eklatante Ungleichgewicht der Rechte zwischen Mensch und Tier geltend machen, sind allesamt windig. Überdies sind sie widersprüchlicher Natur. Sie stehen sich gegenseitig im Weg, weil sie sich wahlweise auf den tierischen oder auf den göttlichen Ursprung des Menschen berufen. Einerseits, heißt es, töte der Mensch Tiere, weil er – selbst ein Tier – nicht anders kann. Das ist die sogenannte Naturthese: Tiere fressen eben Tiere.
Andererseits behauptet man, gerade die evolutionäre Überlegenheit des Menschen erlaube ihm, das Tier zu töten und mit seinen Leichenteilen Handel zu treiben. Das wäre die Kulturthese: Der Mensch isst Tiere, weil er besser ist als sie. Beide Begründungen hinken und sollten uns nicht ruhig schlafen beziehungsweise essen lassen. Einzig wer meint, dass man Tiere schon allein deswegen töten darf, weil ihre sterblichen Überreste, gut gebraten und gewürzt, gut schmecken, kann sich unbesorgt zu Tisch setzen (und wird betrüblicherweise spätestens an dieser Stelle die Lektüre des Artikels abbrechen).
Welche Entschuldigung haben wir den vier Rindern, 46 Schweinen, vier Schafen, 46 Truthähnen, zwölf Gänsen, 37 Enten und 945 Hühnern, die jeder Fleischesser durchschnittlich in seinem Leben verspeist, für ihren Tod also zu bieten? Betrachten wir zunächst die Naturthese. Fleisch essen gehöre angeblich zur menschlichen Natur. Doch was ist die Natur des Menschen? Vor allem ist sie ein Wort, das, wenn es im Sinn von Ursprünglichkeit oder Gottgegebenheit verwendet wird, jede Diskussion beendet (siehe Natur der Frau, Natur der Schwarzen und so weiter).
Die akademische Debatte darüber, ob der Steinzeitmensch eher ein Pflanzen- oder ein Fleischfresser war, verliert sich schnell im Nachmessen der Darmzotten und des Zungendurchmessers. Die eine Fraktion beruft sich auf die Reißzähne und die Magensäure des Menschen, um ihn den Karnivoren zuzuschlagen. Der anderen gilt als Beweis für sein natürliches Pflanzenfressertum, dass er anders als jedes karnivore Tier Fleisch im rohen Zustand nicht herunterbekommt.
Für die Frage, ob wir dürfen, was wir tun, nämlich morden, um zu essen, spielt dieser Streit um die Ernährungsgewohnheiten des Menschen in der Frühzeit keine Rolle. Denn selbst wenn der Urmensch die Tiere den Blättern vorgezogen hat oder vorziehen musste, ist dies kein Grund, ihm nachzueifern. Seit Jahrtausenden ist der Mensch damit beschäftigt, die rohen Sitten seiner Urahnen zu zähmen und zu kultivieren. Ein Vorgang, den man Zivilisation nennt und der uns immerhin schon so weit gebracht hat, Zeitung zu lesen, zum Mond zu fliegen und von der Unsitte des angeblich besonders schmackhaften Menschenfleischverzehrs abzulassen (es gibt Berichte von bekehrten Wilden, die auf dem Totenbett in Erinnerung an die Menschenfleischgenüsse ihrer Kindheit vor Sehnsucht geweint haben sollen). Warum sollten wir ausgerechnet an der Fleischtheke in der Steinzeit stehen bleiben?
Auch die Mär, dass der Mensch von Natur so eingerichtet sei, dass er sich nur mit Fleisch gesund erhalten kann – noch vor wenigen Jahren häufig in seriösen Publikationen nachzulesen –, ist, abgesehen von kleinen Problemen bei einer dauerhaft veganen Ernährung, reiner Unsinn. Die Ernährungswissenschaft hat inzwischen nichts mehr gegen eine völlig fleischfreie Kost einzuwenden.
Womit das Naturargument an sein verdientes Ende kommt: Tiere essen ist purer Luxus. Nichts als ein paar Sekunden Gaumenkitzel, der einen blutigen Preis hat. Doch selbst die Fleischeslust kann völlig verschwinden. Wer noch nie Fleisch gegessen hat, kennt sie nicht einmal. Sie ist offensichtlich kein dunkler, unbeherrschbarer Naturtrieb, sondern nur eine Gewohnheit unter anderen Gewohnheiten. Eine, die man in der modernen Welt mühelos in wenigen Generationen verlernen könnte.
Bleibt das Kulturargument. Es läuft, vereinfacht gesagt, darauf hinaus, dass der Mensch das Tier essen darf, weil er Verstand und das Tier keinen hat. Der Mensch kann Klavier spielen und Porsche fahren, das Schwein kann sich nur im Sand suhlen. Was also liegt da näher, als es zu essen?
Was für ein Hochmut! Ein paar minimale Unterschiede im genetischen Code sollen uns dazu berechtigen, unsere nahen Verwandten, die Kühe, Schweine, Pferde und Schafe, essen zu dürfen? Das Tier, sagt die im Christentum gepflegte Legende, könne nicht denken und habe keine Seele. Sein »Mangel an Vernunft«, so Kirchenvater Augustinus, bestimme es zum Schlachtvieh, die »gerechte Anordnung des Schöpfers« habe sein »Leben und Sterben unserem Nutzen angepasst«. Im Inneren der Tiere befinde sich, glaubte Descartes, nur eine »Maschine«, im Inneren der Menschen hingegen »eine vernünftige Seele«. Mit solchen und ähnlichen Phrasen geben wir uns bis heute zufrieden, wenn wir festlegen, welches Leben wertvoll und zur Erhaltung und welches wertlos und zur Vernichtung bestimmt ist.
Was die Herren offenbar nicht bedachten: Setzte man sie auf einer Palme im Dschungel aus, wären sie samt ihrer vernünftigen Seele ziemlich ratlos. Denn Tiere, zumindest unsere Verwandten, die Säuge- und Wirbeltiere, sind nur anders schlau als wir. Es wäre »pervers«, so der Harvard-Forscher Steven Pinker, »den Säugetieren das Bewusstsein abzusprechen«. Auch Vögel und andere Wirbeltiere hält er für »beinahe bei Bewusstsein«, nur bei niederen Tieren wie Austern und Spinnen verlieren sich die Gewissheiten in den Abgründen der Schöpfung.
Das Rätsel des tierischen Innenlebens werden wir, eingesperrt in die menschliche Sicht der Dinge, nie ganz lösen, auch wenn wir uns mit dressierten Affen ganz passabel in Zeichensprache unterhalten, mit Pferden flüstern und unserem Hund ohnehin jeden Wunsch von den Augen ablesen können. Tiere leben in einem anderen Universum, die Botschaften, die wir von dort erhalten, können wir nicht alle verstehen. Doch der Respekt vor der fremden Intelligenz muss heute die alte Überheblichkeit ablösen. Was, wenn die Tiere uns für ebenso seelenlos halten wie wir sie, nur weil wir so anders sind? Und was, wenn die Evolution noch eine Ehrenrunde dreht und eine Spezies hervorbringt, die uns für zu dumm hält und deswegen einsperrt und auffrisst? »Eines Tages«, frohlockte der erste Tierrechtler und Philosoph Jeremy Bentham im Jahr 1789, »wird man erkennen, dass die Zahl der Beine, die Behaarung der Haut und das Ende des os sacrum sämtlich unzureichende Gründe sind, ein lebendiges Wesen schutzlos den Launen eines Peinigers auszuliefern.« Der Tag ist gekommen.
Heute weiß man, dass sich der Mensch entgegen den frommen Wünschen der christlichen Philosophen hinsichtlich der Erbinformation nur geringfügig von den anderen Säugetieren unterscheidet. Das Nervensystem, die Verarbeitung von Reizen, Emotionen wie Angst und Panik sowie das Empfinden von Schmerzen sind bei Mensch und Tier identisch. Das komplizierte Paarungsverhalten, das Zusammenleben in Gruppen und Familien, die Fähigkeit, vorzusorgen und zu planen, die Verständigungssysteme der Tiere untereinander weisen sie als unsere nächsten Verwandten aus. Die Unterschiede, die zwischen uns und ihnen bestehen bleiben, sind nur gradueller, aber keineswegs prinzipieller Natur.
In vielem sind Tiere dem Menschen sogar weit überlegen. Der Seh-, Hör- und Tastsinn ist bei den meisten Säugetieren höher entwickelt als bei uns. Vom tierischen Navigationssystem, von den Feinheiten der Brutpflege, der beneidenswerten animalischen Work-Life-Balance, der Schönheit und Eleganz der Bewegung, dem bewundernswert genügsamen Lebensstil der Tiere gar nicht erst zu reden. Kurzum: Es gibt überhaupt keinen Grund, den Menschen Leidensfähigkeit und Lebensrecht zuzusprechen und es den Tieren abzuerkennen.
Auch die sogenannte Kulturthese, nach der wir töten dürfen, weil wir so besonders klug sind, gehört also auf den Friedhof für ausgediente Ideologien. Rechtfertigen sollten sich nicht mehr diejenigen, die keine Tiere essen, sondern diejenigen, die es dennoch tun. Denn abgesehen von den kognitiven Fähigkeiten sind Tiere genauso Menschen wie Menschen umgekehrt Tiere sind. Doch während das Menschliche im Tier in seinen Angstschreien und seiner Todespanik in den Schlachthäusern nur allzu deutlich wird, hat der Mensch das Tier in sich auf seinem zivilisatorischen Siegeszug gezähmt oder ausgerottet. Furchtbares – so eine der zentralen Thesen der Frankfurter Schule – habe die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen, geschaffen war. Etwas von dieser Selbstverstümmelung, behauptete Max Horkheimer, werde in jeder Kindheit wiederholt. Und, genau besehen, auch bei jedem Mittagessen.
Die Verstümmelung und Herabwürdigung der Tiere zur toten Ware, und zwar ausgerechnet solcher Tiere, die uns am ähnlichsten sind (aus welchem anderen Grund sollten wir lieber Schafe und Schweine als Würmer und Käfer essen?), setzt die Gewalt gegen das Tier in uns selbst fort. »Es herrscht nicht nur Krieg zwischen uns und ihnen«, schreibt Jonathan Safran Foer, »sondern zwischen uns und uns.«
Wir haben das Tier in uns vergessen und vergessen das Tier, sobald es auf unserem Teller liegt. Das gehört zur Verhaltensweise der Kälte, der vielleicht zentralsten psychosozialen Technik fortgeschrittener Kulturen. Dennoch dürfte es wenige Fleischesser geben, die unbeeindruckt blieben, wenn sie sich der Unbequemlichkeit aussetzten, etwa einen Film anzusehen, der ihnen zeigt, wie das Fleisch auf ihre Teller kommt (sehr häufig werden Tiere in der industriellen Schlachthausroutine nicht gründlich genug betäubt und schreiend bei lebendigem Leib gehäutet und zerstückelt). Der südafrikanische Literaturnobelpreisträger J. M. Coetzee erinnert in seiner bewegenden Erzählung Das Leben der Tiere an die »gewaltige gemeinschaftliche Anstrengung«, derer es bedarf, um »unsere Herzen vor den Schlachtstätten zu verschließen«.
Gleichwohl kultivieren wir inmitten dieser offensichtlichen Mitleidlosigkeit sonderbare Mitleidsnischen. Niemand möchte seinen eigenen Hund oder sein eigenes Pferd essen, obgleich Hunde und Pferde durchaus gegessen werden. Für unsere Katzen kaufen wir altersgerechtes Katzenfutter und lassen sie beim Tierarzt gegen Diabetes behandeln, während wir Kühe und Hühner, sauber in Cellophan verpackt, in der Tiefkühltruhe aufbewahren. Dabei ist die Artengrenze, die festlegt, welches Tier geliebt und welches gemordet wird, völlig willkürlich und abhängig von den Sitten und Moden.
Wenn wir die Tiere selbst töten müssten, die wir essen, würde der Fleischkonsum, der sich in den letzten 40 Jahren weltweit verdreifacht hat, vermutlich sprunghaft zurückgehen. Doch die Fleischindustrie, die uns das tote Tier, von Blut gesäubert und zur Unkenntlichkeit zerstückelt, ins Haus liefert, betäubt unsere Empathiefähigkeit. Es fällt uns schwer, uns in unsere Opfer hineinzuversetzen, sie uns als lebendige Individuen überhaupt noch vorzustellen. In diese Vorstellungslücke stoßen die Tiere als Haustiere, Filmhelden, Comic- oder Plüschfiguren. Sie sind die einzigen Tiere, die viele Kinder neben den gebratenen Tierresten auf ihrem Teller noch kennenlernen. Doch sie sind nur Dekor, Erinnerungsstücke an die wirkliche Tierwelt, die selbst nicht mehr zu sehen ist. »Der Blick zwischen Tier und Mensch«, schreibt der Schriftsteller John Berger, »mit dem alle Menschen noch bis vor weniger als einem Jahrhundert gelebt haben, wurde ausgelöscht.«
Was folgt nun aus alldem? Für Jonathan Safran Foer folgt daraus, dass wir zumindest die industrielle Massenhaltung der Tiere unbedingt boykottieren sollten. Tiere müssen wieder artgerecht gehalten und sorgfältig, nicht am Fließband, geschlachtet werden. Und weil aber nahezu alle Tiere, die wir essen, aus Massentierhaltung stammen und in Todesfabriken geschlachtet werden, empfiehlt selbst der Wohlfühlvegetarier Foer, auf Fleisch ganz zu verzichten. Und nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf Eier und Fisch, wenn uns das Leben der Legehennen und der sinnlose Tod unzähliger Meerestiere dauert, die für jedes Sushi-Essen als Beifang gestorben sind und wieder ins Meer geworfen werden.
Dem Mitleidsgebot – du darfst die dir verwandten Tiere überhaupt nicht töten, nur weil sie dir schmecken – weicht Foer aus. Er sei, schreibt er, »nicht allgemein dagegen, Tiere zu essen«. Das Glück der Tiere und die Qualität ihres Fleisches liegen ihm mehr am Herzen als ihr Recht auf Leben. Für ihn gibt es, was für mich undenkbar ist: »ethisch unbedenkliches Fleisch«.
So viel Versöhnlichkeit mag die Argumentation dieses eindrücklichen Buches schwächen, aber sie ist nicht unvernünftiger als die Wirklichkeit: 94 Prozent der Deutschen essen gern tote Tiere. Foer agiert wie ein Emissär mit weißer Fahne, der im unversöhnlichen Krieg zwischen der winzigen Minderheit der Tierrechtler und der überwältigenden Mehrheit der Tieresser Frieden stiften will, um das schwerfällige Rad der Geschichte gemeinsam ein wenig zugunsten der Tiere voranzudrehen. Das ist schon viel.
Am Ende wird der Verzicht auf Fleisch allen helfen, den Tieren und den Menschen. Er wird nicht alle Menschheitsprobleme lösen. Er löst noch nicht einmal alle moralischen Probleme, vor die uns unser Hunger stellt. Die Grenzen des Tötungsverbots sind niemals eindeutig zu bestimmen in der unendlichen Kette der Lebewesen. Warum verschone ich die Kuh und töte die Fliege? Ist das Seepferdchen weniger wert als das Pony? Und was ist mit dem Seelenleben der Pflanzen? Der grelle Scheinwerfer der Erkenntnis durchdringt die Materie, doch die meisten Geheimnisse des Lebens bleiben im Dunkeln. Es ist unmöglich, in unserem Zusammenleben mit den Tieren alles richtig zu machen. Doch gibt uns das noch lange nicht das Recht, alles falsch zu machen.
Iris Radisch/Eberhard Rathgeb (Hg.): »Wir haben es satt! Warum Tiere keine Lebensmittel sind.«
Wer darf wen töten und warum? Plädoyers für den Vegetarismus zwischen Empörung und Mitgefühl. Residenz Verlag, 259 Seiten, 19,90 Euro
Lebensreformbewegung: Als Reaktion auf die fortschreitende Industrialisierung entstanden im ausgehenden 19. Jahrhundert verschiedene Bewegungen, die unter dem Begriff »Lebensreform« zusammengefasst werden. Gemeinsam war ihnen, dass sie in der modernen Gesellschaft Zivilisationsschäden befürchteten und die Rückkehr zu einer naturgemäßen Lebensweise forderten. Dazu gehörten die Kneipp- und die FKK-Bewegung, reformpädagogische Vereinigungen und Initiativen gegen das Tragen von Korsetts.
Jonathan Safran Foer: Sein Erstling »Alles ist erleuchtet« machte den damals 25-jährigen Autor 2002 auf Anhieb weltberühmt. Der Roman knüpft an eigene Erlebnisse an und erzählt von einem Amerikaner jüdischer Herkunft, der sich in der Ukraine auf die Suche nach Spuren seiner Vorfahren macht. Sein zweiter Roman, »Extrem laut und unglaublich nah« von 2005, verarbeitet die Ereignisse vom 11. September. Sein jüngstes Werk, »Tree of Codes« aus dem Jahr 2011, ist noch nicht auf Deutsch erschienen.
PETA: Die weltweit größte Tierschutzorganisation People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) wurde 1980 in den USA gegründet und hat nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen Unterstützer weltweit. Sie kämpft, teilweise mit spektakulären Aktionen, etwa gegen Tierversuche, Massentierhaltung, Hunde- und Hahnenkämpfe sowie die Pelzindustrie. Die deutsche Sektion wurde 1994 gegründet und klagt gegenwärtig vor dem Europäischen Gerichtshof, weil ihr der Vergleich der Massentierhaltung mit dem Holocaust untersagt und ihr Antisemitismus unterstellt wurde.
Descartes: René Descartes (1596–1650) war ein französischer Philosoph, Naturwissenschaftler und Mathematiker. Der Begründer des Rationalismus beschäftigte sich unter anderem mit der Dualität zwischen Geist und Materie und formulierte den Satz »Cogito ergo sum – ich denke, also bin ich«. Außerdem erfand er die analytische Geometrie, die in der Physik eine große Rolle spielen sollte. Da er sich auch mit der Existenz Gottes beschäftigte, stellte der Vatikan seine Schriften 1663 auf den Index.
Frankfurter Schule: Die marxistisch inspirierte Frankfurter Schule ging aus dem Institut für Sozialforschung hervor, das 1923 an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt gegründet wurde. Ihr Forum war die Zeitschrift für Sozialforschung, herausgegeben von Institutsleiter Max Horkeimer, in der unter anderem Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und Walter Benjamin schrieben. 1933 wurde das Institut von den Nazis geschlossen und 1951 von Horkheimer und Adorno wiedereröffnet.
Fleischkonsum: Weltweit aß im Jahr 2010 jeder Mensch im Schnitt rund 42 Kilogramm Fleisch. In den Industrieländern waren es 80 Kilogramm pro Kopf, in den Entwicklungsländern nur 31,5 Kilo. Deutschland lag mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 90 Kilogramm weit über dem Durchschnitt. Rund 55 Kilogramm davon entfielen auf Schweinefleisch.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.