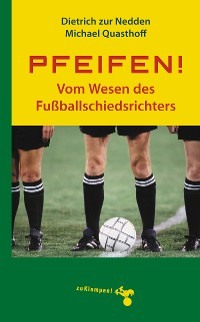Kitabı oku: «Pfeifen!», sayfa 2
Schule der Schiedsrichter
Well, you wonder why I always dress in black
Why you never see bright colors on my back
And why does my appearance seem to have a somber tone
Well, there’s a reason for the things that I have on
Johnny Cash: Man in Black
»Hefte raus! Klassenarbeit!«– Eben nicht. Matthias Kopf schlägt einen sportskameradschaftlichen Ton an, wie es sich geziemt, wenn man im Vortragsraum der Sportschule Barsinghausen versammelt ist. Sportskameraden aus Gifhorn, Leer, Bad Bentheim, Göttingen, aus allen Teilen Niedersachsens, sind angereist, um einen Aufbaulehrgang für Schiedsrichter zu absolvieren. Was ich hier mache? Es nennt sich Recherche. Ein Ausdruck, der auf Thomas Kapielskis Vorschlag hin auf der ersten Silbe zu betonen ist: Wie »Nickerchen« muss man »Recherchen« sprechen. Ausgerüstet bin ich mit Schreibblock und Kugelschreiber, vorbereitet bin ich nicht. Als Kopf mich vorstellt, sage ich die Wahrheit: Ich sammle Eindrücke für ein Buch über Fußball-Schiedsrichter und beeile mich hinzuzufügen, dass die Idee zu dem Buch lange vor der Affäre Hoyzer entstanden ist.
Locker erledigt Kopf, Lehrwart aus dem Bezirk Lüneburg, die notwendigen, selbstredend lästigen Formalitäten, ruft Namen für Namen von der Anmeldeliste auf. Bis auf einen sind alle erschienen.
Ein Aufbaulehrgang ist, wenn ich das richtig verstehe, für jeden Schiedsrichter auf Bezirksebene im Abstand von zwei bis drei Jahren Pflicht. Ein Wochenende muss dafür herhalten. Soweit ist die Ausgangslage sogar für einen Laien wie mich überschaubar. Sobald man die Schulungssystematik des DFB genauer betrachtet, die im übrigen jeder der 21 Landesverbände etwas unterschiedlich gestaltet, gerät der Laie, selbst der recherchierende, in ein Getriebe hinein, das wie ein Paradies für bürokratisch veranlagte Funktionäre wirkt. Ein Paradies der Notwendigkeit? Ja doch, ja, eine Massenorganisation wie das deutsche Schiedsrichterwesen will organisiert sein, es muss alles seine Ordnung haben. Allein in Niedersachsen sind ungefähr 10.000 Schiedsrichter registriert. Sie belegen Anwärterlehrgänge, Jungschiedsrichterlehrgänge, Aufbaulehrgänge A, Aufbaulehrgänge B, Talentlehrgänge, Förderlehrgänge, Leistungslehrgänge oder Spitzenschiedsrichterlehrgänge auf Kreisebene, Bezirksebene oder Verbandsebene. Außerdem veranstaltet der DFB selbst natürlich weitere zahllose Lehrgänge, die er denjenigen angedeihen lässt, die zu Höherem berufen sind.
Zurück zur Basis-Station. Lehrgangsleiter Kopf bittet die Teilnehmer, sich kurz vorzustellen. In dieser Vorstellungsrunde scheint es üblich, wenn nicht obligatorisch zu sein, das ist mein Eindruck, den Pegelstand, die höchste Klasse zu nennen, in der man Spiele leitet oder als Assistent dabei ist.
Bald ist ein juveniles Trio an der Reihe. Die Drei eint der Wille, die Leiter noch ein paar Sprossen emporzusteigen. Hinauf bis zur Regionalliga? Oder noch weiter? »Mal seh’n, was noch kommt!«, sagt einer von ihnen kampfeslustig. Er ist 26. Sein Nachbar sagt: »Ich versuche selber weiterzukommen.« Der dritte ist zwanzig: »Habe Einiges vor. Jetzt wird angegriffen.« Den Kontrast verkörpert der Kollege, der jetzt seine Koordinaten bekannt gibt: »Ich bin 36 Jahre alt, Landesliga, ohne Perspektive, höher zu kommen.« Wehmut schwingt mit, ein Hauch Fatalismus. Drei, vier weitere Teilnehmer beschreiben ihren Status mit ähnlichen Worten. Eine unsichtbare Linie, das meint der sensible Reporterdarsteller hautnah zu spüren, trennt die Anwesenden: in diejenigen, die einer verheißungsvollen Zukunft entgegensehen, und diejenigen, denen die Beförderung versagt bleiben wird. Gleicht man die Spielklasse, in der einer pfeift, mit dem Lebensalter ab, kommt das Ergebnis einem Urteil in letzter Instanz gleich, einer Einzelfalldiagnose, deren Ergebnis so eindeutig ist wie ein 5 : 1 oder ein 0 : 4: Pfeil nach oben oder unten. Du hast noch Chancen aufzusteigen oder hast deinen Zenit erreicht. Der eine im Schatten grämt sich, der nächste nimmt’s gelassen.
Kopf erläutert den Ablauf bis Sonntag. Mit Regel 12 wird man sich näher befassen –»Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen«–, mit den Begriffen »Fingerspitzengefühl« und »Ermessensspielraum«. Später Stehkaffee und danach raus auf den Platz zum Cooper-Test. Im Anschluss ans Abendessen wird Thorsten Schriever erwartet, ein Zweitliga-Schiedsrichter Ende 20, der »von den Leistungen her ganz oben dabei« ist, einer auf dem Sprung, einer, der den Traum von vielen lebt. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum jemand in diesem Moment »Reimann!« ruft. Bis ich erfahre, dass Willi Reimann, seinerzeit Trainer von Eintracht Frankfurt, während eines Bundesligaspiels Schriever, den vierten Unparteiischen, umrempelte. Legendäre Geschichte. »Gelten im bezahlten Fußball andere Spielregeln?« ist das Thema, über das Schriever sprechen wird.
Morgen am Samstag dann der theoretische Test und Fahrt nach Wunstorf, um gemeinsam ein Landesligaspiel zu beobachten. Die Abende werden »bei einer gepflegten Hopfenkaltschale« ausklingen. Und wenn Zeit übrig ist am Sonntag, wird es noch einen »Gesprächskreis zum Thema Gewaltprävention« geben: »Je nach dem, kucken wir mal.«
Über die Maßgaben einer Schiedsrichter-Karriere habe ich im Internet-Archiv der Pinneberger Zeitung gelesen, der man eine prophetische Gabe attestieren muss. Das Blatt antizipierte den Hoyzer-Skandal, als es im Mai 2004 unter der Überschrift »Verdirbt Geld die Schiedsrichter?« ein Interview mit Wilfried Diekert aus Appen druckte, dem Vorsitzenden des Verbands-Schiedsrichter-Ausschusses in Hamburg.
Ob denn der Konkurrenzkampf unter den Schiedsrichtern, fragt der Journalist, »genauso erbarmungslos« sei wie der unter den Fußballern: »Zwischen den ehrgeizigen Jungen, die ganz nach oben wollen, auf jeden Fall«, lautet die Antwort. Ob es stimme, dass »unerfahrene, ehrgeizige Streber bei den Amateuren«, die »an die Fleischtöpfe in den Eliteklassen« wollen, für »immer mehr Zoff und Ärger« sorgten? Das bekomme er in der Tat immer häufiger zu hören, stimmt Diekert zu: »Aber man kann wirklich nicht sagen, das Geld verderbe die Schiedsrichter.«
Nein, das kann man gewiss nicht. Die Verlockung, reich zu werden, wird es nicht sein, wenn jemand sich einreiht in die Phalanx der Gipfelstürmer. Und wenn es allein der unstillbare Ehrgeiz wäre, ganz nach oben zu kommen, dann ist das eine milde Form des Größenwahns. Die Wahrscheinlichkeit, als Unparteiischer die höchsten Weihen zu empfangen sowie pro Einsatz 3069 Euro plus Anfahrt- und Übernachtungskosten, ist nicht gerade überwältigend hoch. Für die meisten bleibt es bei vier Euro (Schülerspiel) bis 150 Euro (Regionalliga).
Rund 75 000 sind in Deutschland Woche für Woche im Einsatz. 20 pfeifen in der Ersten Liga. Um so höher ist der Druck, dem man sich aussetzt, wenn man dorthin gelangen will. Tempo, Tempo, Tempo, so wie sich das Spiel selbst um etliche Grade beschleunigt hat: Mit 17 oder spätestens 18 Jahren müsse einer schon Kreis- und Bezirksligaspiele pfeifen, sagt Dickert. »Mit 20 sollte er dann Landes- und Verbandsligaspiele leiten und mit 23 oder 24 Jahren in die Oberliga aufgerückt sein. Spätestens mit 28 muss man in die Bundesliga aufrücken, sonst hat man keine Chance mehr.«
Von einem Förderlehrgang, passgenau auf diese Klientel zugeschnitten, hat Nicol Ljubic in der Zeit berichtet. Die Vorstellungsrunde der Jungfüchse ist ausführlicher als die, der ich beiwohnte. Die Kandidaten nennen ihren Beruf und antworten auf die Frage »Wo pfeife ich in drei Jahren?«. Die Teilnehmer üben demonstrativ Zurückhaltung. Nicht einmal die Oberliga wird als Ziel reklamiert. »Keiner will arrogant wirken«. Der Kursleiter ist stolz »auf den Charakter der jungen Männer«, auf die »Mischung aus Bescheidenheit und Höflichkeit«. Einem 21-Jährigen, in seinem Kreis zum »Schiedsrichter des Jahres« gewählt, schärft der Kursleiter beiläufig ein: »Geh vernünftig mit der Ehrung um.«
Ob beim Aufbaulehrgang B jemand anwesend ist, der es jemals zum »Schiedsrichter des Jahres« gebracht hat, habe ich mich zu erkundigen versäumt. Wir sind inzwischen bei strahlendem Sonnenschein rausgefahren zum Sportplatz, jeder außer mir hat den Cooper-Test und ein paar Sprints mit Zeitlimit hinter sich gebracht. Das Wetter ist so verführerisch, dass ich während des Ausflugs träge lediglich eine einzige Bemerkung notiere: »Für die Bonbons quält man sich hier«. Tage später erst suche ich wenigstens die Fakten, Fakten, Fakten der Leistungsprüfung heraus. Bei dem nach Aerobic-Guru Dr. Kenneth Cooper benannten Test sind 2700 Meter in 12 Minuten zu laufen, 200 Meter in 32 Sekunden und 50 Meter unter 7 Sekunden zu schaffen.
»Wer langsamer ist, kann seine Sachen packen und, zwei Stunden nachdem er angekommen ist, wieder nach Hause fahren«, werde ich in der Zeit über die Atmosphäre beim Förderlehrgang lesen. So genau, scheint mir, wird es beim Aufbaulehrgang nicht genommen. Auf ein paar Meter oder Sekunden kommt es nicht an. Wer scheitert, darf demnächst nachbessern.
Zurück im Seminarraum widmen wir uns endlich der Regel 12. Herr Kopf lässt erstmal Gruppen bilden. Es geht um die Unterrichtseinheit »Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen«, ich sagte das bereits. Gruppenarbeit also. Ich schlendere von Tisch zu Tisch, wenn mich die Erinnerung nicht trügt, schaue, höre und staune, wie die Gruppen sich dem Diskurs über die Regel 12 widmen, über das feingewebte Spezialvokabular, bei dem sich jeder des Jargons nicht Mächtige töricht vorkommt, staune, wie kompliziert die Materie ist, anschließend Vorstellung der Arbeitsergebnisse, Flipchart, Folien, Powerpoint sind einsatzbereit, logo. Ich erwähne jetzt nur das Stichwort »Kontaktvergehen« und die Frage, wann aus »gefährlichem Spiel« ein »verbotenes Spiel« wird, und gebe zu bedenken, dass bis vor einiger Zeit »Einleitungsvergehen« und »Kontaktvergehen« unterschieden wurden, jetzt aber nicht mehr, so jedenfalls hab ich es notiert. Zwei Blockseiten weiter stoße endlich wieder auf das gute alte »Fingerspitzengefühl« und lese, dass es, so der Schiedsrichter es als Argument verwendet, mit einer »Regelbeugung« gleichzusetzen ist, besser sei, es durch »Ermessensspielraum« zu ersetzen, »ein sehr guter Vorschlag«, sagt Seminarleiter Kopf. Er sagt auch, wer im Spielbericht den Begriff »Absicht« benutzt, ohne dass es um ein »Handspiel« geht, »der begibt sich juristisch auf dünnes Eis«, und zwischen »Ermahnung« und »Aufforderung« muss man differenzieren, die »Ermahnung« zählt nicht zu den »persönlichen Strafen«, also jetzt »von der Begrifflichkeit her«, und »scharfes Ansprechen bei der Mauerbildung« sei noch keine »Ermahnung«, sondern eine »Aufforderung«, oder umgekehrt – die Zeile ist unleserlich – und »wenn du jemanden aufforderst, auf Distanz zu gehen und er macht das nicht, dann musst du unweigerlich die gelbe Karte zeigen«. – So oder so ähnlich ist es gewesen.
Am Abend dann der Vortrag von Thorsten Schriever, der natürlich keinen Vortrag hält, sondern zurückhaltend plaudert in einer Mischung aus Bescheidenheit und Höflichkeit, keine Spur arrogant, so wie es gewünscht wird, mich verlassen leider die letzten Reste des Konzentrationsvermögens, bin müde, schreibe pflichtschuldigst ein paar Satzfesten auf, dazu langt es noch, Schriever erzählt von dem Spiel, als Reimann ihn anging, davon, wie »die Medien« auf ihn einstürmten, ihn drangsalierten, wie anstrengend das war, eigentlich habe man ja dann das Bedürfnis, »dass man dich in Ruhe lässt«, aber man absolviere ja auch »Verhaltensschulung«, erzählt vom »Stress« und davon, »auf wieviel Feldern man angreifbar« sei. Bei einigen Teilnehmern ist eine Spur Verehrung oder Stolz zu spüren gegenüber einem, der es geschafft hat, aber man duzt sich selbstverständlich, Sportskameraden, man ist aus demselben Holz, man gehört gewissermaßen zusammen, ist eine Solidargemeinschaft, der mediale Glanz strahlt bis hierher, man tut ja das gleiche. – Ob Schriever ein Vorbild hat? Es gebe »Leute, die siehst du gern, du kannst aber keinen kopieren, du musst deine eigene Linie finden«, Sätze, die wie formatiert klingen, aufgesagt, weitere Sätze bleiben hängen, »wie kann ich Situationen lösen, dass sie jeder versteht und ich gut dabei herauskomme« und »die Konzentration sei ja da, dass du da sauber rauskommst, dass der Schiedsrichter kein Thema ist hinterher«. Die Coaches erwähnt Schriever und wie man nachher die Videokassette von Premiere anschaut und das Spiel analysiert. Wie man die höheren Stufen erklimmt, muss etwas von einem Dressurakt haben, denke ich später, sowas muss man mögen, brauche ich vielleicht auch einen Coach?
Abends in der Sportschulenwirtschaft. Hopfenkaltschale. Das Fernsehen in der Ecke überträgt irgend ein Pokalspiel. Ich bin wirklich groggy, möchte los, ein Bier kann ich mir vor der Rückfahrt erlauben. Um morgen wiederzukommen? Übermorgen dem »Gesprächskreis zur Gewaltprävention« lauschen? Ich erlaube mir ein zweites Bier, lausche im Halbdämmer, notiere dies und das, Bruchstücke. Als ich mich auf den Weg machen will, sind noch zwei Tische besetzt. An dem einen bleibe ich hängen. Matt genug, um plötzlich tollkühn zu werden, die Vorsicht schlummert längst, frage ich, was sie von dem Titel des Buches halten, den der Verleger favorisiert: »Die schwarze Sau«? – Der eine gähnt, der nächste sagt, das habe sein Opa immer gerufen. Der dritte sagt: »Okay, kann man machen. Aber korrekt müsste es heißen ›Die kunterbunte Sau und zweiundzwanzig Betrüger‹!« Darüber werde ich nachdenken. Aber nicht mehr heute. Der Recherchenmacher ist erledigt. Ich fahre nach Hause. Nickerchen machen.
Wo ist der Schiedsrichter? – Prähistorische Betrachtungen
»Das beharrlichste Merkmal im Niedergang befindlicher Zivilisationen ist ihre Tendenz zur Standardisierung und Uniformität.«
Historiker Arnold J. Toynbee (1889 – 1975)
»Das Schiedsrichterwesen wartet noch auf seinen Historiker oder seine Historikerin. Denn auf jeden Fall besitzt es eine Geschichte.«
FIFA 1904 – 2004. 100 Jahre Weltfußball
Gelegentlich etwas Kugelförmiges zu werfen, zu schlagen, dagegen zu treten, zu fangen oder zu jonglieren – dies Gebaren scheint eine Konstante in der Menschheitsgeschichte zu sein. Solche Konstanten, wie verlässlich rekonstruiert auch immer, sieht der Homo sapiens sapiens gern. Sie vermitteln ihm ein behagliches Gefühl, den Tiefenglanz der Vergangenheit, betten ihn ein in Traditionen. Im Falle des Balls kann man sich unter andren auf die Ägypter, Mayas, Chinesen, Japaner, Azteken, Griechen oder Römer berufen. Wenn sie einen runden oder nahezu runden Gegenstand bewegten, war’s ein Spiel, ein Vergnügen, war’s Ritual oder kultische Handlung, zumeist bestimmten sozialen Gruppen zugeordnet, beschränkt auf lokale Gemeinschaften. Wieviel das mit dem Fußball zu tun hat, so wie wir ihn kennen, sei dahingestellt, ist die falsche Frage.
Deshalb lassen wir sie auf der Suche nach den Schiedsrichtern beiseite. Wir verzichten auf die folkloristische Visite, erwähnen nur im Vorbeigehen jene mit Federn und Haaren gefüllte Lederkugel, die vor mehr als 2000 Jahren in China mit dem Fuß in ein Netz getreten wird; schlagen einen Bogen um die japanischen Tempelbezirke, wo bei der Kemari-Zeremonie der Ball nicht den Boden berühren darf; wir überspringen das Kalagut, das die Eskimos spielen, das Lapta in Russland und das Hornussen in der Schweiz. Wo bleibt der Schiedsrichter?
Im Nu überblenden wir zu einem Erinnerungsbild aus der Kindheit. Wer vermisst den Schiedsrichter beim Kick auf der Straße, im Drahtverhau eines Bolzplatzes, auf der Wiese (» ... nicht gestattet«)? »Letzter Mann hält« oder »Fliegender Torwart«? »Drei Ecken ein Elfer« oder ohne Aus an der Torlinie? Man einigt sich rasch, ein paar Absprachen, es kann losgehen. Prallen dennoch zwei Ansichten aufeinander, weil zum Beispiel das Tor nicht durch Pfosten und Querlatte, sondern einen Haufen Kleider gekennzeichnet ist, entscheiden meist die Älteren, ob der Ball drin war oder nicht. Wenn das nichts hilft, wird es laut. Manchmal steigert sich der Streit bis zur Rauferei, die mit blaugeschlagenen Augen, zerdellten Nasen, gebrochenen Schienbeinen, blutenden ... Wo bleibt der Schiedsrichter?
Zunächst begegnen wir dem Maestro di Campo! Einem Mann im schwarzen Rock und mit Halskrause. Er trägt als Zeichen seiner Würde ein Schwert und wacht über den Calcio fiorentino, die große Rennaissance-Gala in Florenz, die andere Stadtstaaten in Italien adaptieren. Calcio ist ein Bastard aus Rugby und Ringen im Griechisch-Römischen Stil und »Der Meister des Feldes« verantwortlich dafür, »die Ruhe zu gewährleisten und bei Streitigkeiten ein Urteil zu fällen«, wie es in dem Buch Memorie del Calcio Fiorentino von 1688 heißt. Zum Ehrenkodex, den der Maestro zu überwachen hat, gehört das Verbot, den Gegner zu beißen. Er ist, wenn man will, der erste dingfest zu machende Vorläufer des Fußballschiedsrichters.
Er verschwindet aber gleich wieder, obwohl wir uns den Prototypen des modernen Fußballs nähern. Dieser entsteht Mitte des 18. Jahrhunderts, hinter den Mauern der britischen Public Schools, den Privatschulen der adligen und bürgerlichen Eliten. Er basiert, je nach örtlichen Vorlieben und topographischen Bedingungen stark variierend, auf den so genannten »mob games«, Raufspiele mit unbegrenzter Zahl der Beteiligten, ausgetragen unter viel Getöse, vielerlei Namen und Variationen in ganz Europa. Ihre wichtigste, wenn nicht einzige Regel besteht darin, einen Ball – egal wie und wie lange es dauert – ins meilenweit entfernte Tor, dass heißt über die Ortsgrenze der benachbarten Siedlung zu befördern, über Stock und Stein, Hecken und Zäune, Felder und Wasserläufe. Danach ist Schluss. Keine Chance für ein 0 : 0.
Eine Abart der Jagd querfeldein ist seit dem Mittelalter auch in der britischen Stadt ein Volksvergnügen, Straßenfußball avant la lettre und avant Pflaster oder gar Asfalt. Man spielt so rüde, dass der Lord Mayor von London 1314 den Fußball aus der City verbannt. Zuwiderhandelnden droht der Kerker. Als das alles nichts hilft, ruft Schottenkönig James I., seinerseits nach 18 Jahren Haft im Londoner Tower gerade zurück daheim, das Parlament ein und läßt das Edikt: »that na mā play at the fute ball« verabschieden.
Das grobe Betragen schlägt durch bis in Shakespeares Komödie der Irrungen, in die Klage Dromios’ von Syrakus: »So roll ich denn für Euch auf diese Weise? Habt ihr mich denn für einen Fußball? Ihr tretet mich von dort nach hier, und er, er tritt mich dann von hier nach dort. Wenn ich in diesem Dienst verharren soll, so müßt ihr mich in Leder kleiden.« In König Lear geht’s auch hoch her. »Wirfst du mir Blicke zu, du Hundsfott?« sagt Lear zu Oswald und schlägt ihn. Der protestiert: »Ich lasse mich nicht schlagen, Mylord.« Darauf der reaktionsschnelle Kent: »Auch kein Bein stellen, du niederträchtiger Fußballspieler?« Und schreitet zur Tat.
Aus der Zeit zwischen 1324 and 1667 sind mehr als 30 königliche oder örtliche Gesetze überliefert, die den Fußball verdammen. Das Spiel ist tatsächlich wild, brutal, chaotisch, kurzum ungeregelt – bis es, wie gesagt in die Schule kommt. Einen ersten Fürsprecher findet es in Richard Mulcaster, Direktor der Merchant-Taylors’ School, später an der St. Paul’s. Mulcaster publiziert 1581 eine Schrift, in der er angesichts berstender Schienbeine und anderer Knochenbrüche für die Einführung eines Richters plädiert, »which can judge of the play, and is judge over the parties, & hath authoritie to commande in the place«.
Es wird aber noch rund 250 Jahre dauern, bis der Fußball domestiziert und zum festen Bestandteil der Schulordnung geworden ist, bis zum Beispiel in Harrow die Regel 16 lautet: »Zu Beginn eines jeden Fußballquartals sollen die Regeln gut sichtbar in jedem Haus angebracht werden und neue Schüler sind aufgefordert, sich mit diesen gründlich vertraut zu machen.«
In Harrow machen wir auch deshalb Station, weil vermutlich hier der Fußball als Pflichtsport zuerst eingeführt worden ist. Allerdings nicht aus Spaß an der Freude, sondern um diese zu kanalisieren. Die Pädagogen versprechen sich neben der disziplinierenden Wirkung die Förderung von Loyalität und Selbstlosigkeit gegenüber Schule, Militär und anderen staatlichen Institutionen. Deshalb, so der FIFA-Bildband 100 Jahre Weltfußball, sei der Fußball »ein wichtiger Bestandteil der britischen Konformitätskultur« geworden, »für deren Konservierung die Privatschulen berühmt und berüchtigt waren.« Harte körperliche Ertüchtigung wird im viktorianischen Zeitalter »geradezu eine Mode«.
Auch außerhalb der priviligierten Privatschulen werden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Fußballspiele organisiert. Manchmal sind es Herausforderungsspiele, bei denen Geld gewettet wird. Eine Zeitungsannonce aus Leicester kündigt für den Karfreitag 1838 »ein Fußballspiel auf dem Cricket Platz« an: »Elf Spieler, hauptsächlich Drucker, stammen aus Derby, eine gleich große Anzahl aus Leicester. Für ein Preisgeld von bis zu 25 Pfund werden die Sieger elf weitere Spieler aus einer beliebigen Stadt in England herausfordern.« Die Mannschaften rekrutieren sich aus Klub-, Kneipen-, Berufs- und Dorfgemeinschaften. Das Regelwerk wird ad hoc verabredet und meist kommt man ohne Spielleiter aus. Manchmal wird es laut, manchmal steigert sich der Streit und endet mit blauen Augen, zerdellten Nasen, gebrochenen Schienbeinen, blutenden ... Wo bleibt der Schiedsrichter?
Er erscheint schattenhaft auf der Projektionsfläche, als man um 1850 in den englischen Schulen und Universitäten den sportlichen Lehrplan ausweitet, im Interesse der Gesundheit und Diziplin den Fußball zu zähmen beginnt. Das Spiel ähnelt aber immer noch einer Mischung aus heutigem Rugby und Freistil-Kickboxing. Nach wie vor existiert keine standardisierte Form, es existieren keine einheitlichen Regeln. Schick einen aus Charterhouse nach Harrow, einen aus Eton nach Winchester, einen aus Winchester nach Rugby: die werden sich allesamt wundern.
Wir wundern uns – und nicht zu knapp – über Reverend Samuel Sands, einen »Old Boy«, also »Ehemaligen« der Schule in Rugby. Er beaufsichtigt etwa um diese Zeit die Fußballspiele und hat überliefert, was den Gegnern seiner Zöglinge blüht: »Eine Gewohnheit der älteren Schüler zu Beginn eines Schuljahrs ist es, ein Paar Stiefel zum Schuhmacher zu tragen, damit er dicke Sohlen daran befestigt, zugespitzt an den Zehen, um die Schienbeine der Gegner einzuritzen.« Als der Reverend während einer besonders schlimm geführten Partie gefragt wird, wann er denn das Spiel zu unterbrechen gedenke, sagt er: »Short of manslaughter.« Knapp vor einem Totschlag. Sands agiert also eher wie der Ringrichter beim Boxer, keinesfalls wie ein moderner Referee.
Bevor diese Spezies endgültig ein- und durchgreifen bzw. die Platzhoheit übernehmen kann, haben die Kapitäne der Teams dafür zu sorgen, dass die Spieler nichts tun, was dem »spirit of the game« und den jeweils geltenden Regeln widerspricht. Sie zu kennen, ist eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Insofern fungieren die Mannschaftsführer, zuständig jeweils für das eigene Team, als eine Art übergeordnete Instanz. Sie wandeln auf dem schmalen Grat zwischen akzeptiertem Körpereinsatz und vorsätzlicher Brutalität, sie verwarnen die Spieler ihrer Mannschaft und verweisen sie im Wiederholungsfall des Feldes (theoretisch also auch sich selbst). Merke: Absichtliches Foulspiel entspricht nicht dem Verhalten eines Gentlemans, nicht dem »Fairplay«. Und merke auch dies: Fußball, nicht nur Rugby, ist eine Kontaktsportart, bei der es ganz wesentlich darum geht, wie Hans Ulrich Gumbrecht es definiert, »Räume mit dem Körper zu besetzen und zu blockieren.« Und sobald Körper, die Räume erobern, und Körper, die ebendiese Räume verteidigen wollen, aufeinander prallen, schlagen »Machtverhältnisse in Gewalt, in die Zurschaustellung von Macht um«.
Um das zu verhindern, erfinden die Briten erst einmal die »Umpires«, eine Bezeichung, die noch heute im Baseball, American Football und im Cricket als Refereesynonym verwendet wird. Sie treten zu zweit auf und werden erstmals 1847 in den Regel-Listen von Eton, Winchester und Harrow erwähnt. Im Allgemeinen stellt jede Mannschaft einen Umpire, postiert nahe der Torlinie der eigenen Spielhälfte. Es sind ‘neutrale’ Beobachter, ausgerüstet mit einem Taschentuch oder Spazierstock, Mediatoren mit Entscheidungsbefugnissen, die bei Regelverstößen von den Kapitänen angerufen werden oder Streitfälle schlichten. Der Stellenwert der oft wenig kundigen Umpires ist marginal, ohnehin kommen sie nicht in jedem Match zum Einsatz. Außerdem gibt es weder Straf-, Eck- noch Freistöße, es gibt keinen Strafraum und keinen Torhüter, und so lange die Regeln nicht übereinstimmen, ist Verwirrung, wenn nicht Chaos vorprogrammiert. Dann fliegen wieder mal Fäuste, werden Nasen zerdellt, Schienbeine gebrochen, blutende ... Wo bleibt der Schiedsrichter?
In Cambridge hat man ihn schlicht vergessen, wieder aus den Augen verloren, als sich 1848 vierzehn Repräsentanten einiger Public Schools dort versammeln, um die berühmten »Cambridge Rules« zu formulieren in der Hoffnung, sie würden zur Norm werden. Trotz des Einzugs der Umpires in die Regelwerke von Eton, Winchester und Harrow werden die Aufsichtspersonen hier mit keiner Silbe gewürdigt.
Aber endlich kommt er: der Referee! 1849 werden im Kodex von Cheltenham »zwei Umpires und der Referee« aktenkundig, »the sole arbiters of all disputes.« An den außerhalb des Spielfeldes geparkten Schiedsrichter, so steht es geschrieben, wird die Entscheidung überwiesen (»to refer to«), wenn die Umpires sich partout nicht einigen können.
Leider schaffen es die drei dann nicht bis Sheffield, wo sich außerhalb der akademischen Institutionen der subkulturelle Fußball zu einer organisierten Spielform entwickelt hat. 1857 wird in der Stahlstadt am Fuße der Pennines der Sheffield F.C. gegründet, der erste nicht-universitäre Klub. Im selben Jahr notiert man die Sheffield Rules –»A ball in touch is dead ...« (Regel 10) –, zwei Jahre später werden sie gedruckt – der großen Nachfrage wegen. Bald tummeln sich in Sheffield über 17 Klubs. Allein, auch diese Regeln erwähnen weder die Umpires noch den Referee.
Auch in London und Umgebung pflegen mehr als zwei Dutzend Teams vorwiegend aus ehemaligen Schülern der Public Schools irgendeine Variante des Fußballspiels. Fuball a la Rubgy, Fußball nach Cambrigde Art, Fußball wie man ihn in Winchester spielt, etcetera pp. Gegeneinander anzutreten ist ziemlich kompliziert. Eine Möglichkeit sich zu arrangieren heißt: erste Halbzeit diese, zweite Halbzeit jene Regeln. Oder man vereinbart den Regeltausch jeweils für das Hin- und Rückspiel.
Ein Irrwitz. Der Regelirrgarten blockiert das Miteinander des Gegeneinanders und ... ähem, wäre der Schiedsrichter – Fairplay hin oder her – nicht vielleicht doch eine gute Idee? Ein Standard ist gefragt, eine Uniform. Es wird Zeit, es zu versuchen.
Fortsetzung im Kapitel »Von der Seitenlinie ins Rampenlicht«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.