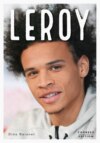Kitabı oku: «Leroy», sayfa 2
Neue Heimat Wattenscheid
Nach einem kurzen Flirt mit Fenerbahce Istanbul – die Vorstände Aziz Yilmaz und Yusuf Duru weilten zu Verhandlungen in Nürnberg – wechselte Sané gemeinsam mit Verteidiger Stefan Kuhn für eine Ablöse von 950.000 D-Mark zur SG Wattenscheid. Beim Bundesliga-Aufsteiger sollte er den nach Köln abgewanderten Torjäger Maurice Banach ersetzen – und er ließ diesen rasch in Vergessenheit geraten. Die vier Jahre im Lohrheidestadion wurden zur erfolgreichsten Zeit seiner Karriere.
»Ich habe den Namen meines Vaters öfter auf Youtube eingegeben, mir seine Tore angeschaut. Ich bin stolz auf meinen Vater und seine Karriere. Er ist ein Vorbild für mich, auch als Fußballer.«
Leroy Sané über seinen Vater Souleyman
Sané genoss das Vertrauen von Trainer Hannes Bongartz, mit seinen Sturmkollegen Uwe Tschiskale, Ali Ibrahim und später Marek Lesniak sorgte er dafür, dass sich die »graue Maus« in der Bundesliga etablierte. Im westlichen Bochumer Stadtteil lernte er auch seine spätere Frau Regina Weber kennen, eine ehemals äußerst erfolgreiche Sportgymnastin, die in den 1980er Jahren mehrmals Deutsche Meisterin wurde und 1984 in Los Angeles die bis heute einzige olympische Medaille (Bronze) in dieser Sportart für Deutschland holte. In Wattenscheid wurde er auch nach seiner aktiven Karriere sesshaft. »Hier ist meine Familie, hier zahle ich meine Steuern, hier fühle ich mich wohl«, gab er in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zu Protokoll. Zu den Höhepunkte in seinen vier Bundesliga-Jahren im SG-Dress zählten sein Dreierpack 1990 zum 3:1-Sieg beim Karlsruher SC, der 3:2-Erfolg 1991 gegen Bayern München vor 35.000 Zuschauern im Bochumer Ruhrstadion, bei dem er in der 89. Spielminute den Siegtreffer durch Thorsten Fink vorbereitete. Und sein Doppelpack zum 2:0-Sieg 1992 im Bochumer Stadtduell gegen den VfL. In 117 Bundesliga-Spielen für die SG gelangen ihm 39 Tore – so viele wie keinem anderen in der Wattenscheider Bundesliga-Historie. Später wurde er von den Fans zum Jahrhundertspieler des Vereins gewählt.
Nach dem Bundesliga-Abstieg 1994 suchte Sané eine neue sportliche Herausforderung. »In Wattenscheid wollte ich nicht bleiben, weil ich keine Lust habe, in der Zweiten Liga zu spielen. Das kann ich noch, wenn ich 40 bin«, sagte er. Ein Wechsel zu Schalke 04, wo Trainer Jörg Berger seinen ehemaligen Schützling aus gemeinsamen Freiburger Tagen gerne gesehen hätte, scheiterte am Geld. »Wattenscheid forderte eine Million Ablöse für mich, ein bisschen viel für einen 33-Jährigen«, so Sané. Stattdessen verschlug es ihn nach Österreich. In Innsbruck hatte gerade Finanzmakler Klaus Mair das Präsidentenamt beim FC Wacker angetreten. Mit Stars wie Österreichs Fußball-Idol Hans Krankl als neuem Trainer, den ehemaligen Bayern-München-Profis Manfred Schwabl (vom 1. FC Nürnberg) und Harald Cerny (vom FC Admira/Wacker Mödling), Nationalspieler Peter Stöger (vom FK Austria Wien) und eben Sané wollte er den Traditionsverein, der ab sofort unter der Bezeichnung FC Tirol firmierte, zurück zu alten Erfolgen führen. »Doch das Tiroler Dream-Team glänzte nur wenige Wochen. Dann wurde das Finanzgenie Mair als Betrüger entlarvt und in Untersuchungshaft gesteckt«, berichtete der Kicker. Im Etat klaffte auf einmal ein Millionenloch, Spielmacher Schwabl suchte sofort das Weite und wechselte zum TSV 1860 München. Die Verwaltungen der Stadt Innsbruck und des Bundeslandes Tirol sprangen als Retter ein, das Krankl-Team schloss die Saison 1994/95 als Fünfter ab, Souleyman Sané holte sich mit 20 Treffern die Torjägerkanone. In Innsbruck wurde sein erster Sohn Kim geboren.
»Die Älteren erkennen mich noch auf der Straße und schwärmen von den alten Zeiten.«
Souleyman Sané über seine Heimat Wattenscheid
Eineinhalb Jahre spielte er in Tirol. Während der Winterpause 1995/96 peilte er eine Rückkehr zur SG Wattenscheid an – sein zweiter Sohn Leroy hatte inzwischen in Essen das Licht der Welt erblickt. Der Transfer scheiterte jedoch an der Ablöseforderung von 150.000 D-Mark. Stattdessen unterschrieb Sané beim FC Lausanne-Sport der Schweiz. 44 Spiele absolvierte er für den Erstligisten aus der Romandie, in denen ihm 18 Tore gelangen. Erst im Oktober 1997 klappte es mit der Heimkehr nach Wattenscheid. Beim seinem Comeback, einem 4:2 gegen Fortuna Köln, erzielte der inzwischen 36-Jährige einen Treffer selbst und holte den Freistoß heraus, der zum 1:0 führte. Den Sieg widmete er hinterher seinen Söhnen Kim und Leroy. In 45 Zweitliga-Spielen trug er bis zum Abstieg 1999 noch das schwarz-weiße Trikot (neun Tore). Danach ließ er seine Profikarriere jeweils eine halbe Saison beim Linzer ASK in Österreich und beim FC Schaffhausen in der Schweiz ausklingen. Im Anschluss trat er noch als Freizeitfußballer für mehrere unterklassige Vereine gegen den Ball und versuchte sich im Trainerbereich, unter anderem betreute er die Nationalmannschaft Sansibars.
2011 stieg Souleyman Sané als Scout in die Sportmanagementagentur T21+ der ehemaligen Bundesliga-Profis Jürgen Milewski und Jens Jeremies ein, die lange Zeit auch die Interessen seines Sohnes Leroy vertrat. Noch heute steht er diesem als wichtiger Karriere-Ratgeber zur Seite. Überliefert sind unter anderem diese klugen Sätze: »Nur weil er Fußballprofi ist, braucht er nicht zu denken, er sei intelligenter als ein Koch oder Straßenfeger. Das ist ein Beruf – mehr nicht.« Leroy Sané beschrieb das Vater-Sohn-Verhältnis im Ratgeber Dein Weg zum Fußballprofi wie folgt: »Mein Vater Souleyman macht mir, obwohl er selbst Profifußballer war, überhaupt keinen Druck, dass ich etwas Bestimmtes schaffen muss. Im Gegenteil, er hilft mir, wenn ich Fragen habe. Manchmal kritisiert er mich, was auch gut ist. Wir haben einen sehr guten Draht zueinander.« So weit zur sportlichen Vita von Souleyman Sané.
Kampf gegen Rassismus
Neben dem Fußballer gab es auch den jungen Menschen, der sich zurechtfinden musste im rauen Deutschland der 1980er Jahre. »Es gab seinerzeit sehr wenige Schwarze in Deutschland. In manchen Dörfern kannten die Bewohner dunkelhäutige Menschen nur aus dem Fernsehen – sie hatten Afrikaner noch nie zuvor in Natura gesehen«, erzählte Souleyman Sané viele Jahre später im Magazin 11 Freunde. Manch einer hätte sich bei seinem Anblick sogar regelrecht gefürchtet. »Für diese Leute war das ein richtiger Schock, als sie das erste Mal einen Afrikaner an der Ampel sahen.«
Daheim in Frankreich war dies anders, in der einstigen Kolonialmacht gehören Migranten aus Nord-, West- und Zentralafrika seit jeher zum Alltag – und zum Fußball. »Da war es vollkommen normal, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Kultur zusammenspielen«, berichtete Sané. In Deutschland war er hingegen einer der ersten dunkelhäutigen Spieler überhaupt. Rassismus schlug ihm im Alltag, von den Zuschauerrängen und von den Gegenspielern entgegen. Negative Erfahrungen machte Sané bereits auf den schwäbischen Dorfplätzen, über die er mit dem FV Donaueschingen tingelte. »Ich sprach zu der Zeit ja überhaupt kein Deutsch, konnte mich also nicht gegen die rassistischen Beleidigungen der Zuschauer wehren. Meine Mannschaftskollegen sagten stets: Hör nicht auf diese Leute! Die wissen, dass du gut bist und wollen dich deshalb verunsichern. Mach dein Spiel, und wenn wir gewinnen, dann hast du gewonnen!«, erinnerte er sich zurück. Im Kicker berichtete er auch über alltägliche Episoden: Wenn er mit seinem BMW Cabrio an einer Ampel stehe, dann »glotzen mich die anderen Autofahrer schon mal ganz verstört an. Die fragen sich wohl, wie ein Asylant zu so einem Auto kommt.« Eine andere Geschichte erlebte er mit der Tochter eines Mannschaftskameraden. »Sie wollte mir auf keinen Fall die Hand geben, sie hatte Angst, dass ich abfärbe.«
Nicht besser wurde es später auf der großen Bühne Bundesliga. Schon der Empfang in Nürnberg verlief im Sommer 1988 alles andere als wohlwollend. Noch bevor er sein erstes Spiel im Trikot des Clubs absolviert hatte, startete die Abendzeitung eine Kampagne gegen den Stürmer. Als »delikate Angelegenheit« bezeichnete das Boulevardblatt die Verpflichtung des ersten dunkelhäutigen Spielers der Vereinsgeschichte und berichtete von Fans, die in Briefen und per Telefon angedroht hätten, ihre Dauerkarten zurückzugeben, »wenn ein Neger« im ruhmreichen Dress des 1. FC Nürnberg spiele. Club-Präsident Gerd Schmelzer war bemüht, den Bericht zu dementieren. Die Abendzeitung jedoch ließ nicht locker und stichelte weiter, bis Sané im Dezember 1989 die Sicherungen durchbrannten. Vor der wöchentlichen Pressekonferenz streckte er den Reporter (»Er hat Lügen über mich geschrieben«) mit einem Faustschlag nieder, der 1. FCN mahnte ihn daraufhin arbeitsrechtlich ab.
»Für diese Leute war das ein richtiger Schock, als sie das erste Mal einen Afrikaner an der Ampel sahen.«
Souleyman Sané über das Deutschland der 1980er Jahre
Auch mit Paul Steiner, dem Libero des 1. FC Köln, geriet Sané während seines Nürnberger Engagements aneinander. Nach dem Heimspiel gegen die Rheinländer im März 1990 (1:1) klagte er den späteren Weltmeister via Kicker an: »Nachdem ich eingewechselt wurde, hat er gleich wieder angefangen. Als ich an ihm vorbeilief, rief er: Du Scheiß-Neger! Verschwinde hier! Das war übrigens nicht das erste Mal. Schon in Köln hat er mich angemacht.« Steiner stellte die Geschehnisse aus seiner Sicht wie folgt dar: »Nach einem Foul hat mich Sané als Nazi beschimpft – und aus dem Wortgefecht heraus habe ich wohl Schwarze Sau zu ihm gesagt. Er spuckte mir ins Gesicht – und da habe ich mich wieder gehen lassen. In der Bundesliga gehört Provozieren dazu, das darf man nicht so eng sehen. Aber ein Rassist bin ich trotzdem nicht! Ich habe viele dunkelhäutige Bekannte. Auch mit Anthony Baffoe verstand ich mich gut, als er noch beim 1. FC Köln war. Trotzdem finde ich, Sané soll nicht immer so tun, als sei er der arme Schwarze, der für nichts was kann.«
Auch gegen die Beschimpfungen von den Rängen wusste sich Souleyman Sané zu wehren: »Ich konnte nur über Tore und gute Spiele die Rassisten mundtot machen«, sagte er. »Immer, wenn diese Affenrufe losgingen, dachte ich: Gleich schieße ich ein Tor – und dann seid ihr stumm!« Im DFB-Pokalspiel im Dezember 1990 beim Hamburger SV – Sané wurde wieder einmal mit »Neger-raus«-Rufen beschimpft – traf er drei Minuten vor Spielende zum Wattenscheider 2:1-Sieg. Hinterher sagte er in die TV-Kameras: »Nix Neger raus, der HSV ist raus!« Die Geschehnisse in Hamburg und der Mord am angolanischen Gastarbeiter Amadeu Antonio Kiowa durch rechtsextreme Jugendliche in Eberswalde/Brandenburg veranlassten ihn, gemeinsam mit den ghanaischen Profis Anthony Baffoe von Fortuna Düsseldorf und Anthony Yeboah von Eintracht Frankfurt in der Bild-Zeitung einen »offenen Brief an alle Fans« zu veröffentlichen, in dem es hieß: »Ich dachte immer, dass man in Deutschland ausländerfreundlich ist. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Was wir in Stadien an Beleidigungen zu hören bekommen, ja erdulden müssen, trifft ins Herz. Es hat uns wehgetan, wie die Schwarzen in den neuen Bundesländern behandelt werden. Wir wollen kein Freiwild sein!« Danach, so Sané, sei die Situation erträglicher geworden. Die Vereine begannen, sich mit der Thematik zu beschäftigen, der DFB startete die Kampagne »Mein Freund ist Ausländer.«
Interview mit Jörg Dittwar

Jörg Dittwar spielte von 1987 bis 1994 für den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga. In den Spielzeiten 1988/89 und 1989/90 war der Verteidiger dort Mannschaftskollege von Souleyman Sané. Nach dem vorzeitigen Ende seiner aktiven Laufbahn infolge einer schweren Knieverletzung arbeitete er als Trainer im Jugendbereich des Clubs und bei mehreren Amateurvereinen. Von 2009 bis 2017 war er Bundestrainer für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Im Interview spricht er über Souleyman Sané.
Herr Dittwar, welche Erinnerungen haben Sie an Souleyman Sané?
Jörg Dittwar: »Ich erinnere mich an einen sehr angenehmen Menschen und Top-Mannschaftskameraden. Wir waren damals öfter gemeinsam nach dem Training oder nach den Spielen unterwegs. Auf dem Fußballplatz war Samy eine Granate. Mit ihm und Dieter Eckstein beziehungsweise später Christian Hausmann hatten wir in Nürnberg den schnellsten Sturm der Bundesliga. Samy hat mich aber auch so manche Nerven gekostet: ob als Gegenspieler in der Zweiten Bundesliga, als er noch beim SC Freiburg war und ich bei der Spielvereinigung Bayreuth, oder später im Training beim Club. Zum einen musste man immer aufpassen, dass er einen mit seinen Tricks nicht vernascht. Zum anderen war er oft schneller als der Ball und hat deswegen so manche Torchance ausgelassen.«
Welches Spiel ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?
Jörg Dittwar: »Ganz klar das legendäre Spiel im UEFA-Cup 1988 bei AS Rom, noch heute ein Highlight für viele Club-Fans. Im Vergleich zu den Römern waren wir eine No-Name-Truppe. Samy ist ein paar Konter gelaufen, hat uns in Führung geköpft und den Siegtreffer vorbereitet.«
Wenn Sie Leroy Sané heute spielen sehen: Was erinnert Sie an den Vater?
Jörg Dittwar: »In erster Linie seine Schnelligkeit. Samy war meines Erachtens aber noch schneller als Leroy. Der ist wiederum am Ball besser, technisch begnadeter. Leroy ist einer, der sich von hinten die Bälle holt und dann durchdribbelt.«
Nicht nur Leroys Vater Souleyman war Leistungssportler, sondern auch dessen Mutter Regina Weber-Sané. Wie sehr haben ihm seine Eltern in der Entwicklung geholfen?
Jörg Dittwar: »Wenn man in einer sportlichen Familie aufwächst, dann kriegt man ganz andere Werte vermittelt, was Ernährung, Disziplin oder soziale Kompetenz betrifft. Die Eltern sorgen dafür, dass ihre Kinder im richtigen Umfeld aufwachsen. Aber Leroy hatte sicherlich auch mit dem Namen Sané zu kämpfen. Das ist nicht so einfach. Wegen des bekannten Vaters schauen die Leute da genauer hin und ziehen Vergleiche.«
Wie erklären Sie sich die steile Entwicklung, die Leroy Sané zwischen 2012 und 2015 genommen hat von der Ersatzbank des Schalker U17-Teams bis in die deutsche A-Nationalmannschaft?
Jörg Dittwar: »Das Talent und den Ehrgeiz hatte er wohl schon immer, dazu das passende familiäre Umfeld. Das I-Tüpfelchen war dann in der U19 mit Norbert Elgert der richtige Trainer. Wenn man jemanden hat, der einem erzählt hat, wie es abläuft, wenn man wissbegierig ist und gut zuhört, dann kann aus einem was werden.«
Als Sie im Frühjahr 2016 von den Millionensummen hörten, die für einen Wechsel im Raum standen: Was haben Sie sich damals gedacht?
Jörg Dittwar: »Dass ich 20 Jahre zu früh gespielt habe. Ich bin überzeugt: Auch Samy würde mit seinem Können heutzutage in der Premier League spielen.«
Kam der Wechsel 2016 zu Manchester City Ihrer Meinung nach zu früh, hätte Leroy Sané vielleicht nicht noch das eine oder andere Jahr bei Schalke oder zumindest in der Bundesliga verbringen sollen?
Jörg Dittwar: »Er hat alles richtig gemacht. In England hat er sich einen Namen gemacht und sich zum Weltstar entwickelt. Schade, dass wir ihn bei der WM in Russland nicht sehen konnten. Ich habe nicht verstanden, dass er nicht nominiert wurde.«
II.
ANPFIFF
Leroy Sané wurde am 11. Januar 1996 in Essen inmitten des Ruhrgebietes geboren. Als zweiter von drei Söhnen des langjährigen Profifußballers Souleyman Sané und der Olympiateilnehmerin in der Rhythmischen Sportgymnastik, Regina Weber, wuchs er unweit des Lohrheidestadions im Bochumer Stadtteil Wattenscheid auf. Im Sommer 2001, als Fünfjähriger, nahm er erstmals teil am Kindertraining der SG Wattenscheid 09, dem ehemaligen Verein seines Vaters. Eine Geschichte, wie sie der deutsche Fußball nie zuvor erlebt hatte, nahm ihren Lauf.
Anfänge auf dem Aschenplatz
Von seiner Mutter Regina, der erfolgreichen und mit einer olympischen Bronzemedaille dekorierten Sportgymnastin, habe er die Beweglichkeit und Geschmeidigkeit geerbt, von seinem Vater Souleyman die Explosivität und das Tempo, beschreiben langjährige Beobachter das Spiel von Leroy Sané. »Es war schon geil, wie der Kleine mit der Palmenfrisur über die Asche geschossen ist«, erinnerte sich auch Aytekin Samast an die gemeinsamen Tage mit dem jungen Fußballer, als er sich 2016 mit einem Reporter der Sport Bild auf den Aschenplätzen neben dem Lohrheidestadion traf. Samast war Leroy Sanés Trainer in der U9 und U10 der SG Wattenscheid. Größter Erfolg: 2005 wurde die SG mit Trainer Samast und Stürmer Sané NRW-Vizemeister hinter Bayer 04 Leverkusen. Siegprämien waren Süßigkeiten wie Gummibärchen, Schokoriegel oder Milchschnitten.
Schon früh erkannte Samast, dass er ein Ausnahmetalent unter seinen Fittichen hatte: »Leroy war extrem schnell, technisch überragend und vor allem physisch sehr weit. Er hatte schon mit neun Jahren einen Sixpack und eine ausgeprägte Nackenmuskulatur. Die anderen Kinder waren gegen ihn schmal.« Leroy Sané entwickelte auch schon in jungen Jahren Interesse an Taktik und Teamchemie. Nach den Halbzeitansprachen des Trainers habe er häufig vor seinen Mitspielern in der Umkleidekabine das Wort ergriffen und Anweisungen gegeben, berichtete Samat. Kritik habe der junge Fußballer als konstruktiv empfunden: Er schaute seinen Trainer dann mit großen Augen an und nickte. Samast: »Anders als viele andere Jungs in dem Alter war er nach der Kritik nie eingeschnappt. Er wollte lernen.«
2005 trennten sich die Wege. Samast übernahm den Bezirksligisten Hedefspor Hattingen, an Sané waren große Clubs wie Borussia Dortmund, der FC Schalke 04 und der VfL Bochum interessiert. Der Neunjährige schloss sich der Knappenschmiede an, dem Nachwuchsleistungszentrum von S04. Drei Jahre blieb er dort, ehe er im Sommer 2008 gemeinsam mit seinem ein Jahr älteren Bruder Kim, der bis dahin in der Jugend des VfL Bochum gespielt hatte, zu Bayer 04 Leverkusen wechselte. 2009 folgte auch sein sieben Jahre jüngerer Bruder Sidi in die Talentschmiede am Rhein. »Jeder Verein hat in der Ausbildung eine eigene Philosophie«, erinnerte sich Vater Souleyman Sané in einem Kicker-Interview. »Also habe ich gesagt, so ein Wechsel könnte für die Entwicklung sinnvoll sein. In Leverkusen steht die spielerische und individuelle Förderung etwas mehr im Vordergrund. Auf Schalke wird der Mannschaftsgedanke noch größer geschrieben. Es war gut, beides kennenzulernen.«
»Anders als viele andere Jungs in dem Alter war er nach der Kritik nie eingeschnappt. Er wollte lernen.«
Jugendtrainer Aytekin Samast über den jungen Leroy Sané
Die Sané-Söhne bezogen jedoch keine Zimmer im Sportinternat Leverkusen, sondern lebten weiterhin unter dem elterlichen Dach in Bochum-Wattenscheid. Leroy besuchte die Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen. Den täglichen Fahrdienst für die knapp 80 Kilometer über die stauträchtigen Autobahnen des Ruhrgebietes nach Leverkusen übernahmen zunächst die Eltern, danach Chauffeure von Bayer. 2011 kehrten die Brüder zu Schalke zurück. »Es gab irgendwann ein kleines Fahr-Problem«, erinnerte sich in der Bild-Zeitung der damalige Leiter der Bayer-Nachwuchsabteilung, der langjährige Bundesliga-Profi und -Trainer Jürgen Gelsdorf. »Wir haben alles versucht, aber wir konnten ihn leider nicht halten. Das tut mir heute noch weh, doch wir mussten es akzeptieren.«
Gelsdorf bot den Sané-Brüdern die Unterbringung bei einer Gastfamilie an, Mutter Regina eine Stelle als Trainerin und Vater Souleyman eine Position als Scout – alles vergebens. In Gelsdorfs Büro hängt dem Vernehmen nach noch heute ein Foto des jungen Leroy Sané jubelnd im Bayer-Dress. Immerhin profitierte Leverkusen fünf Jahre später vom Transfer zu Manchester City. Die Ausbildungsentschädigung im Regelwerk der FIFA sieht vor, dass sämtliche Vereine, für die ein Spieler zwischen seinem zwölften und 23. Lebensjahr spielte, prozentual an der Ablösesumme beteiligt werden. Bei Leroy Sané waren dies für Bayer immerhin knapp 375.000 Euro.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.