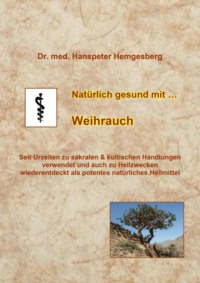Kitabı oku: «Natürlich gesund mit Weihrauch»
Dr. Hanspeter Hemgesberg
Natürlich gesund mit Weihrauch
Einst Beigabe zum Opferkult für Gott Baal, heute wiederentdeckt als potentes Heilmittel
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Hinweis
Quo vadis „Natur- und Ganzheitsmedizin“?
Weihrauch – Ein Duft fasziniert!
Eine Pflanze stellt sich vor!
Weihrauch(-Pflanze): Die Botanik
Weihrauch: Weit mehr als „Rauch“!
Götter, Götzen & Gelehrte …
Von Weihrauch und von Weihrauch!
Natura sanat!
Schon im Altertum bewährt …
… und in der Gegenwart optimiert!
Weihrauch-Extrakte in der Therapie „Gestern & Heute“
Weihrauch als Arznei(mittel)
Ganzheitliche Rezepturen
Weihrauch-Therapie „Gestern“
Weihrauch: Wirkung „JA“ – Wunder „NEIN“
Weihrauch für: Wohlbefinden + Wohlergehen
Weihrauch: Kosmetikum
Weihrauch: Räucherwerk
Das sollten Sie wissen …
Anschriften & Bezugsquellen…
In eigener „Sache“ …
Persönliche Notizen
Impressum neobooks
Vorwort
Dieses Buch
Natürlich gesund mit Weihrauch
will Sie - als aktiven Menschen, allgemein an der eigenen Gesundheit Interessierten und ganz besonders aber auch alle biologisch-naturheilkundlich (besonders ganzheitlich) orientierte Therapeuten - informieren und beraten.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Jedoch kann eine Verbindlichkeit aus ihnen nicht hergeleitet werden.
Natürlich gesund mit Weihrauch
Verfasser:
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
Wissenschaftliche Recherche
Rosemarie Hemgesberg
Sonstige Recherche
Claudia Hemgesberg
Sandra Hemgesberg
Redaktionelle Mitarbeit & Lektorat
Andrea Hemgesberg
Hinweis
W
ichtige Fachbegriffe bzw. Fremdwörter in diesem Buch sind gekennzeichnet mit einem {?}. Im Glossar werden diese Begriffe unter „Glossar:
„Das sollten Sie wissen“
in alphabetischer Reihenfolge erklärt & erläutert.
Ihr
Dr. Hanspeter Hemgesberg
Quo vadis „Natur- und Ganzheitsmedizin“?
Es ist nachgerade schon eine ständige „Berg- & Talbahn-Fahrt“; ja, man könnte man es schon einen „Januskopf“ nennen: Unser zwiespältiges Verhältnis und unseren Umgang mit der „Naturmedizin“ {?}; korrekter mit der „biologisch-naturheilkundlichen Medizin {?} und ganz besonders mit der integrativen Ganzheitsmedizin“!

(Abb. Logo Ganzheitsmedizin)
Das gilt fast unisono für die weit überwiegende Mehrheit der Fachleute, also der (Schul-)Mediziner; leider bestehen aber auch unter den Laien, also der Bevölkerung, nennen wir es einmal vorsichtig ‚Verunsicherungen’ und insbesondere ‚Wissenslücken’!
So liegen auch heute noch das
„Hosianna“
und das
„Kreuzigt sie“
bei der naturheilkundlichen orientierten Ganzheitsmedizin dicht beieinander und vielmals zudem unterworfen einem, dem gesunden Menschenverstand nicht zugänglichen und rational nicht begründbaren „Auf-und-Ab“ in der Wertschätzung. Was gestern anerkannt und hochgepriesen war, das kann morgen schon vehement abgelehnt und in Grund-und-Boden verdammt sein und umgekehrt: ein regelrechtes Karussell!
Jahrtausende war die Heilkunde und Heilkunst reine „Erfahrens-Medizin“, ja, eine „Volks-Medizin“ und nicht zuletzt und insbesondere eine „Biologisch-Naturheilkundliche Sichtweise und Behandlungsform“ und dabei unter dem Einsatz und der An- & Verwendung von Wirkstoffen aus der Natur, also von Blumen, Kräutern, Pflanzen, Sträuchern, Büschen & Bäumen, Mineralien, Bodenschätzen und aus Wasser und Boden ganz generell und natürlich auch aus dem Tierbereich.
Dabei wurden die Erfahrungen anfangs örtlich eng begrenzt von Heilkundigen zur nächsten Generation weitergegeben; später dann auch mit zunehmender Mobilität auch von Kulturkreis zu Kulturkreis. Immer aber wurde die Anwendung (die Therapiemaßnahmen & insbesondere die Heilstoffe) dabei überprüft und die Indikationen verändert, ergänzt oder bestätigt.
Alles
„reines Erfahrenswissen“
werden die einen - die der
reinen wissenschaftlichen (Medizin-)Lehre
anhängenden - Vertreter sagen, weil bar jeder Wissenschaft.
Zugestanden: anfangs sicherlich reine Erfahrung!
Aber: Ist eine Jahrhunderte- oder sogar Jahrtausende-alte Erfahrung und die erfolgreiche Anwendung bei einer unzählbaren Schar von Kranken denn so einfach - quasi mit einer Handbewegung - abzutun und abzuqualifizieren? Kann man die Heilswirkungen generell negieren als Zufallsbefunde? Nein und nochmals Nein!
Kann und vor allem darf man das „Über-einen-Leisten-schlagen“ auch heute noch aufrechterhalten, wo doch bei und für viele
Naturwirkstoffe
- ganz gleich, aus welchem Bereich sie entstammen -, mittlerweile zahlreiche wissenschaftliche Forschungen namhafter Forscher und (Schul-)Mediziner im In- und Ausland durchgeführt worden sind und die Wirksamkeit nachgewiesen und eindeutig gesichert ist (nebenbei: dies auch durch die Verlautbarungen im BundesAnzeiger [BAnz] des Bundes-Institutes für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM] in Bonn und der dafür zuständigen Kommissionen auch verbindlich dokumentiert ist!)?
Andererseits:
Naturarzneien also regelrechte „Wunderwaffen“ gegen jedes & alles und dazu von jedermann zur Selbstmedikation/Selbstbehandlung ohne Risiken & Nebenwirkungen anzuwenden?
Auch hier: Ein lautes und absolutes Nein!
L
assen Sie mich versuchen, Ihnen dies zu erklären und verständlich zu machen an meinem so von mir genannten
„Naturheilmittel-Dreisprung“
:
Zuerst einmal müssen mindestens Grundkenntnisse über die jeweilige Heilpflanze, das Mineral oder den Wirkstoff aus dem Tierreich erworben werden. Dazu gehört auch ein Grundwissen über die Inhalts- oder Wirkstoffe im Allgemeinen und auch über die Herkunft und die Anwendung in der Volks- bzw. Erfahrensheilkunde. Das der
„1. Sprung“!
Dann - im
„2. Sprung“
- gilt es das Basiswissen zu erweitern und auch zu präzisieren und zwar im Hinblick auf Einzel- & Gesamtwirkungen und somit auch hinsichtlich Anwendungsmöglichkeiten (Indikationen).
Im und mit dem
„3. Sprung“
müssen dann speziell-spezifische Kenntnisse hinzukommen; dazu gehören Wissen um die verschiedenen
medizinischen Zubereitungsmöglichkeiten
(z.B. als Homöopathikum, als Spagyrikum oder als Phytopharmakon usw.) und dann die unverzichtbaren Fakten zu Neben- & Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und besonders auch Gegenanzeigen gekannt sein und die Grenzen der Anwendung!
Ich kann Ihnen allen - Laien wie besonders den Fachleuten! - nur ganz herzlich anempfehlen, zu verinnerlichen:
Auch naturheilkundlich-biologische Präparate & Arzneien können Neben- und Wechselwirkungen auch Gegenanzeigen haben!
Beherzigen Sie den Ausspruch des großen Arztes & Naturforschers
Paracelsus
(vulgo: Philipp Theophrastus Bombastus von Hohenheim * 1493-1541):
„Die Dosis macht das Gift!“
(„Dosis sola venenum facit“)
Und - dies gerichtet an die Heilsuchenden (die Patienten), die Kranken -:
nehmen Sie nur
- wenn überhaupt -
Selbstbehandlungen vor, wenn Sie zu und über die anzuwendenden Mittel ausreichende Kenntnisse besitzen!
Dies alles gilt ungeschmälert für den Gesamtbereich aller Natur-heilmittel.
A
nlass und Ziel dieses Buches ist es, bei Ihnen - Laien wie Fachleuten - Verständnis für die
Biologisch-Naturheilkundliche Medizin
zu wecken, Ihnen dann spezielle Kennt-nisse zu vermitteln und in diesem Falle über die Anwendungsmög-lichkeiten und Wirkungen - und nicht nur als „Arznei“ - der uralten Heilpflanze
Weihrauch
.
Repetitio mater est studiorum
, so lautet eine alte lateinische Erfahrensweisheit; zu gut Deutsch:
Übung macht den Meister!
Dem ist nur noch eine zweite Spruchweisheit hinzuzufügen, nämlich:
Et respice fines
- übersetzt:
Beachte die Grenzen
-!
Dann - aber auch nur dann - gilt
Natürlich gesund mit … Weihrauch
Weihrauch – Ein Duft fasziniert!
Weihrauchwölkchen
Durch meinen Garten flog ein Weihrauchwölkchen,
Ein Kirchenduft der Maienprozession:
Der Wohlgeruch gefiel dem Bienenvölkchen,
Und süßer ward der Blumen hauch davon.
Indes die Knaben von Maria sangen,
Die himmelfern auf mondner Sichel steht,
Und ihre Stimmen in der Flur verklangen,
Verrichteten die Immen ihr Gebet.
Sie zogen den blühenden Kapellen,
Geweiht dem Kinde und der Lieben Frau,
Und schöpften summend aus den Nektarquellen
Das reine Wachs, den goldenen Honigtau.
Die Beete glänzten von Gewürzt und Kräutern,
Gesegnet von der Maienprozession.
Das Öl begann sich zärtlicher zu läutern,
Von Vogelwipfeln glockte Glorienton.
Durch meinen Garten flog das Weihrauchwölkchen
Und floß vergebend in die Gottesluft:
Als zöge heimlich mit ein Engelswölkchen,
Umwehte traumhaft mich ein Sternenduft.
Friedrich Schnack
(1888-1977)
G
anz bewusst stelle ich das Gedicht des deutschen Dichters und Schriftstellers
Friedrich Schnack
an den Anfang. Schnack brachte in vielen seiner Gedichte und Werke die Natur, die Landschaft und Tradition der barocken Frömmigkeit seiner main-fränkischen Heimat zum Ausdruck. Mit gleicher Kraft, mit der ihn die farbige Fülle des Nahen, Kleinen, der Edelsteine, Blumen und Schmetterlinge fesselt, zog es ihn immer wieder in die bunte Welt ferner Länder und besonders auch in das Reich von „Märchen & Träumen“.
Gerade in diesem Gedicht
„Weihrauchwölkchen“
ist ja bereits einiges über den Weihrauch festgehalten: der faszinierende, ja betörende Duft, die Bedeutung in und für die Natur und auch die Verwendung in der katholischen Kirche im Osten wie im Westen.
I
ch rieche ihn nachgerade, diesen wohlig-aromatisch-kräftigen Duft des Weihrauchs während ich diese Zeilen zu Papier bringe und fühle mich rückversetzt in meine Kindheit als Ministrant (Messdiener). Wie gerne habe ich das Weihrauchfass gefüllt, gezündelt und dann kräftig und ausholend hin-und-her geschwenkt, dass es nur so eine Freude war, die Duftwolken durch das Kirchenschiff wabern zu sehen und besonders zu riechen. Noch immer gehört auch heute Weihrauch für mich untrennbar zu einem harmonischen Weihnachts-abend.
Nun muss man aber wissen, dass der
Weihrauch für kirchliche Zwecke
eigentlich eine Mischung verschiedener Ingredienzien ist und dass es etliche
Weihrauch-Mixturen
und
Weihrauch-Kirchen-Rezepturen
gibt. Allen ist aber immer gemein der Weihrauch als wichtigste und unverzichtbare Komponente.
Ich begehe kein Sakrileg, wenn ich Ihnen - quasi als Einstimmung - hier drei dieser Rezepturen (Quelle: „Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis“) bekannt gebe:
Weihrauch für sakrale Anlässe
Weihrauch-Mixtur Nr. 1
Mische:
Benzoes resina [Asa odorata – Benzoe-Harz] 175,0
Styracis balsamum [Styrax-Balsam] 175,0
Olibanum [Weihrauch-Harz] 250,0
Myrrhis odorata [Myrrhen-Harz] 250,0
Cortic. Cascarilla [Rinde des amerikan. Faulbaums] 144,0
Olei lavandulae [Lavendel-Öl] 2,0
Olei bergamottae [Bergamotte-Öl] 2,0
Olei caryophyllorum [Nelken-Öl] 1,0
Olei cinna
momi [Zimt(rinden)-Öl] 1,0
Weihrauch-Mixtur Nr. 2
Mische:
Benzoes resina [Asa odorata – Benzoe-Harz] 300,0
Styracis balsamum [Styrax-Balsam] 300,0
Olibanum [Weihrauch-Harz] 200,0
Succini [Radix succina pratensis –
Wurzel vom Teufelsabbiß] 100,0
Flores lavandulae [Lavendel-Blüten] 100,0
Weihrauch-Mixtur Nr. 3 nach Rody
Mische:
Benzoes sumatrae [Sumatra-Benzoe-Harz] 100,0
Styracis calamit. 100,0
Olibanum naturale 500,0
Olibanum elect. in lacrimae 500,0
F
ür den ‚Hausgebrauch’ - für die Duft- oder Aromalampe oder ähnliche Behältnisse - und nicht nur in den Wintermonaten (dann auch bestens geeignet zum Aufstreuen auf ein Kaminfeuer oder in den Kachelofen!) sollten Sie sich natürlich eine kleinere Menge mischen lassen bei unveränderten Mischungsverhältnissen.
Ich selbst bevorzuge die Mixtur nach Rody. Dazu reicht eine Mischungsmenge von ca. 250 g für eine lange Zeit aus. Bewahren Sie die Mischungen in einer gut verschließbaren Dose (z.B. Tuppa) licht-, feuchtigkeits- & hitzegeschützt auf.
Verwenden Sie stets nur eine kleine Menge dieser Mixturen, denn der Geruch ist intensiv und, wird zu viel Mischung genommen, dann wirkt der Duft nicht mehr angenehm und entspannend, sondern schwer-süßlich und er wird dann oft als belastend, ermüdend, ja sogar als betäubend empfunden. Das wollen wir tunlich vermeiden!
TIPP:
Psycho-Harmonie & -Balance
mit
Aroma-Therapie + Entspannungsverfahren
Die Wirkung der Aroma-Therapie mit Weihrauch(mischungen oder pur) können Sie noch steigern durch die gleichzeitige Anwendung eines Entspannungs-Verfahrens [u.a. Relaxierende Tiefenentspannung „Musik & Ton“, DeHypno-Therapie, Medizinische Resonanz Therapie Musik (MRTM) oder Psychofonie * s. später]. Besonders eignet sich die MRTM, so z.B.
„Auflösung von Stress“
,
„Lebenskraft“
,
„Entspannung“
oder
„Harmonie“
.
Das ist „Aufgehen in Musik & Duft“; das schüttelt den Staub von der Seele und lädt den Akku wieder kräftig auf.
I
ch hoffe, Sie sind nun bereits etwas eingestimmt auf das Thema
„Weihrauch“
und sind nun auch bereit und zugleich neugierig, mit mir gemeinsam auf eine Entdeckungs-Reise dieser uralten Pflanze zu gehen.
Eines vorweg:
Weihrauch ist weit mehr, denn eine ausschließlich zu sakralen oder esoterisch-spiritistischen Zwecken genutzte und zu nutzende Pflanze!
Eine Pflanze stellt sich vor!
B
eginnen wir ganz am Anfang, also mit dem deutschen Namen.
Weihrauch
heißt nichts anderes als
geweihter Rauch
und auch
heiliger Rauch
. Die Benennung enthält als ersten Wortteil
Weih
, ursprünglich in der althochdeutschen Sprache
wihen
und als Adjektiv
wih
(in der gotischen Sprache
weihs
) mit der Bedeutung
geweiht, heilig
. Dieses Adjektiv ist seit dem 16. Jahrhundert ausgestorben und lediglich in Wortverbindungen hat es sich erhalten; so auch z.B. in
Weihnachten, Weihwasser
.
Im Althochdeutschen hieß es
wihrouch
und im Mittelhochdeutschen
wirouch
.
Da das Harz des Weihrauch-Baumes verwendet wird und zumal zu Räucherzwecken ist auch heute noch in der ländlich-katholischen Bevölkerung der Begriff
Räucherharz
als Synonym geläufig.
Weitere Namen sind für Weihrauch bekannt, so mit Hinweis auf den sakralen Gebrauch als
Kirchenharz
oder
Kirchenrauch
.
Weltliche Namen sind u.a.
Weißer Wirk
oder schlicht
Gummi
.
Im gesamten englischen Sprachraum sind Namen gebräuchlich wie
gum olibanum
,
gum thus
,
incense
,
true Franckinsence
. In der französischen Sprache heißt er
encense
und auf spanisch
icienso
und in Italien nennt man ihn
incenso
.
Weihrauch ist weit mehr als das heutige Idiom und müsste eigentlich korrekt getrennt bezeichnet werden als Weihrauch-Harz und Weihrauch-Baum.
Daher muss/sollte - bevor wir zu den enthaltenen Wirk- und Inhaltsstoffen dieser Pflanze zu sprechen kommen - ein kurzer Seitenschwenk in die Botanik unternommen werden.
Weihrauch(-Pflanze): Die Botanik
D
er naturwissenschaftlich-botanische Name des Weihrauch-Baumes (der Weihrauch-Pflanze) lautet
Boswellia.
Sämtliche Boswellia-Spezies gehören zur Pflanzenfamilie der
Burseraceae
(Balsambaum- oder Balsaminen-Gewächse; also einer Familie vorwiegend tropischer, Harz-liefernder Holzgewächse).
Wer gehört noch alles zu dieser Pflanzenfamilie?
So u.a. der
Mekka-Baum
(Commiphora opobalsamum als Lieferant des „MekkaBalsams“), die
Manila-Elemi-Blume
(Canarum luzonicum) und auch der
Myrrhen-Baum
(Commiphora molmol als Lieferant der ebenfalls seit Urzeiten ge-schätzten Myrrhe) und zuletzt auch noch die als
Falsche Myrrhe
bekannte Pflanze für das
Bdellium-Harz
(Balsamomendron africanum).
Alle übrigen
Balsam-Lieferanten
wie der
Jesuiter-Balsam
(Balsamum copaiuva * Kopaiva-Balsam), der
Illurin-Balsam
(Balsamum copaiva africanum) - beides Leguminosae-Arten (= Hülsenfrüchte!) -, der
Marien-Balsam
(Balsamum Mariae * gewonnen aus Calophyllum inophyllum = Tacamahak-Harz; gehört zu den Guttiferae oder Hartheugewächsen) oder auch der bekannte
Peru-Balsam
(Balsamum peruvianum; gewonnen aus Myroxylon balsamum var. pereirae; zählt zu den Leguminosen und hier zur Spezies der Papilionatae = Schmetterlingsblütler), der
Storax-
oder
Styrax-Balsam
(Balsamum styracis des Liquidambar orientalis-Baumes, der zu den Hamalidaceae zählt) und auch der
Tolu-Balsam
(Balsamum tolutanum oder Resina tolutana; gewonnen aus dem Myroxylon balsamum var. genuinum; einem nahen Verwandten des zuvor genannten Lieferanten des Peru-Balsams) zählen nicht zu dieser Pflanzenfamilie, wenngleich ebenfalls Harz-Lieferanten.
G
anz allgemein:
Dort, wo das Klima heiß und sehr trocken ist, dazu, wo die Erde mineralstoff-reich und steinig ist, dort, wo es nur selten und in geringen Mengen regnet und die gesamte Vegetation praktisch nur dadurch leben kann, dass Tau und Nebel das lebenswichtige Wasser spenden, dort wächst und gedeiht er, der
„Weihrauch-Baum“
.
So findet sich der Weihrauch-Baum als heimisches (nicht kultiviertes) Gewächs sowohl in den höher gelegenen Berg-Regionen um das Rote Meer wie auch in den trockenen Hochebene Indiens.
Als
Weihrauch-Land
wurde die antike Landschaft im südlichen Arabien bezeichnet: die Küste von
Hadramaut am Golf von Aden
(Aden bedeutet im Arabischen „adan“ = Paradies * Golf von Aden ist der Teil des Indischen Ozeans, der begrenzt wird im Süden von der Halbinsel Somali und im Norden von der Arabischen Halbinsel). Aden war bereits in der Antike der wichtigste Handelsumschlagplatz zwischen Europa und Asien. Von Aden aus nahm die berühmte
Weihrauch-Straße
ihren Ausgang, die älteste Welthandelsstrasse überhaupt, die bis zum Mittelmeer führte.
Außer in Nubien und im
Weihrauch-Land
wächst gedeiht die Pflanze in Südarabien und in Afrika im Gebiet des ehemaligen Äthiopiens und in allen weiteren Regionen Afrikas mit tropischem Klima und außerdem noch weit-verbreitet in Indien.
Z
um Gewächs an sich und als solchem:
Es handelt sich um einen recht kleinen - zwischen 4 und maximal 6 m hohen - Baum von gedrungenem Wuchs mit kurzen Ästen und „knorrigen“ Blättern. Dabei sind die Blätter klein - das ist immens ‚überlebenswichtig’, um ein rasches Verdunsten des lebensnotwendigen und raren Wassers möglichst gering zu halten. Eigentlich ein recht unscheinbarer Baum, zumindest, was den oberirdischen Teil angeht. Ganz anders schaut es eine Etage, also im Boden aus: das Wurzelwerk ist beeindruckend; die Wurzeln reichen bis zu 30 m in die Tiefe. Dies ist auch erforderlich, um an das kostbare und rare Wasser - zumal in den Trockenperioden - heranzukommen!
Der eigentliche Schatz des Weihrauchbaumes ist jedoch weder in der Erde zu finden noch von außen zu sehen: im Bauminnern ist dieser Schatz verborgen und tritt erst bei Verletzung der Rinde nach außen zutage: der weiße Milchsaft, der unter Sonnenlicht zu dem begehrten und wertvollen Weihrauchharz erstarrt. Dieses Harz ist in Europa unter dem lateinischen Namen
Olibanum
bekannt.
G
estatten Sie einen kurzen Seitenblick und zwar zur „Ernte des Weihrauch-Harzes“, also zur „Gewinnung des Rohstoffes Weihrauch“: Auch heute im Zeitalter von ‚High-Tech’ erfolgt die Weihrauch(harz)-Ernte immer noch mit denselben schlichten Verfahren wie schon zu Zeiten der Ur-Ahnen der jetzigen Generationen; also auch heute noch so wie schon vor und seit Jahrtausenden.
Zur
„Ernte des Harzes“
wird die Baumrinde [die Rinde des Stammes und auch der stärkeren Äste wird ein-geschnitten und zwar an mindestens zwischen 10 bis maximal 30 Schnittstellen] mit einem Schabemesser an-geritzt, so dass aus diesen ‚künstlichen Wunden’ dann das Gummiharz als weißer Milchsaft aus den Harzgängen in und unter der Rinde herausläuft. An der Sonne trocknet der Milchsaft und erstarrt zu kleinen
„Weihrauchharz-Tränen“
(„Lacrimae Olibani“). Die erstarrte Harz-Milch wird nach ca. 2-3-4 Wochen mit einem Schabemesser (also mit „Handkraft“) abgekratzt und nicht zur Weiterverarbeitung verwendet, also verworfen. An den gleichen Schabestellen wird nun ein zweites Mal an der Rinde gekratzt, geritzt und geschabt. Nun erst ist der Weg freigemacht für einen ergiebigen Milchfluss von höchster Qualität. Der Milchsaft dickt ebenfalls an der Sonne ein zu nun
grünlichen, gelben bis gold-braunen durchsichtigen Harztränen und Harzklumpen
(Abb. * Quelle: welt.de) und erstarrt. Die Harzklumpen werden abgeerntet und gesammelt und dann später sortiert und dann der Weiterverarbeitung zugeführt.
Bleibt noch anzumerken, dass für arzneilich, pharmazeutische Zwecke ausschließlich Weihrauchharze von allerhöchster Reinheit & Qualität verwendet werden: die Bezeichnung
„premium quality“
. D.h.: es finden ausschließlich Verwendung die tropfen- und/oder kolbenförmigen grünlich-weißen bis gold-gelben Harztränen, ohne Verunreinigungen & Einschlüsse und nur solche mit einer Länge von mindestens 3 cm.
Alle übrigen, somit minderen, Qualitäten - sie enthalten in verschiedenen Anteilen Verunreinigungen und braune bis schwarze Anteile/Einschlüsse - finden Verwendung zur Herstellung von Räucherwerk und in der Kosmetik.
Obgleich prinzipiell das gesamte Jahr über geerntet werden kann (könnte), gelten auch heute noch 2 Haupt-Erntezeiten für die Harzge-winnung. Bereits einige Monate vor der eigentlichen „Ernte“ müssen die Rinden eingekerbt werden. So werden im Oktober und März die Einkerbungen vorgenommen und das Harz wird dann gesammelt in den beiden Monaten März und Juni.
Je Baum - dies schildern sehr anschaulich
D. Martinetz
,
K. Lohs
und
J. Janzen
in ihrem Buch
„Weihrauch und Myrrhe“
- können so etwa 10-20 kg Gummiharz jährlich gewonnen werden.
Die Bewirtschaftung (Ernte) eines Baumes dauert maximal drei Jahre an, dann muss eine mehrjährige Ruhepause zur Schonung des Baumes erfolgen.
Z
urück zu den
Boswellia-Bäumen
:
Die Gattung
Boswellia
umfasst folgende Arten:
Boswellia sacra - Arabischer Weihrauch, auch Somalischer Weihrauch (Synonym: Boswellia carterii Birdw.);
Boswellia frereana - Elemi-Weihrauch;
Boswellia dalzielii - Dalziels Weihrauch, Westafrika;
Boswellia papyrifera - Äthiopischer Weihrauch (Synonym Amyris papyrifera);
Boswellia serrata - Indischer Weihrauch (Synonym: Boswellia glabra Roxb.).
Das sind die für die Lieferung von Weihrauchharzen wichtigsten Bos-wellia-Arten.
Die gesamte Gattung
Boswellia ROXBURGHII
Ex COLEBR
(Synonym: Libanus COLEBR.)
umfasst
23 Arten.
Die Gattung selbst wird nicht weit-er untergliedert, so nachzulesen in
„Die natürlichen Pflanzenfamilien“
(A. Engler und K. Prantl). Allen Weihrauch-Gewächsen gemeinsam ist der Familienname
„Boswellia“
.
Z
u den typischen Gattungsmerkmalen: Es handelt sich bei allen Weihrauch-Arten um Bäumchen bis Bäumen - oft mit dünner, in papierartigen Schichten sich ablösender Rinde - mit auffallend gedrücktem und geducktem Wuchs, an kleine Obstbäume erinnernd.
Bei allen Boswellia-Arten sind die Blätter unpaarig gefiedert, mit ganzrandigen oder auch gekerbten Blättchen; sie fühlen sich fast lederartig an und stehen am Ende der Zweige dicht zusammen-gedrängt. Die Blüten stehen in zusammengesetzten Rispen und sind ziemlich groß, von weißlich bis rötlicher Färbung. Die Blüten sind zwittrig und fünfgliedrig und mit 10 Staubgefäßen am äußeren Rand eines ringförmigen Diskus. Der Fruchtknoten ist in der späteren Entwicklung kurz gestielt, zudem normalerweise dreifächrig. Die Steinfrucht der Boswellia ist zumeist dreikantig, seltener auch zweikantig; dabei zwei- bis drei-fächrig und mit knochenharten, fast herzförmigen Steinkernen. Der Samen der Frucht ist umhüllt von einer dünnen Schale; der Samen selbst ist stark ölhaltig.
D
ie Ur-Heimat des Weihrauchbaumes ist wohl
Nubien
gewesen, also das Steppen- und auch Wüsten-Gebiet in Nord-Afrika am Nil zwischen Assuan und Khartum. Weihrauch wird in Arabien und Somalia seit mindestens 4.000 Jahren gewonnen. Er war das begehrteste Räucherharz zur damaligen Zeit.
Nebenbei:
Nubien war in der Zeit zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert nach Christi ein hoch angesehenes Zentrum christlich-nordafrikanischer Kultur!
E
in kurzer Blick zu verschiedenen Boswellia-Spezies:
Zuerst
Boswellia carterii
oder
sacra
.
Wahrscheinlich handelt es sich bei der
Boswellia bhaudajiana
ebenfalls um die B. carteri. Noch nicht endgültig ist dabei allerdings wissenschaftlich entschieden, ob die B. carteri und die B. sacra nicht doch zwei unterschiedliche Arten sind; beide sind rein äußerlich kaum voneinander zu unterscheiden.
Dieser Weihrauchbaum ist noch bekannt mit weiteren Benennungen. So im englischen Sprach- und besonders wirtschaftlichen EinflussBereich mit
Frankincense tree
. In Somalia als der eigentlichen Heimat nennt man ihn
Mahor maddow
oder
Mohur meddhu
oder auch
Moxor
. Neben Somali-Land (hier besonders Nord-Somali) ist dieser Baum ebenfalls heimisch (geworden) wie auch in Süd-Arabien und in Ägypten.
Ein gezielter Anbau findet erst seit Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts statt auf Versuchspflanzungen in Nord-Somalia.
Die Sammlung der „Droge“ Weihrauch erfolgt auch heute fast ausschließlich aus Wildbeständen.
Zur
Botanik
:
Es handelt sich um einen kleinen Baum und oft nur um ein Bäumchen mit einer maximalen Wuchshöhe von 1,5 - 2,5 m; vielmals auch um einen kräftigen Weihrauchbusch (s. Abb. oben) ohne einen zentralen Stamm. Charakteristisch sind die sieben- bis neun-paarig gefiederten Blätter, welche an der Unterseite filzartig behaart sind (seltener auch an beiden Blattseiten), dazu sind sie wellig gekerbt oder auch ganzrandig. Blütezeit ist der Monat April.
An Inhaltsstoffen ist das Gummiharz (Weihrauch-Harz * Olibanum) zu nennen. Die sonstigen Pflanzenteile sind noch nicht endgültig phytochemisch untersucht.
Was die Bedeutung der Inhaltsstoffe angeht, so wird darüber später ausführlich zu sprechen sein. Dies gilt natürlich dann auch für die An- und Verwendung des Weihrauch-Harzes.
Zum zweiten Vertreter dieser Spezies, der
Boswellia frereana
oder auch
B. freriana
.
In Somalia wird dieser Weihrauch-baum
jagcaar
genannt.
Zur
Botanik
:
Diese Spezies wächst als 3 bis 10 m hoher Baum von zumeist schlankem Wuchs mit relativ dünnem Stamm und wenigen, in spitzem Winkel nach oben strebenden Ästen. Die Blätter sind ziemlich groß, breit und herzförmig, starr-steif, kahl und ganzrandig und von grau-grüner Farbe.