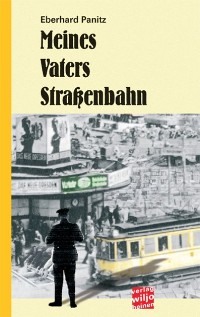Kitabı oku: «Meines Vaters Straßenbahn»
Eberhard Panitz
Meines Vaters
Straßenbahn
Erzählung
Verlag Wiljo Heinen
© Dieses elektronische Buch ist urheberrechtlich geschützt!
Autor und Verlag haben jedoch auf einen digitalen Kopierschutz verzichtet, das heißt, dass – nach dem deutschen Urheberrecht – Ihr Recht auf Privatkopie(n) durch uns nicht eingeschränkt wird!
Selbstverständlich sollen Sie das Buch auf allen Geräten lesen können, die Ihnen gehören.
Als Privatkopie gelten Sicherungskopien und Kopien in geringer Stückzahl für gute Freunde und Bekannte.
Keine Privatkopie ist z.B. die Bereitstellung zum Download im Internet oder die sonstige »Einspeisung« ins Internet (z.B. in News), die dieses Buch »jedermann« zur Verfügung stellt.
Autor und Verlag achten Ihr faires Recht auf Privatkopie – bitte helfen Sie uns dabei, indem Sie das Urheberrecht von Autor und Verlag achten.
Nur dann sind wir in der Lage, unsere elektronischen Bücher zu kleinem Preis und ohne digitalen Kopierschutz anzubieten.
Wenn Sie noch Fragen haben, was denn »faire Kopien« sind, schreiben Sie einfach eine Mail an info@gutes-lesen.de .
Und nun wollen wir Sie nicht weiter beim Lesen stören…
Die Kinder sind in alle Welt zerstreut,
aber jedes hat an Stelle
der verschwundenen Erbschaft
den Atem des Elternhauses
wie ein Stück von Vaters Totenhemd mitgenommen.
Bella Chagall: Brennende Lichter
Meines Vaters Straßenbahn,
wie sie einmal war, gibt es nicht mehr. Schon als ich im Jahre 1978 dieses Buch schrieb, gab es kaum noch irgendwo Straßenbahnschaffner, die mit ihrer Schaffnerkasse am Hals, Fahrkarten verkauften. Zum Entsetzen meines Vaters, der zeitlebens Schaffner gewesen war, taten es kleine Boxen auf dem Vorderperron auch, in die man damals zwei Groschen hineinsteckte, mehr kostete die Fahrt quer durch meine Heimatstadt Dresden bis 1990 nicht. Ich schrieb das Buch bei einem längeren Studienaufenthalt im Mittelwesten der USA, wo es ohnehin keine Straßenbahnen gab und gegeben hatte, nur in San Francisco sah ich dann zu meiner Freude die berühmten Cable Cars. Ich fuhr damit über die Hügel und durch China-Town zum Fischereihafen und wurde unterwegs erstaunlicherweise noch von uniformierten Straßenbahnschaffnern abkassiert. Das hat mich darauf gebracht, über Verlorenes aus früher Kindheit und der Jugendzeit nachzudenken. Ich begann dort dieses Buch zu schreiben und schrieb es auch in den fünf Monaten, die ich da lebte, zu Ende. Erstaunlicherweise fiel mir in der Ferne und mit dem Abstand so vieler Jahre vieles wieder ein, sogar die Straßen und Wege hatte ich wie den genauen Stadtplan und die Wanderkarten mit den Wäldern, Gewässern und Bergen um Dresden ganz frisch in Erinnerung, sogar in der völlig anderen Welt direkt vor Augen.

Mein Vater war schon tot, als ich dieses Buch schrieb, meine Mutter ist inzwischen gestorben. Über ein halbes Jahrhundert ist es ja her, als geschehen ist, was hier geschildert wird – eine ereignisreiche Zeit, für uns inmitten Europas nach dem furchtbaren Krieg dann trotz allem eine Friedenszeit. Es ließe sich von meinen Schulfreunden erzählen, die sich unlängst fast vollständig und noch quicklebendig zusammenfanden. Sogar eine Lehrerin, die allerjüngste, uns im 9. und 10. Schuljahr nur wenige Lektionen vorauseilende Russischlehrerin, war mit dabei. Immerhin die traurige Kunde vom Tod zweier Mitschüler erreichte uns, dazu die von fast allen älteren Lehrern, die ja heute neunzig, wenn nicht hundert Jahre alt wären. So sind auch fast alle Verwandten, von denen hier erzählt wird, tot – aber bei weitem nicht die lieben Cousinen und Cousins, der jüngere Bruder und die eine oder andere Jugendliebe und somit Beinahe-Verwandtschaft. Doch manche der frühen und späteren Freunde und Weggefährten habe ich aus den Augen verloren. Klein war schließlich der Kreis, als wir uns nach der neuerlichen Zeitenwende noch einmal in dem zauberhaften Dresdner Straßenbahnlokal »Linie 6« versammelten, wo wir einst in großer Runde die Premiere dieses Buches und des Fernsehfilmes gefeiert hatten.
Ich bin mir nicht sicher, ob es dieses berühmte Straßenbahn-Lokal heute noch gibt – oder ob es auch abgeschafft ist wie so manch Einzigartiges aus unserer versunkenen Welt?
Eberhard Panitz, im August 2006
Meines Vaters Straßenbahn
Es waren fast auf den Tag genau fünfundzwanzig Jahre, die ich in Berlin gelebt hatte, als ich eines Abends, an der Warschauer Brücke, in die Straßenbahn stieg und meinen Vater traf. Ich wollte zuerst meinen Augen nicht trauen; denn soviel ich wußte, war er zeit seines Lebens nie aus Dresden herausgekommen, nur, notgedrungen, im Krieg. Immerhin war es möglich, daß er als Veterinärsoldat irgendwann einmal kurierte Artilleriepferde auf einem Eisenbahntransport quer durchs Land und zur Front begleitet hatte. Warum sollte er nicht auf dem Rangierbahnhof unter der Warschauer Brücke die Tiere getränkt und gefüttert haben, vielleicht zwischen Trümmern und Rauch, in einem seltenen Moment der Ruhe nach einem Bombenangriff?
Aber das war lange her, fast vergessen, ich konnte mir darüber kein rechtes Bild machen, weil ich damals noch ein Kind und von allen ernsten Unterhaltungen ausgeschlossen war. Sicher hatte mein Vater davon erzählt, als er ein paar Monate vor Kriegsende kurz auf Urlaub kam, bedrückt, weil er nun an die Oder mußte, wo schon die Front stand. Ich erinnerte mich, daß von einem Bombardement und dem Tod vieler Pferde die Rede gewesen war, deshalb hatte man Vater einer Flakbatterie zugeteilt, die jedoch keine Flugzeuge, sondern Panzer bekämpfen sollte…
Damals wohnten wir in Dresden-Neustadt, nahe der Heide und dem Schützenhofberg, die Straßenbahn fuhr noch ohne Hindernisse vom Wilden Mann über die Marienbrücke und durch die Altstadt bis nach Plauen und Coschütz. Es war fast wie im Frieden, obwohl mein Vater statt der Straßenbahneruniform nun eine Soldatenuniform trug. Meist kassierten Frauen das Fahrgeld, es gab sogar weibliche Straßenbahnführer, junge Frauen, die den daheimgebliebenen alten Männern Konkurrenz machten und in Rekordzeiten Niedersedlitz erreichten, obwohl sie dadurch den Fahrplan durcheinanderbrachten. »Ein Chaos ist das«, sagte mißbilligend mein Vater bei diesem letzten Urlaub, wenige Tage vor den Bombenangriffen Mitte Februar. Denen folgten noch einige im März und April, bis die Stadt ein Trümmerhaufen war. Viele Triebwagen und Anhänger wurden dabei beschädigt, Oberleitungen zerfetzt, Gleise verbogen und zerstückelt; die meisten Strecken waren wochenlang unpassierbar. Durch Kollegen meines Vaters hörten wir später, daß viele der jungen, eifrigen Fahrerinnen ums Leben gekommen waren, und in mehreren Straßenbahnzügen hatte man Dutzende verkohlter Leichen von Fahrgästen gefunden.
Ich war verwirrt, als ich meinen Vater in der Straßenbahn der Linie 4 an der Warschauer Brücke sah und er zu mir sagte: »Junge, das Fahrgeld, bitte.« Es war immer ein bißchen rauchig in dieser Gegend, die Güter- und Personenzüge rangierten Tag und Nacht auf zwanzig Gleisen da unten hin und her. Die Schwaden zogen über die Brücke, durch die angrenzenden Straßenfluchten, und umwölkten auch die Autos und Fußgänger, die deshalb manchmal in Gefahr gerieten. An diesem Abend war es besonders düster nach einem Regenschauer, der mich erwischt hatte, ehe ich in die Bahn eingestiegen war. Nun wollte mir nicht in den Kopf, daß ich Fahrgeld zahlen sollte, noch dazu meinem Vater. Ich hatte schon meine zwei Groschen in die Zahlbox gesteckt, wie es neuerdings üblich war, und einen Fahrschein in der Hand. »Hier«, sagte ich, brachte jedoch nicht fertig, ihm den Schein zu zeigen, den Beweis, daß sein Erscheinen überflüssig, ja anachronistisch war. »Hier bist du jetzt?« fragte ich verlegen. »Schon lange?«
Sosehr ich mich über die Begegnung mit meinem Vater an diesem Ort und zu dieser Stunde wunderte, sein Äußeres war mir vertraut. Er trug wie vor dem Krieg seine dunkelgrüne Straßenbahneruniform; die Knöpfe, Abzeichen und Kragenspiegel blitzten, besonders die kleine goldene Straßenbahn an der Schirmmütze. An einem Lederriemen hing die blankgeputzte Wechselkasse, mit der ich als Kind spielen durfte, wenn er vom Dienst nach Hause kam. Die Geldscheine und Markstücke hatte er ordnungsgemäß auf dem Trachenberger Depot abgerechnet, Fünfpfennig- und Groschenstücke zu Rollen verpackt, doch die abgerissenen Fahrscheinblocks und die Ein- und Zweipfennigstücke überließ er mir. Ich rückte die Stühle zusammen, setzte Teddybären und Kasperpuppen darauf, lief wie in einem Straßenbahnzug von Fahrgast zu Fahrgast, drückte auf die Hebel, kassierte, wechselte, ließ das Geld herauskullern, steckte es wieder hinein und kannte nichts Schöneres, keinen anderen Beruf, den ich eines Tages wählen wollte. Es war auch immer selbstverständlich gewesen, daß Vater von Mutter und mir Fahrgeld verlangte, wenn wir einmal in seinen Straßenbahnwagen stiegen. »Es muß alles seine Richtigkeit haben«, sagte er. »Falls ein Kontrolleur kommt, möchte ich nicht als Betrüger dastehen, zu allerletzt vor euch.«
Doch an diesem trüben Abend war es anders, ich hatte meine Meinung in manchem geändert, mich für einen anderen Beruf entschieden und an die neuen Verhältnisse gewöhnt, die im Stadtverkehr herrschten. In Berlin fuhr ich meist mit der S- oder U-Bahn, die Straßenbahnen kamen im Autogewühl zu langsam voran, außerdem waren auf den Perrons wegen des Personalmangels Zahlboxen angebracht worden, und den Beruf des Schaffners gab es überhaupt nicht mehr. Irgend etwas in mir sträubte sich dagegen, das meinem Vater zu sagen, der ja zeitlebens Schaffner und gewiß dabei glücklich gewesen war, wenn man von dem geringen Lohn, 120 Mark im Monat, und dem unregelmäßigen Dienst absah. Manchmal verwünschte er die Nachtfahrten, bei denen die Züge so gut wie leer waren, oder den Sonntagsdienst, wenn er gern mit uns Spazierengehen oder in Tante Lottes Garten Stachel- oder Johannisbeeren pflücken wollte, die er gern aß. Er aß überhaupt sehr gern, reichlich und mit Genuß; alles, was Mutter auf den Tisch brachte, lobte er überschwenglich. In der Not-Zeit nach dem Krieg dagegen kam es wegen der Esserei zu Zank und Streit, als er ausgehungert, abgemagert zu einem Skelett aus der Kriegsgefangenschaft hinterm Ural zurückgekehrt war und oft über das letzte Brotstück herfiel.
Das hatte mich und meinen kleinen Bruder Achim, der kurz nach Kriegsbeginn geboren wurde, unseren Vater also nur als Soldaten kannte, nicht als Straßenbahnschaffner mit der Wechselkasse, die leider vor der Einberufung abgeliefert werden mußte, erschreckt. Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft warteten wir beide darauf, auch Mutter, daß Vater wieder seine Straßenbahneruniform anzog und die Kasse umschnürte, sie dann mit nach Hause brachte, damit alles wie früher war. Es hätte sogar noch schöner sein können, weil mein Bruder mitspielen und schon das Geld zählen konnte, er kam bald zur Schule und begriff sehr schnell, was ich ihm beibrachte. Aber Vater hockte erst einmal monatelang zu Hause, weil er einfach keine Kraft und Lust zur Arbeit hatte, sprach kaum ein Wort mit meinem Bruder und mir. Und Mutter war dauernd unterwegs, sogar am Wochenende, um irgendwo auf dem Land ein paar Bettlaken, Kopfkissen oder Handtücher gegen Kartoffeln, Brot oder wenigstens Haferkörner einzutauschen, die ich dann mit dem Hammer zu Flocken zerklopfte. Nicht einmal dazu raffte sich Vater nach seiner Heimkehr auf.
»Bist du mir noch böse?« fragte mein Vater, als sich der Rauch verzogen und die Bahn schon weit von der Brücke entfernt hatte – in welcher Richtung, darauf achtete ich jetzt nicht. Ich saß da und starrte ihn an, stumm wie ein Fisch, doch böse oder nachtragend war ich nicht, obwohl ich mich deutlich an alles erinnerte, was sich damals bei uns zu Hause zugetragen hatte. Er schien zu wissen, wo die Schuld zu suchen war, daß schließlich Mutter vollends ihre eigenen Wege ging und immer öfter von Hinauswerfen, Scheidung, von Schluß und Ende sprach. Sie war achtunddreißig Jahre, eine schöne, dunkelhaarige Frau, der viele Männer nachliefen, ihr auch manchmal Geschenke brachten, Kostbarkeiten wie Schokoladentafeln, Pralinen oder Biskuits, die sie uns beiden Jungen heimlich zusteckte. Einmal riß mir Vater ein dick mit Butter und Leberwurst bestrichenes Brötchen aus den Händen, das sie mir gegeben hatte, und aß es gierig auf. »Sei still!« schrie er Mutter an, die so entsetzt war, daß sie gar keine Worte fand. »Ihr hättet mal erleben müssen, was ich erlebt habe, seid bloß still.«
Vor dem Krieg tranken wir abends Tee, am Sonntag mit einem Schluck Rum und viel Zucker, ich bekam auch eine Tasse eingeschenkt. Wenn ich ins Bett mußte, bat ich darum, die Schlafzimmertür offen lassen zu dürfen. Ich hörte dann noch eine Weile, wie sich meine Eltern leise unterhielten. Vater sprach bedächtig, meist über ein und dasselbe: »Wir haben´s wirklich gut mit unsrer Laterne vorm Fenster, dadurch sparen wir viel Strom.« Die Stubenlampe wurde ausgeschaltet, es war hell genug, um lesen zu können, ohne sich die Augen zu verderben. Meine Mutter hatte eine Menge Bücher mit in die Ehe gebracht, Memoiren von Fürstentöchtern, Liebesgeschichten, auch zerlesene Romane, die sie oft hervorholte, sonst erfolglos vor mir versteckte, darunter vieles von Zola, auch »Moll Flanders«, »Die Kameliendame«, »Anna Karenina«, meine Lieblingsbücher. Es fiel immer genug Licht ins Schlafzimmer, daß ich unter der Bettdecke schmökern und die wenigen Worte aufschnappen konnte, die meine Eltern nebenan wechselten. »Jetzt mach die Tür zu, der Junge schläft längst«, sagte Vater nach einer Weile. Er hörte Radio, Musik oder den Bericht von einem Boxkampf. Für die Nachrichten, die er »Gequatsche« nannte, interessierte er sich nicht, auch nicht für Zeitungen oder Mutters Bücher, deshalb kam er nie auf die Idee, daß ich mit der »Kameliendame« ins Ehebett hinüberkletterte und die Nachttischlampe einschaltete und stundenlang brennen ließ. »Wie das bloß kommt, wir haben so gespart«, sagte er verwundert, wenn die Stromrechnung höher als erhofft ausfiel. »Ob sie uns da reinlegen, oder bezahlen wir am Ende die Laterne mit?«
Nein, wir waren Vater nicht böse, daß er sparsam und sogar geizig war. Meine Eltern hatten beide mit jedem Pfennig rechnen müssen, seit sie zusammen waren, obwohl auch Mutter immer arbeiten ging. Zuerst war sie Lehrling und Mädchen für alles bei der Firma Döring gewesen, einer Seifengroßhandlung am Bahnhof Mitte, die selber nie recht auf einen grünen Zweig kam. Meine Mutter zog mit einem Handwagen in der Stadt umher und belieferte kleinere Läden mit Waren, kassierte Rechnungen, bekam wenig Trinkgeld. Während der Inflation war manchmal ihr Wochenlohn am nächsten Tage auch nicht mehr als ein Trinkgeld wert. Später fand sie eine Aushilfsstellung im Kaufhaus Renner am Altmarkt, gleich rechts im Erdgeschoß, neben der Windflügeltür, in der Parfümerie. Es roch gut dort, die vielen hübschen Verkäuferinnen waren nett zu mir, wenn Vater mit mir hinkam, um Mutter abzuholen. Ich lief gleich hinter den Ladentisch und drängelte, daß sie Schluß machte und mit mir die Rolltreppe zur Spielzeugetage hochfuhr, zu den Dingen, die ich hier in den Regalen bestaunen konnte: all diese schießenden, kämpfenden Indianer- und Soldatenfiguren, galoppierenden Pferde, Fuhrwerke, Häuser, Zelte, Eisenbahnen – und wenn es kurz vorm Geburtstag oder Weihnachtsfest war, mußte ich mit Vater beiseite gehen, und Mutter kaufte etwas, irgendeinen Cowboy auf springendem Pferd mit einem Lasso, das man auswerfen und festziehen konnte. »Hat er so was nicht schon?« fragte Vater kopfschüttelnd, wenn Mutter ihn um Geld bat. »Er braucht viel nötiger was zum Anziehen.«
Auf ordentliche Kleidung achtete Vater sehr, seine Straßenbahneruniform war immer adrett, gebügelt und gebürstet, die Schuhe, Taschen und Riemen glänzten, auch an diesem regnerischen Abend in Berlin, als wäre er von der Haustür weg mit der Bahn gefahren und niemals ausgestiegen, um älteren Leuten beim Einsteigen zu helfen und »Fertig!« zu rufen und auf seiner Trillerpfeife zu pfeifen. Er war in den vielen Jahren nicht gealtert, sein Gesicht glatt, faltenlos, sorgfältig rasiert, das schwarze Haar gescheitelt, straff nach hinten gekämmt, ohne eine Spur von Grau. Wie immer trug er ein weißes Hemd unter der Uniform, das wechselte er jeden Tag. Nach Feierabend zog er eine ausrangierte Uniformhose an und die braune Hausjacke darüber, legte sich auf die Couch und sagte: »Laßt mich meine Fuffzehn machen«, schlief eine halbe oder dreiviertel Stunde fest und mit leisem Schnarchen, kleidete sich dann erst richtig an: Anzug, einen Schlips zum weißen Hemd und Staubmantel, Hut, sobald er das Haus verließ. Er besaß nur ein, zwei Anzüge und diesen eleganten Mantel, doch der war vom Schneider, der Stoff beste Qualität, die Schuhe wie lackiert, stets von ihm selbst »geflimmert«, wie er sagte, und repariert, sobald die Sohlen oder Absätze schiefgelaufen wären. »Du mußt deine Schuhe genauso pflegen, alle deine Sachen«, predigte er mir fast jeden Tag, doch machte sich meist gleich selbst darüber her. Am liebsten hätte er sich auch jetzt, bei dieser Straßenbahnfahrt, noch darum gekümmert; denn er blickte mich prüfend von oben bis unten an und schien mit meinem Äußeren nicht zufrieden zu sein. »Wie kommst du zurecht?« fragte er, und ich glaubte, er überlegte, welche von seinen Hemden, Jacken, Hosen und Schuhen für mich in Frage kämen; denn ich war nun genauso groß und auch ziemlich breitschultrig wie er. Sicher war alles noch wie neu, was er damals schon besessen oder sich in den letzten Jahren angeschafft hatte. Ich überlegte, wie es ihm in der Zeit ergangen war, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Es kam mir so vor, als sei eine Ewigkeit seitdem vergangen, obwohl ich keine Spur einer Veränderung an ihm sah, nur ein seltsam starres Lächeln, das wohl Verlegenheit ausdrückte, weil ich schwieg und auch er nichts mehr zu sagen wußte. Nur die alte Floskel, die ich allzugut kannte, brachte er wieder vor: »Ordnung muß sein« und tippte auf seine alte, blankgeflimmerte Wechselkasse. »Ich kann da keine Ausnahmen machen, Dienst ist nun mal Dienst.«
Wegen seiner Ordnungsliebe und pedantischen Sorgfalt, mit den Dingen umzugehen, kam es zu den ersten Streitereien zwischen Mutter und ihm, an die ich mich erinnerte. Er konnte keine unaufgeräumten Schubfächer und Schränke ertragen, nörgelte an dem Nähkästchen herum, in dem Wolle, Zwirn, Stoffreste, Nähnadeln und Knöpfe wirr durcheinandergerieten, wenn Mutter etwas suchte. Nie fand sie die Schere, weil Vater sie dahin gelegt hatte, wohin sie seiner Meinung nach gehörte. Genauso war es mit dem Schuhputzkasten, der Wäschetruhe, aus der auf geheimnisvolle Weise die Klammern oder die Leinen verschwanden, und mit den Schlüsseln zum Keller, Boden und für sein Fahrradschloß, die er zu seinem Zorn nie am rechten Platz wiederfinden konnte. Sein Fahrrad war mindestens fünfzehn Jahre alt, als er in den Krieg mußte. »Da hängt der Schlüssel«, sagte er beim Abschied zu mir, ernst und gewichtig, so daß ich mir vorkam, als wäre ich schon erwachsen. »Ich hab´s aufgehängt, damit die Reifen nicht leiden.« Er führte mich zu dem Rad im Keller, das er noch einmal geputzt und eingeölt hatte. »Bitte, achte darauf, daß kein Rost ansetzt, und benutze es nur im Notfall. Du weißt, was ich meine.«
Ich war siebeneinhalb Jahre und hatte nur einen einzigen Notfall erlebt, einen blutenden Mann auf der Straße am Friedhof, der vom Fahrrad gestürzt und unter einen Wehrmachtswagen geraten war. Mein Vater hielt meine Hand fest, sie war schweißnaß, doch er rührte sich nicht von der Stelle. Er versuchte auch Mutter zurückzuhalten, die sich jedoch losriß und zu dem Verunglückten lief und aufgeregt den herumstehenden Leuten zurief: »Helft doch!« Sie kniete sich neben den Mann hin, mitten auf der Straße, preßte ihr Taschentuch auf die Platzwunde am Kopf, verband ihn, nachdem irgend jemand Tücher gebracht hatte, und blieb so lange bei ihm, bis ein Krankenwagen kam und den Verletzten wegbrachte. »Mein Gott, Gerdi«, sagte Vater, bleich im Gesicht und zittrig am ganzen Körper auf einmal. »Ich kann so was nicht, nicht einmal mitansehen.«